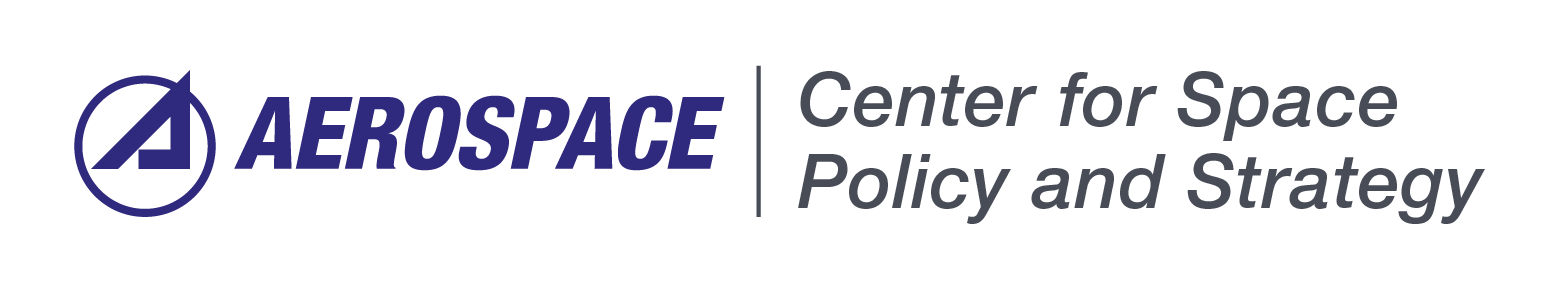Polen als aufstrebender Weltraumakteur
SWP-Aktuell 2025/A 40, 05.09.2025, 4 Seitendoi:10.18449/2025A40
ForschungsgebieteDer Krieg in der Ukraine hat deutlich gemacht, wie wichtig weltraumbasierte Kommunikations- und Aufklärungsdienste für die eigene Verteidigung sind. Europa baut seine Verteidigungsfähigkeiten aus und investiert vermehrt in Weltraumfähigkeiten, hinkt jedoch, was Letztere angeht, im weltweiten Vergleich hinterher. Die Republik Polen ist ein relativer Neuling im Weltraum. Das Land ist bestrebt, eigene Weltraumfähigkeiten aufzubauen, und legt den Fokus dabei auf Erdbeobachtung und die Erfassung der Weltraumlage. Dies kann helfen, regionale Fähigkeitslücken zu schließen. Zudem könnten Möglichkeiten zur bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Deutschland entstehen.
Seit der russischen Vollinvasion der Ukraine im Februar 2022 ist Polen zu einem zentralen Akteur in der europäischen Sicherheit geworden und hat zum generellen Trend der Aufrüstung in Europa beigetragen. Auch im Weltraum will Polen sich stärker engagieren. Der Krieg in der Ukraine hat vor Augen geführt, wie stark moderne Verteidigung von Satelliten abhängt – zum Beispiel ist das Starlink-Netzwerk, das Zugang zum Internet bietet, entscheidend für die Kommunikation der ukrainischen Truppen – und wie die Dimension Weltraum selbst zur Zielscheibe werden kann: So stört Russland immer wieder Signale des Navigationssatellitensystems GPS.
Die Entwicklungen in den Bereichen Militär und Weltraum dürfen nicht separat, sondern müssen verknüpft betrachtet werden. Im Jahr 2024 verfügte Polen über den fünftgrößten Verteidigungshaushalt unter den Nato-Staaten, hinter den USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Der für 2025 geplante Anstieg auf 4,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes würde 41 Milliarden Euro für das polnische Militär bedeuten. Polens Pläne für die Dimension Weltraum, vorgestellt in seiner Weltraumstrategie, zeigen, dass das Land anstrebt, seine Weltraumaktivitäten zu erweitern.
Polens Weltraumstrategie und ‑fähigkeiten
Die polnische Weltraumstrategie von 2017 legt die Ziele für die Entwicklung der polnischen Raumfahrt bis 2030 dar. Die Strategie bleibt bei der Setzung der Prioritäten (siehe unten) realistisch und enthält eine Beurteilung der Stärken und Schwächen des Landes. Seine Stärken sieht Polen in der gut entwickelten Informationstechnologie, in seiner Erfahrung in der Verarbeitung satellitengestützter Daten sowie seinem Know-how in verwandten Sektoren, zum Beispiel der Elektronik. Zu den von Polen selbst wahrgenommenen Schwächen gehören die vergleichsweise geringen staatlichen Investitionen im Bereich Weltraum und der Kapitalmangel auf diesem Gebiet tätiger polnischer Unternehmen. In der Strategie wird unterstrichen, dass die Entwicklung des Raumfahrtsektors in Polen auch die Bereiche Sicherheit und Verteidigung umfasse.
Weltraumfähigkeiten in der Verteidigung können in vier grobe Kategorien unterteilt werden: (1) Kommunikation, (2) Aufklärung (unter anderem für nachrichtendienstliche Zwecke), (3) Navigation und Timing sowie (4) Sensoren für Frühwarnung. Erste Priorität hat für Polen, Fähigkeiten in der Aufklärung durch die Entwicklung von Erdbeobachtungssatelliten aufzubauen, da die restlichen Kategorien zunächst durch Partner abgedeckt werden können. Eine weitere Priorität Polens ist die Schaffung von Fähigkeiten zur Weltraumlageerfassung (Space Situational Awareness, SSA). Zur Weltraumlageerfassung gehört es zum Beispiel, mithilfe erdbasierter Radare Weltraumobjekte zu erfassen und mögliche Kollisionen mit Satelliten oder Weltraumschrott zu erkennen, sodass diese vermieden werden können. Die Erfassung der Weltraumlage dient nicht nur dem Schutz von Satellitensystemen, sondern ist eine Voraussetzung für den Aufbau weiterer Fähigkeiten aus allen vier oben genannten Kategorien. Beide von Polen prioritär behandelten und mit Investitionen geförderten Felder werden dringend auf europäischer Ebene gebraucht.
In den letzten Jahren hat die polnische Weltraumagentur POLSA ihr eigenes Weltraumlagezentrum eingerichtet, um ihr eigenes Netzwerk zur Weltraumüberwachung und ‑verfolgung zu betreiben. Ein Teil der gewonnenen Daten fließt bereits in das System der Europäischen Union (EU) zur Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum (EU Space Surveillance and Tracking, EU SST) ein.
Die Entwicklung eigener Erdbeobachtungssatelliten dient Polen nicht nur dazu, eigene Weltraumfähigkeiten aufzubauen, sondern soll auch der heimischen Industrie zugutekommen. So wird eines der Projekte, das vor allem auf zivile Zwecke ausgerichtet ist, von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) geleitet, jedoch werden die Satelliten von polnischen Unternehmen gebaut und betrieben werden. Polnische Erdbeobachtungssatelliten werden zudem Teil des Projekts »Schutzschild Ost« sein, mit dem Polens Grenze zu Belarus und der russischen Exklave Kaliningrad verstärkt und somit die Abschreckung verbessert werden soll. Dies ist im Interesse der Nato. Für Deutschland ist der »Schutzschild Ost« im Hinblick auf die elektromagnetischen Angriffe Russlands auf GPS-Signale im Ostseeraum relevant, deren Ursprung in Kaliningrad vermutet wird.
Polen als Teil der europäischen Raumfahrt
Mario Draghis Bericht vom September 2024 zur Wettbewerbsfähigkeit der EU listet etliche Defizite im Bereich Weltraum auf, unter anderem unzureichende Förderung und Koordination, wenig Geld für Forschung und Entwicklung, eine kontinuierliche Abhängigkeit von Nicht-EU-Ländern, beispielsweise den USA. Dennoch sieht Polen Europa und die damit verbundenen Foren, etwa die EU und die ESA, als zentrale Möglichkeiten, seine Weltraumaktivitäten auszuweiten. Dies ist kein Widerspruch: Als aufsteigender und ambitionierter Weltraumakteur in Europa ist es sinnvoll, erste Erfahrungen im regionalen Rahmen zu sammeln.
Multilaterale Projekte bieten die Möglichkeit, Nischenexpertise einzubinden und zugleich Kosten zu sparen. Auch wenn europäische Verbündete Polens wie Deutschland und Frankreich in der Raumfahrt bereits weiter entwickelt sind, befinden sie sich dennoch auf dem gleichen Pfad der Aufrüstung mit dem Ziel, sich im Ernstfall verteidigen zu können, und teilen Polens Bedrohungswahrnehmung. Dies wiederum erleichtert Kooperation und den Austausch von Expertise. So arbeitet zum Beispiel das polnische Unternehmen Sybilla Technologies an Odin’s Eye II mit, der Weltraumkomponente des zukünftigen Raketenfrühwarnsystems der EU. Laut seiner Weltraumstrategie hofft Polen zudem, sich an den Erfolgsprojekten Galileo (Navigation) und Copernicus (Erdbeobachtung) zu beteiligen und die neuesten Generationen mitzuentwickeln. Dies wären für polnische Unternehmen wertvolle Erfahrungen, die für einen vergleichsweise kleinen Weltraumakteur auf globaler Ebene schwerlich zu gewinnen wären.
Diplomatische Aktivitäten
Obwohl sich Polens Weltraumfähigkeiten noch im Aufbau befinden, hat sich das Land in der Weltraumdiplomatie bereits etabliert. So zählte Warschau 1958 zu den 18 Gründungsmitgliedern des Ausschusses der Vereinten Nationen für die friedliche Nutzung des Weltraums (UNCOPUOS) und 1960 zu den Gründungsmitgliedern des Abrüstungsausschusses der Vereinten Nationen, aus dem später die Genfer Abrüstungskonferenz (CD) hervorgegangen ist. Polen hat die vier grundlegenden Weltraumverträge – den Weltraumvertrag von 1967, das Übereinkommen über die Rettung und Rückführung von Astronauten von 1967, das Haftungsübereinkommen von 1972 und das Registrierungsübereinkommen von 1976 – sowie den Partiellen Teststopp-Vertrag von 1963 unterzeichnet. Es ist außerdem Mitglied der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), die die Positionierung von Satelliten genehmigt. Des Weiteren unterstützt Polen die von den USA gestartete Initiative für die nächste Mondmission, indem es 2021 die Artemis-Vereinbarungen unterzeichnete.
Polens Position auf internationaler Ebene ist kaum überraschend, sind Sicherheit und Nachhaltigkeit im Weltraum doch für moderne Wirtschaftsmächte wichtig, auch wenn sie (noch) nicht über eigene Weltraumfähigkeiten verfügen. Somit folgt Polen dem europäischen Konsens.
Der Blick aus Europa und den USA
Polens Entwicklung in der Raumfahrt eröffnet neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit sowohl in Europa als auch mit den Vereinigten Staaten.
Die Herausforderung für Europa besteht darin, beim Ausbau seiner Weltraumfähigkeiten kostenaufwendige Doppelungen zu vermeiden und gleichzeitig seine Fähigkeiten zu maximieren. Polens Bemühungen in den Bereichen Erdbeobachtung und Erfassung der Weltraumlage tragen dazu bei, regionale Lücken zu füllen, weshalb es für Europa vorteilhaft ist, Polen auch mit begrenzten eigenen Fähigkeiten zu integrieren. Drei Wege multilateraler Zusammenarbeit innerhalb Europas bieten sich an: in der Nato, der EU und der ESA.
Die Nato verfügt über keine eigenen Weltraumsysteme, sondern nutzt diejenigen ihrer Mitgliedstaaten sowie kommerzielle Dienstleistungen. Das bedeutet zum einen, dass es auf die Stärke und die Kapazitäten der einzelnen Staaten ankommt, und zum anderen, dass Integration und Kooperation im Idealfall von Anfang an mitgedacht werden, um Interoperabilität zu erleichtern – vor allem auf den Gebieten Kommunikation, Aufklärung und Weltraumlagefähigkeiten. Polens Fokus auf die effiziente Aufbereitung von Daten zur Weltraumlage ist hier besonders aussichtsvoll.
Die EU-Weltraumstrategie für Sicherheit und Verteidigung ist Ausdruck dafür, dass die EU den Weltraum zunehmend auch mit militärischem Interesse betrachtet – und militärisch nützliche Weltraumfähigkeiten ausbauen und ihre Systeme, wie etwa das Navigationssystem Galileo, schützen will. Für Staaten wie Polen, deren Raumfahrtentwicklung noch am Anfang steht, ist es daher sinnvoll, sich an der EU und ihren Vorhaben zu orientieren. Aus Sicht der EU wiederum ist es förderlich, bei diesen auch kleinere Akteure in gemeinschaftliche Prozesse einzubeziehen. Von Polen bereitgestellte Daten zur Weltraumlage, die schon heute zu den Weltraumlagefähigkeiten der EU beitragen, sind ein guter Anfang.
Polens Beiträge zur ESA machten bis 2022 weniger als 1 Prozent des gesamten ESA-Budgets aus; doch hat das Land seine Beiträge seit 2023 erhöht und 2025 ein neues Hoch von fast 4 Prozent erreicht. Dies signalisiert Polens Willen, sich stärker in die Organisation einzubringen. Innerhalb der ESA findet ebenfalls ein Umdenken statt: Eine Erdbeobachtungskonstellation, die auch für die militärische Nutzung gedacht ist, befindet sich in der Anfangsphase. Polens Projekte im Bereich Erdbeobachtung könnten hierfür wertvolle Erfahrungen liefern.
Die USA und Polen arbeiten bereits im Rahmen einer Vereinbarung über SSA-Dienste und den Austausch von SSA-Daten zusammen. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass sich die amerikanisch-polnische Zusammenarbeit im Weltraum auch auf die Satellitenkommunikation erstreckt. Diese hat Polen in seiner Nationalen Sicherheitsstrategie von 2020 zu einer seiner Prioritäten erklärt. Japan und Polen haben sich im November 2024 dem militärischen US-Satellitennetzwerk Wideband Global SATCOM (WGS) angeschlossen. Dadurch kann Polen Kommunikationsdienste nutzen, ohne in naher Zukunft eigene Fähigkeiten in diesem Bereich aufbauen zu müssen.
Schlussfolgerungen für Deutschland und Europa
Europa rüstet auf, und der Weltraum ist ein wichtiger Bestandteil davon. Auch in Deutschland erhält der Weltraum eine neue militärische Bedeutung, wie die Nationale Sicherheitsstrategie von 2023 und der Koalitionsvertrag von 2025 betonen. Sowohl Deutschland als auch Polen müssen bei der Verteidigung Prioritäten setzen; dasselbe gilt in der Dimension Weltraum, denn nur so können sie ihre Fähigkeiten dort effizient aus- bzw. aufbauen und nutzen.
Es liegt im Interesse Deutschlands, Polens Projekte für den Aufbau seiner Weltraumfähigkeiten zu verfolgen, vor allem die Entwicklung der Erdbeobachtungssatelliten, die in Polen gebaut und betrieben werden. Denn diese Vorhaben bieten die Möglichkeit, die bilaterale Kooperation mit der polnischen Raumfahrtindustrie zu suchen, was für beide Seiten lohnenswert sein dürfte. Ein Beispiel aus dem Bereich Aufklärung: Deutschland verfügt nicht über optische Aufklärungssatelliten, wie Polen sie anstrebt, könnte jedoch Radaraufnahmen bereitstellen und im Gegenzug von den künftigen polnischen Fähigkeiten profitieren.
Nicht zuletzt sollte Deutschland seine geplante Weltraumsicherheitsstrategie nutzen, um die eigenen Stärken und Schwächen zu beurteilen, ähnlich wie Polen es in seiner Weltraumstrategie getan hat.
Prioritätensetzung und mehr Fähigkeiten sind jedoch nur ein Aspekt. Es gilt zudem, europaweite Integration zu erreichen. Erweiterte Fähigkeiten und eine erhöhte Vernetzung sind gut, mehr Daten können aber nur Vorteile bringen, wenn sie effizient verarbeitet und zeitnah in Entscheidungsprozesse eingebracht werden. Polen hat sich hierzu bereits vor allem in EU-Strukturen integriert. EU und Nato streben Strukturen an, die Informationen aus Mitgliedstaaten bündeln. Dieser Informationsfluss muss optimiert werden.
Hinzu kommt ein weiteres Element, nämlich Bedrohungen von Satellitensystemen. Besonders hier können neuere Weltraumakteure von den erfahreneren lernen. Ein regelmäßiger Austausch über Bedrohungen, potenzielle Angriffe und die eigenen Anforderungen ist essenziell und sollte schon während des Auf- und Ausbaus der Fähigkeiten stattfinden, damit Satellitensysteme ausreichend geschützt werden können. Dieser Austausch sollte in erster Linie im Rahmen der Nato geschehen, deren Mitglieder für ihre eigenen Systeme verantwortlich sind. Der bestehende Austausch von SSA-Daten unter den Nato-Staaten könnte zu diesem Zweck ausgeweitet werden.
Juliana Süß ist Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der SWP. Robert Sam Wilson ist der Direktor für Strategie und Nationale Sicherheit am Center for Space Policy and Strategy der Aerospace Corporation. Das Aktuell entstand im Rahmen des Projekts STAND (Strategic Threat Analysis and Nuclear (Dis-)Order) und in Kooperation mit dem Center for Space Policy and Strategy der Aerospace Corporation. Eine ausführlichere englische Version des Textes wurde als Country Brief veröffentlicht unter https://csps.aerospace.org/papers/poland-country-brief.
Dieses Werk ist lizenziert unter CC BY 4.0
Das Aktuell gibt die Auffassung des Autors und der Autorin wieder.
SWP-Aktuells werden intern einem Begutachtungsverfahren, einem Faktencheck und einem Lektorat unterzogen. Weitere Informationen zur Qualitätssicherung der SWP finden Sie auf der SWP-Website unter https://www. swp-berlin.org/ueber-uns/ qualitaetssicherung/
SWP
Stiftung Wissenschaft und Politik
Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit
Ludwigkirchplatz 3–4
10719 Berlin
Telefon +49 30 880 07-0
Fax +49 30 880 07-100
www.swp-berlin.org
swp@swp-berlin.org
ISSN (Print) 1611-6364
ISSN (Online) 2747-5018
DOI: 10.18449/2025A40