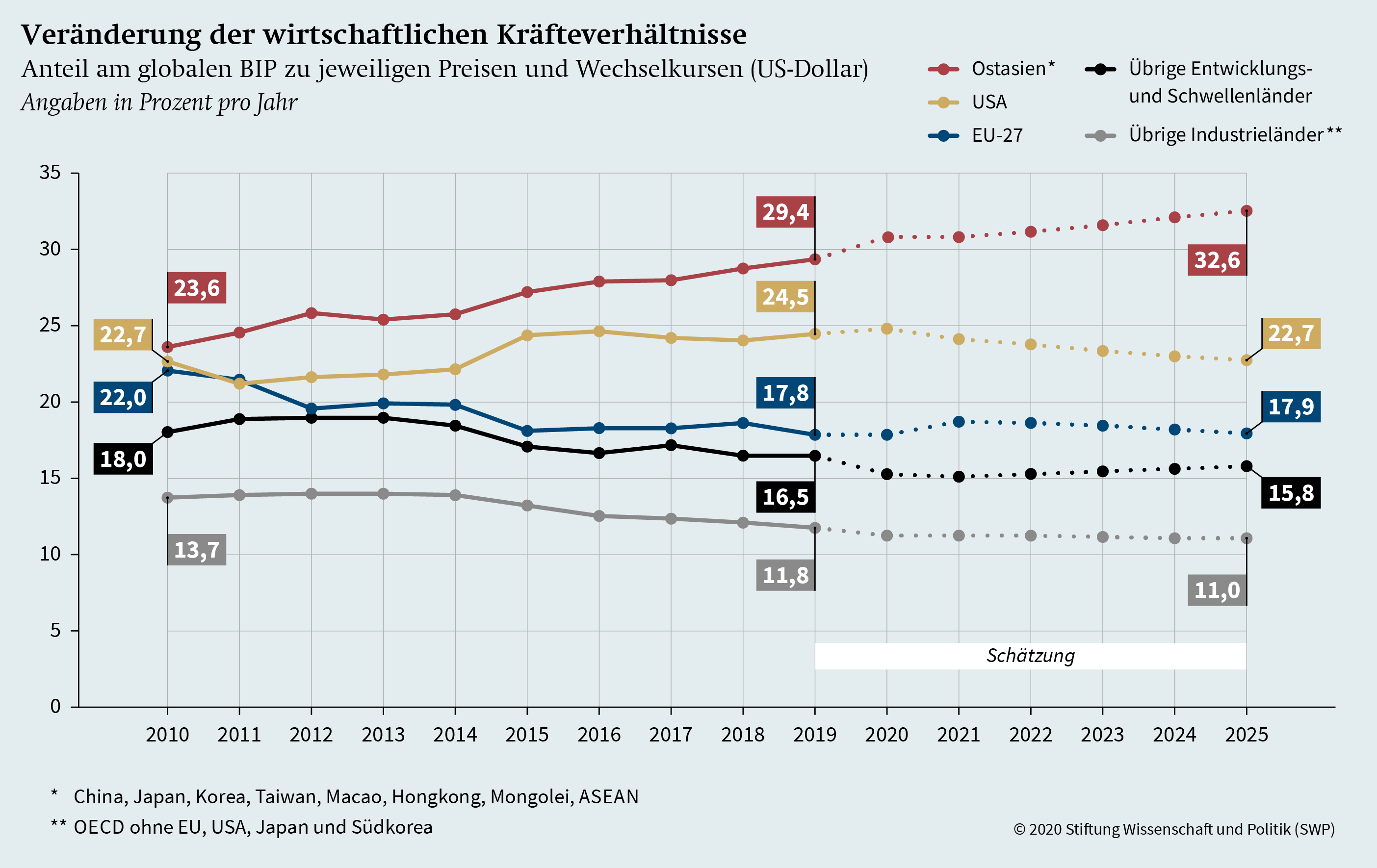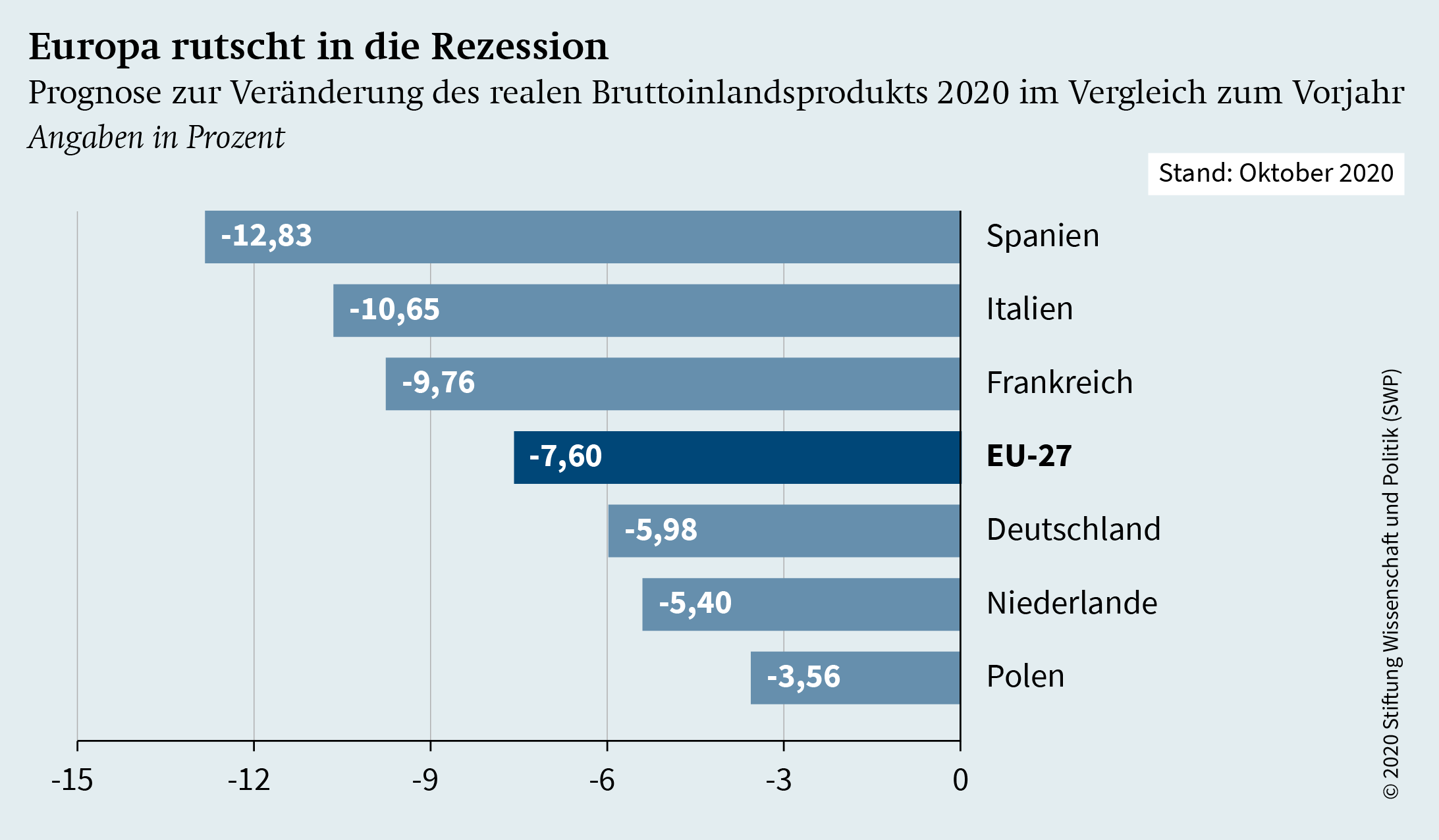-
2020 ist die Covid-19-Pandemie weltweit zu einem maßgeblichen Faktor internationaler Politik geworden. Ihre wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen verstärken bestehende Trends und haben überdies systemverändernde Qualität.
-
Die Dauer der Pandemie und die Fortschritte bei ihrer Bekämpfung sind schwer zu prognostizieren. Darum werden in dieser Studie Szenarien und Handlungsoptionen entworfen, die Entwicklungen der internationalen Ordnung, der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik, der Impfstoffverteilung oder Pfade für migrationspolitische Zusammenarbeit betreffen.
-
So schicksalhaft die Pandemie auch in das Leben und die Politik eingegriffen hat, so unabweisbar ist die Notwendigkeit, die Folgen auf nationaler, europäischer und globaler Ebene politisch zu gestalten. Hier bietet der anstehende Wechsel im Weißen Haus eine Gelegenheit für effektive internationale Kooperation und abgestimmtes multilaterales Vorgehen.
-
Noch hat die Pandemie der EU keinen effektiven Anstoß für größere Handlungsfähigkeit in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gegeben, wohl aber einen wichtigen politischen Impuls für den EU Next Generation Fund und dessen Programmierung auf die Großprojekte Green Deal und Digitalisierung.
-
Die Weltwirtschaft ist in die tiefste Rezession seit den 1930er Jahren gestürzt, die Abstände zwischen armen und reichen Staaten dürften größer werden. Die Pandemie verstärkt Tendenzen zu Regionalisierung und Relokalisierung von Liefer- und Wertschöpfungsketten. Konzepte für die Stärkung der Resilienz kritischer Wirtschaftssektoren erhalten mehr Aufmerksamkeit, bergen aber die Gefahr von wachsendem Protektionismus.
-
Die Pandemie hat nicht zu einem Lockdown der Gewalt in Krisenzonen geführt. Während das Engagement für ziviles und militärisches Krisenmanagement nachließ, setzten Groß- und Regionalmächte ihre Rivalitäten um Status, Einfluss und Hegemonie fort.
-
Deutschland und Europa stehen 2021 vor vielerlei Herausforderungen: Sie müssen einen Durchbruch bei der globalen Eindämmung der Pandemie erzielen, die Wirtschaft im EU-Raum wieder ankurbeln, den Großprojekten Green Deal und Digitalisierung Zugkraft verleihen, die multilaterale Kooperation revitalisieren, den Weg zur strategischen Autonomie Europas fortsetzen, dies mit einem Neustart der transatlantischen Beziehungen verbinden und fragile Länder des Südens stabilisieren. Zielkonflikte sind dabei unvermeidlich.
Inhaltsverzeichnis
1 Die Pandemie und die internationale Politik: Eine einleitende Übersicht
1.1 Internationale Ordnung und globale Dynamiken
2 Varianten der kommenden Ordnung: Drei Szenarien
2.1 Szenario 1: Die Stunde Europas
2.1.1 Narrative Entfaltung: Im Lauf der Zeit
2.2 Szenario 2: Von der Staaten- zur Gesellschaftswelt
2.2.1 Narrative Entfaltung: Eine neue Hoffnung
2.3 Szenario 3: Zersplitterung der internationalen Ordnung
2.3.1 Narrative Entfaltung: Jeder kämpft für sich allein
2.4 Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen
3 Covid-19 und die Weltwirtschaft: Herausforderungen für Deutschland und Europa
3.1 Neue Kräfteverhältnisse, struktureller Wandel, soziale Folgen
3.2 Finanzmärkte: Volatilität, Stabilisierungsversuche, Schuldenkrise
3.3 Internationaler Handel: Neue Trends oder alte Reflexe?
3.4 Schlussfolgerung: Komplexe Resilienz für die Wirtschafts-, Handels- und Finanzpolitik
4 Kein Aufwind für populistisches Regieren in Corona-Zeiten
4.2 Reaktionen populistischer Regierungen
5.1 Zunehmende staatliche Fragilität
5.2 Die Pandemie als potentieller Treiber von Rivalitäten zwischen Groß- und Regionalmächten
5.3 Geschwächte Institutionen und knappere Ressourcen
6 Die Schwellenländer und die Corona‑Pandemie
6.2 Folgen für Devisenreserven und Staatsverschuldung
6.4 Trends und Implikationen für die deutsche und die europäische Politik
7 Größere Fragilität in Afrika: Gefragt sind Ansätze auf allen Ebenen
7.1 Pandemiefolgen: Besonders heikel für Transitionsländer und fragile Demokratien
7.2 Kritische Infrastruktur: Vom Kollaps bis hin zu neuen Chancen
7.3 Die Rolle externer Akteure und afrikanisches Engagement
7.4 Afrikanische Lösungen für Afrika
7.4.1 Gesundheitsgerechtigkeit
7.4.2 Schuldenmanagement und Abfederung sozioökonomischer Krisen
7.4.3 Verzahnung kritischer Infrastrukturen
7.4.4 Fragile Demokratien und Transitionsgesellschaften besonders unterstützen
8 Die Auswirkungen der Covid‑19-Pandemie auf das internationale Wanderungsgeschehen
8.1 Aktuelle und künftige Wanderungstrends
8.2 Mögliche Pfade für die migrationspolitische Zusammenarbeit
9 An der Kreuzung: Die Verteilung eines Covid-19-Impfstoffes
9.1 Szenario 1: Globales Handeln in alten Mustern
9.2 Szenario 2: Gerechter Zugang
10 Klar zur Wende? Internationale Klima- und Nachhaltigkeitspolitik gestalten
10.1 Zwei Szenarien: Die Welt im Jahr 2030
10.2 Hebel für eine nachhaltige Wirtschaftsordnung ansetzen
10.4 Klimadiplomatie hochfahren
10.5 Pandiemieerfahrungen nutzen – Wendemanöver bewerben
11 Versorgungssicherheit: Marktdynamiken und Machtverschiebungen einplanen
11.1 Covid-19: Geographische Verschiebungen in Lieferketten
11.2 Covid-19 als Chance für mittelfristige Veränderungen von Lieferketten
11.3 Sektor- und rohstoffbezogene Chancen identifizieren
11.4 Neue Konzepte von Versorgungssicherheit
12 Die Pandemie und die EU: Integrationsimpuls mit ungewisser Wirkung
12.2 Die Handlungsfähigkeit der EU umfassend stärken
13 Europäische Außen- und Sicherheitspolitik in der Pandemie
13.1 Multilateralismus erodiert – EU hält dagegen
13.2 Vielstimmigkeit in internationalen Krisen und Konflikten besteht fort
13.3 Finanzierung des auswärtigen Handelns verbleibt auf niedrigem Niveau
13.5 Zusammenführen, was zusammengehört
14.1 Erste Schritte zur Reform strategisch wichtiger Infrastrukturen und Industrien
14.2 Koordinierung und Kohärenz für Versorgungssicherheit in der Rohstoff- und Handelspolitik
14.3 Gesamtstrategie für vorausschauende Resilienz
15 Ein krisenfester »Green Deal«
15.1 Ökonomische und technologische Herausforderungen
15.2 Politische und regulatorische Herausforderungen
16.1 Krisenmanagement und humanitäre Auswirkungen der Pandemie
16.2 Pandemiebewältigung im Konflikt
16.3 Indirekte Auswirkungen der Pandemie
16.4 Unsicherheitskomplex im Nahen/Mittleren Osten und in Nordafrika
16.5 Herausforderungen und Handlungsoptionen für deutsche und europäische Politik
17 Covid-19 und das Krisenmanagement Deutschlands
17.1 Krisen und Krisenmanagement
17.2 Nur geringe Wirkung von Covid-19
17.3 Geringere Handlungsspielräume
17.4 Krisenmanagement – von außen nach innen
18.1 Corona-Folgen und Transformationsagenda der EU
18.2 Neustart mit den USA und transatlantische Agenda 2021
18.3 Strategische Autonomie Europas, Konflikte und Krisenlandschaften
Volker Perthes
Die Pandemie und die internationale Politik: Eine einleitende Übersicht
Die Covid-19-Pandemie ist die dritte weltweit spürbare Erschütterung des noch jungen 21. Jahrhunderts. Im Unterschied zu den Terroranschlägen vom September 2001 und zur Banken- und Finanzkrise von 2007/2008 ist ihre Reichweite tatsächlich global, denn sie betrifft Menschen in fast ausnahmslos allen Ländern der Welt direkt,1 wenngleich in unterschiedlichem Maße. Für definitive Aussagen, wie sich Covid-19 auf die internationale Politik auswirkt, ist es zwar noch zu früh. Doch mit hoher Sicherheit lässt sich annehmen, dass die Pandemie und ihre Folgen die internationalen Verhältnisse, das Niveau der Zusammenarbeit und die innere Entwicklung sehr vieler Länder bis auf Weiteres auch dann noch prägen werden, wenn wirksame Impfstoffe entwickelt sind und die Seuche unter Kontrolle gebracht sein wird.
Seit Beginn der Pandemie wird diskutiert, ob sie nun ein historischer Gamechanger sei oder den Gang der Geschichte doch eher bloß beschleunige.2 Tatsächlich zeigen die Beiträge dieser Studie, dass einige internationale Trends, die schon vor Ausbruch der Seuche erkennbar waren, in deren Verlauf an Fahrt gewonnen haben. Aber es gibt, wie sich im Ganzen zeigt, eben auch Trendbrüche. Interessanter und politisch relevanter scheint deshalb die Frage, wo eine Beschleunigung vorhandener Entwicklungen nicht einfach ein Mehr vom Gleichen in kürzerer Zeit bedeutet, sondern in qualitativen Wandel umschlägt oder umschlagen könnte. So besteht zweifellos die Gefahr, dass wachsende Ungleichheit nicht einfach mehr soziale Verwerfungen hervorbringt, sondern zu bewaffneten Konflikten führt, die ganze Regionen destabilisieren. Umgekehrt lässt sich nicht ausschließen, dass es eine Vorbildwirkung entfaltet, sollte bei der Impfstoffverteilung eine erfolgreiche internationale Zusammenarbeit gelingen. Ein solcher Beispielfall könnte dazu beitragen, multilaterale Handlungsblockaden zumindest in einzelnen anderen Politikfeldern auszuräumen.
Ein vergleichender Blick auf unterschiedliche Handlungsbereiche und Weltregionen macht deutlich, dass Covid-19 zwar durchweg ein Faktor geworden ist, die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Krise aber nie gleichförmig sind, sondern immer kontingent. Neben strukturellen Bedingungen wirtschaftlicher, geographischer oder demographischer Art, der Verfügbarkeit materieller Ressourcen sowie technischen und institutionellen Kapazitäten spielen Governancefragen eine große Rolle – also wie auf nationaler oder internationaler Ebene regiert wird. Das heißt auch, dass die langfristigen Folgen des Naturphänomens Pandemie von politischer Gestaltung abhängig bleiben. Absehbar ist, dass Staaten, die relativ gut durch die Krise kommen, sich höheren Erwartungen der internationalen Gemeinschaft werden stellen müssen – oder positiv ausgedrückt: als Kooperationspartner gefragt sein werden. Für Deutschland hat sich dies bislang bestätigt. Schon deshalb fragen wir in den meisten Beiträgen auch, was genau Deutschland und die Europäische Union aus wohlverstandenem Eigeninteresse beitragen können und müssen, um nicht nur die Pandemie einzudämmen, sondern auch um andere Staaten und Gesellschaften beim Umgang mit den Folgen zu unterstützen, internationale Zusammenarbeit zu stärken und die Welt als Ganze resilienter zu machen. Geopolitische Dynamiken spielen eine Rolle dabei, Covid‑19 zu bewältigen, stehen aber meist wie ein ceterum censeo hinter den eigentlichen Herausforderungen, vor die die Seuche die internationale Gemeinschaft stellt. So haben sowohl die Regierung Donald Trumps in den USA wie die chinesische Partei- und Staatsführung die Pandemie innenpolitisch und im Rahmen ihrer strategischen Rivalität instrumentalisiert. Auch für das Bemühen um europäische Selbstbehauptung – um ein Mehr an europäischer Souveränität oder Autonomie – hat die Krise weitere Gründe geliefert, zumindest mit Blick darauf, wie sicher und verlässlich Lieferketten sind. In der Zusammenschau unterstreichen die Beiträge dieser Studie aber vor allem, dass Nachhaltigkeitsthemen zentral sind bei den Gestaltungsaufgaben, die sich als Antwort auf die Pandemie für nationale, europäische und internationale Politik ergeben. Nicht weniger wichtig, vielmehr erweitert werden dadurch Fragen nach der Handlungsfähigkeit Deutschlands und Europas angesichts fortbestehender Großmachtkonkurrenzen, angeschlagener internationaler Ordnungsstrukturen und gewaltsamer Konflikte im geographischen Umfeld.
Internationale Ordnung und globale Dynamiken
Es gibt gute Gründe, anzunehmen, dass der Wahlsieg Joe Bidens und die Art und Weise, wie andere Akteure weltweit damit umgehen, die internationale Ordnung in den kommenden Jahren stärker beeinflussen werden als die Pandemie. Wirkungen auf diese Ordnung entfaltet die Seuche gleichwohl. Szenarien können helfen, unsere Gedanken zu ordnen und Chancen genauso wie unerwünschte Verläufe durchzuspielen. Dabei werden Fragen identifizierbar, wie sie sich gerade auch hinsichtlich der Handlungsoptionen auf jenen Politikfeldern stellen, die in dieser Studie analysiert werden. Bei den drei Szenarien, die Lars Brozus und Hanns Maull in ihrem Beitrag entwickeln, sticht die Bedeutung der Handlungsfähigkeit der EU hervor, wozu gerade beim Umgang mit globalen Risiken auch die Fähigkeit gehört, transnational mit nichtstaatlichen Akteuren zusammenzuarbeiten.
Die Globalität der Pandemie zeigt sich zuvorderst in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen. Sie hat die tiefste Rezession seit den 1930er Jahren ausgelöst, hinterlässt aber in einzelnen Weltregionen unterschiedlich tiefe Spuren. China und Ostasien dürften, wie Hanns Günther Hilpert, Bettina Rudloff und Paweł Tokarski ausführen, weiter an relativem Gewicht in der Weltwirtschaft gewinnen. Mit den ökonomischen Folgen der Pandemie gehen oft heikle Abwägungen einher. So unterstreicht Covid‑19 zwar, wie bedeutend nachhaltiges Wirtschaften ist, doch gleichzeitig werden die Bedingungen schwieriger, unter denen eine Agenda nachhaltigen Wachstums umzusetzen ist. Und sosehr von der EU verlangt werden wird, europäische Verwundbarkeiten bei der Versorgung mit kritischen Gütern zu mindern, sollte sie sich für mehr internationale Zusammenarbeit und Koordination einsetzen – entgegen den protektionistischen Tendenzen, die sich im Zuge der Pandemie weltweit verstärkt haben. Nicht zuletzt gilt es, verlässliche multilaterale Handelsregeln zu bewahren.
Auch politisch zeigt sich, dass Trends nicht immer eindeutig zu bestimmen sind. So hat die Pandemie, wie Kai-Olaf Lang und Claudia Zilla erklären, populistischen, polarisierenden oder autoritären Regierungen keineswegs immer dabei geholfen, ihre Macht zu festigen oder auszuweiten. Wohl aber, und das ist eine Lektion, die auch in Deutschland ernst zu nehmen ist, gedeiht polarisierende Politik in Zeiten der Krise fast überall. Inwieweit die Pandemie und ihre Handhabung durch die Trump-Regierung dazu beigetragen haben, dass der US-Präsident abgewählt wurde, ist noch zu erforschen. Fest steht heute nur, dass Demoskopen den Corona-Effekt auf das Wahlergebnis überschätzt haben.
Direkte kausale Zusammenhänge zwischen der Pandemie und gewalttätigen Konflikten lassen sich ebenfalls nicht nachweisen; indirekte Wirkungen sind aber offensichtlich. Schon zuvor fragile Staaten können sich noch weniger um die Grundbedürfnisse ihrer Bevölkerung kümmern und überlassen zum Teil nichtstaatlichen Gewaltakteuren den Raum; konkurrierende Regional- oder Großmächte instrumentalisieren die Pandemie; international und auch in Europa sind weniger Ressourcen verfügbar, um Konflikte zu bearbeiten. Claudia Major, Marco Overhaus, Johannes Thimm und Judith Vorrath empfehlen deshalb für eine deutsche und europäische Politik der Krisenprävention, die Priorität auf jene fragilen Staaten zu richten, in denen sich die innere politische Lage durch Covid-19 zu verschärfen droht.
Wirtschaftlich sind die Schwellenländer in besonderem Maße betroffen. Die Krise beschleunigt zugleich den Trend unter ihnen, sich auseinanderzudifferenzieren. Diese Entwicklung wird wahrscheinlich anhalten, schreiben Janis Kluge, Günther Maihold, Stephan Roll und Christian Wagner. Was dabei zählt, ist zum einen der jeweilige Platz auf der Landkarte globaler Wertschöpfungsketten; zum anderen sind es aber vor allem die innenpolitischen Verhältnisse und institutionellen Voraussetzungen einzelner Länder. Europa sollte gerade den ärmeren Schwellenländern Unterstützung anbieten – bei der Lieferung von Impfstoffen wie beim Schuldenerlass. Dies ermöglicht dann auch, auf eine klimaschonende Wirtschaftspolitik oder die Einhaltung von Menschenrechten zu drängen.
Die Staaten Afrikas, die hier besonders in den Blick geraten, haben sehr unterschiedlich auf die Pandemie reagiert. Wie aus dem Beitrag von Susan Bergner, Melanie Müller, Annette Weber und Isabelle Werenfels hervorgeht, hat Covid-19 vor allem da zur Destabilisierung beigetragen, wo innere Konflikte den gesellschaftlichen Zusammenhalt ohnehin gefährden. Je weniger es Staaten und Regierungen vermochten, die Bevölkerung zu versorgen und zu schützen, desto größer wurde das Risiko, dass extremistische und bewaffnete Gruppen erstarken. Bei grundsätzlichem Vertrauen in die politische Führung blieben dagegen auch solche Staaten stabil, die institutionell oder infrastrukturell eher schwach sind. Einige afrikanische Staaten konnten ihre Kapazitäten zur Krisenbewältigung sogar ausbauen, indem zivilgesellschaftliche Akteure aktiv einbezogen wurden, und Regionalorganisationen haben wirksam dazu beigetragen, Erfahrungen mit früheren Seuchen nutzbar zu machen.
Krisen und Konflikte in Afrika spielen für das globale Migrations- und Fluchtgeschehen eine erhebliche Rolle. Steffen Angenendt, Nadine Biehler, Raphael Bossong und Anne Koch weisen darauf hin, dass Covid-19 zwar die Triebkräfte von Flucht und Migration nicht verändert hat, »wohl aber die politischen und administrativen Rahmenbedingungen«. Weltweit ist die Mobilität stärker eingeschränkt, und davon sind Migranten und Flüchtlinge besonders betroffen, ebenso Länder, die auf regelmäßige Rücküberweisungen von Arbeitsmigranten angewiesen sind. Auch mit Blick auf den eigenen europäischen Bedarf an Fachkräften – nicht zuletzt im Gesundheitssektor – gewinnt eine »vorausschauende Migrationspolitik in Partnerschaft mit den Herkunftsländern« deshalb noch an Bedeutung.
Ob die Pandemie und ihre Folgen sich wirksam unter Kontrolle bringen lassen, hängt wesentlich davon ab, ob die EU, deren Mitgliedstaaten, die USA und auch China bereit sind, beim Aufbau resilienter Gesundheitssysteme und bei der Impfstoffverteilung global und partnerschaftlich zu kooperieren. Maßgeblich ist auch, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) durch gezielte Reformen gestärkt wird. Angesichts dieser Herausforderungen sind, wie Maike Voss zeigt, durchaus unterschiedliche Szenarien denkbar. Letztlich entscheidet sich in den Industriestaaten, ob Covid-Impfstoffe als globales öffentliches Gut behandelt und entsprechend verteilt werden – oder ob trotz ausreichend vorhandener Vakzine der Großteil der Bevölkerung etwa in Afrika ungeimpft bleibt. Deutschland kann mit seinen europäischen Partnern den Weg zu einer fairen Verteilung ebnen und sollte im Übrigen, so die Autorin, der Stärkung der WHO Priorität einräumen.
In der Klimapolitik lässt sich davon ausgehen, dass Bidens Wahlsieg die Chancen für ein kooperatives Szenario erhöht hat. Doch wird sich dieses nicht von selbst durchsetzen. Deutschland und seine europäischen Partner sind daher, so Marianne Beisheim und Susanne Dröge, in zweierlei Hinsicht gefragt. Zum einen sollten die Mittel aus nationalen Corona-Hilfspaketen und aus dem EU-Wiederaufbaufonds konsequent mit Klima- und Nachhaltigkeitszielen verknüpft werden. Zum anderen ist international um willige Partner für »gemeinsame Wendemanöver in der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik« zu werben, gegebenenfalls durch Angebote technischer Kooperation und privilegierter Marktzugänge.
Die Pandemie hat in vielen Ländern das Thema Versorgungssicherheit auf die politische Tagesordnung gebracht. Waren Bemühungen, internationale Lieferketten zu verlagern oder zu verkürzen, vormals eher geopolitisch motiviert, so gibt es dafür nun weitere Gründe. Dabei wird in den Industriestaaten oft übersehen, dass viele andere Länder kaum in der Lage sind, handelspolitische Abhängigkeiten auf diesem Wege zu reduzieren. Melanie Müller schlägt deshalb vor, mit Partnerländern einen handlungsorientierten Dialog über die Resilienz von Lieferketten zu führen. Ziel wäre nicht zuletzt, dass Produktionsbedingungen weltweit nachhaltiger gestaltet werden.
Europa und sein Umfeld
Die Pandemie hat die einzelnen EU-Mitglieder unterschiedlich stark getroffen, gleichzeitig aber für die Union als Ganzes wie ein »Reformkatalysator« gewirkt, so Peter Becker, Kai-Olaf Lang, Barbara Lippert und Paweł Tokarski. Mit dem gemeinsam schuldenfinanzierten Wiederaufbauprogramm hat die EU einen Integrationsschub erfahren, und sie war in der Lage, die wirtschafts- und klimapolitischen Weichenstellungen des Mehrjahreshaushalts und des Wiederaufbauprogramms sozialpolitisch zu flankieren. Aber nicht in allen Politikbereichen gibt es Bewegung; so stehen Schritte hin zu einer gemeinschaftlichen europäischen Gesundheitspolitik noch aus. Und ob die integrationspolitische Wirkung der Hilfsprogramme nachhaltig sein wird, ist offen. Trotz der gemeinsamen Kraftanstrengung besteht das Risiko, dass wirtschaftliche Ungleichgewichte in der EU sich durch Pandemie und Rezession weiter verschärfen. Bemühungen um mehr Integration auch auf Feldern wie der Innen- und Justizpolitik oder der Währungspolitik werden absehbar für Kontroversen sorgen. Deutschland sollte sich deshalb, so die Autoren, mit einer Gruppe gleichgesinnter Staaten darum bemühen, Kernelemente eines ausgewogenen Reformpakets zu entwickeln, das Handlungsfähigkeit und Legitimität der Union zu stärken verspricht.
Auf die Außen- und Sicherheitspolitik ist der erwähnte Integrationsschub bislang nur teilweise übergesprungen. Bei der Pandemiebekämpfung hat die EU effektiv dazu beigetragen, multilaterales Handeln zu wahren und zu fördern. Der Europäische Auswärtige Dienst geht gegen Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit der Pandemie vor, und der Ansatz für die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik wurde im Haushaltsrahmen 2021–27 deutlich erhöht. Nicht weitergekommen ist die EU dagegen, wie Annegret Bendiek und Ronja Kempin erklären, beim gemeinsamen Handeln in geopolitischen Krisen und Konflikten. Geplant ist eine gemeinsame Bedrohungsanalyse der EU; sie mag helfen, zumindest die strategischen Prioritäten miteinander abzustimmen. Größere Wirkung, so die Autorinnen, wird das auswärtige Handeln der Union aber vor allem dadurch erhalten, dass außen- und sicherheitspolitische Instrumente mit solchen der Handels- und Investitionspolitik verzahnt werden.
Das Bemühen um Resilienz gegenüber externen Schocks steht schon seit einiger Zeit im Zentrum europäischer Sicherheitspolitik. Mit der Pandemie ist ins allgemeine Bewusstsein gerückt, wie sehr Gesellschaften abhängig sind von sicheren Kommunikationsnetzwerken und Dateninfrastrukturen, aber auch von der zeitnahen Versorgung mit »kritischen« Low-tech-Produkten wie etwa Schutzmasken. Verbesserungen im Sinne einer vorausschauenden Resilienz können, wie Raphael Bossong und Bettina Rudloff ausführen, die Abwehrkräfte gegen transnationale Risiken – zum Beispiel einer weiteren Pandemie – stärken und gleichzeitig zur strategischen Autonomie oder Souveränität Europas beitragen. Dies gilt etwa gegenüber anhaltenden Versuchen Dritter, die innere Ordnung der Union oder einzelner Mitgliedstaaten zu unterminieren.
Die Pandemie hat zudem deutlich werden lassen, wie wichtig eine Umorientierung auf nachhaltiges Wirtschaften ist. Innerhalb der EU hat dies dazu beigetragen, dem Wiederaufbauprogramm eine grüne Note zu geben und den European Green Deal krisenfester zu machen, schreiben Oliver Geden und Kirsten Westphal. Auch wenn die Herausforderung bestehen bleibt, mittelfristige Ziele wie die Klimaneutralität tatsächlich umzusetzen, sind zumindest die Ziele an sich kein umstrittenes Thema mehr. Innereuropäisch werden jedoch Verteilungskämpfe um Emissionsberechtigungen auszustehen sein. International sind Differenzen nicht zuletzt mit Schwellenländern zu erwarten, wenn die EU sich für einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus entscheidet. Umso wichtiger ist es, so die Autoren, Partnerländer auf dem Weg »in die neue Energiewelt mitzunehmen«. Wenn bisherige Öl- und Gaslieferanten etwa als Produzenten klimafreundlichen Wasserstoffs ins Spiel kommen, könnte dies sogar dabei helfen, Europas geographische Umgebung zu stabilisieren.
In der südlichen Nachbarschaft, im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordafrika, hat die Pandemie vorhandene Krisen und Konflikte lediglich um eine weitere Kalamität erweitert. Wo sich die Dynamiken einzelner Konflikte verändert haben, liegt das eher an geopolitischen Verschiebungen, wie Muriel Asseburg, Wolfram Lacher und Guido Steinberg erklären. Russland und die Türkei haben im Mittelmeerraum an Einfluss gewonnen – nicht wegen der Pandemie, sondern weil sie zu riskanten Interventionen bereit waren. Europa hat im Ganzen an Einfluss in der Region verloren, trotz aktiver Bemühungen gerade Deutschlands, den Konflikt in Libyen beizulegen.
Tatsächlich hat Covid-19 die Krisen und Konflikte, an deren Bearbeitung sich Deutschland beteiligt, nirgendwo weniger virulent gemacht. Corona hat allerdings, schreibt Markus Kaim, die internationale Krisenagenda und auch jene der EU überlagert. Da in Zukunft nicht weniger Herausforderungen im Umfeld Europas zu erwarten sind, werden Deutschland und seine Partner in der EU das Instrumentarium erweitern müssen, mit dem sich Krisen angehen lassen. So werden neben den entsprechenden politischen und militärischen Fähigkeiten künftig wohl auch gesundheitspolitische Instrumente zum Regelinventar deutscher wie europäischer Außen- und Sicherheitspolitik gehören.
Internationale Ordnung und globale Dynamiken
Die Frage nach der Gestalt der internationalen Ordnung »post Corona« lässt sich gegenwärtig nicht eindeutig beantworten. Daher sollte in Szenarien gedacht werden. Wir skizzieren drei alternative Entwicklungsmöglichkeiten für die kurz- bis mittelfristige Zukunft (2021–2025), die jeweils in einem konzeptionellen und einem narrativen Teil beschrieben werden. Zu den wichtigsten Einflussfaktoren, die in unterschiedlicher Ausprägung auftreten, zählen die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, die Entwicklungen in den USA, in China und der EU sowie die Handlungsfähigkeit und Kooperationsbereitschaft politischer Akteure. Geordnet sind die Szenarien nach dem Umfang der Spielräume, die deutschen Entscheidungsträgern offenstehen. Während im ersten Szenario die Handlungsmöglichkeiten relativ groß sind, nehmen sie danach sukzessive ab.
Szenario 1: Die Stunde Europas
Die Pandemie verändert die Machtbeziehungen auf internationaler Ebene spürbar. Die USA und China verstricken sich in ihrem geopolitischen und ideologischen Antagonismus, verursachen dabei Kollateralschäden und verlieren an Ansehen und Einfluss. Zugute kommt dies der Europäischen Union. Dabei spielt Berlin eine zentrale Rolle: Es investiert in die europäische Zusammenarbeit und nutzt die Handlungsspielräume, die sich durch die wachsenden Vorbehalte gegenüber China und den USA ergeben. Die EU überwindet den Reformstau und führt Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik ein, um ihre politischen Anliegen auf internationaler Ebene energischer zu vertreten. 2025 gelten die Erfolge des erneuerten »Modells Europa« als Beispiel für die Verbindung von wirtschaftlicher Prosperität, einem Regieren, das an Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, und liberal-demokratischer Stabilität.
Die treibende Kraft in diesem Szenario ist die Staatskapazität – verstanden als die Fähigkeit politischer Ordnungen, auf die Herausforderungen der dreidimensionalen Krise (Gesundheit,1 Wirtschaft, Politik) effektiv zu reagieren und notwendige Anpassungen voranzutreiben. Der EU gelingt es, gemeinsam mit gleichgesinnten Staaten und internationalen Organisationen die zukunftsfähigen Elemente der internationalen Ordnung zu stabilisieren und neue Regelwerke zu erarbeiten. Kollektiv können die spezifischen Fähigkeitsdefizite kompensiert und bestehende Stärken zu einem handlungsfähigen Multilateralismus kombiniert werden. Dabei werden gesellschaftliche Akteure in Governance-Arrangements eingebunden, die aber weiterhin staatlich dominiert bleiben.
Narrative Entfaltung: Im Lauf der Zeit
Unter Präsident Biden gelingt den USA die Rückkehr zu einer multilateralen Außenpolitik nur in Ansätzen. Das innenpolitische Klima bleibt angespannt und wird von Ex-Präsident Trumps neuem Medienimperium weiter vergiftet. 2022 erobert die Republikanische Partei die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Die innere Zerrissenheit der USA beeinträchtigt die Handlungsfähigkeit Washingtons. China und Russland stoßen in das Führungsvakuum, wobei sich die latenten Gegensätze zwischen ihnen vergrößern. Spannungen verursachen insbesondere die chinesischen Wirtschaftsaktivitäten in den Grenzregionen und die wachsende Präsenz chinesischer Arbeiter und Kleinunternehmer im Fernen Osten. Die Rivalitäten zwischen den USA, China, Russland und zunehmend auch Indien tragen dazu bei, dass auf regionaler Ebene Konflikte aufbrechen. 2021 erhöht China den Druck auf Taiwan und erreicht eine faktische Unterwerfung, die Washington hinnimmt.
Die sichtbare Schwäche der USA führt in Verbindung mit fortgesetzten russischen Provokationen dazu, dass sich die EU auf grundlegende Reformen einigt. Unter französischer Ratspräsidentschaft gelingen 2022 weitreichende Schritte: Außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen werden nunmehr per Mehrheitsbeschluss getroffen, die Fiskal- und Wirtschaftsunion wird ausgebaut. Washington sieht diese Entlastung positiv. Eine erste Bewährungsprobe besteht die reformierte EU-Architektur, als sich das Migrations- und Fluchtgeschehen im Mittelmeer erneut zuspitzt. Immer mehr Menschen versuchen, aus Nordafrika nach Europa zu gelangen. Getrieben werden sie durch die Folgen der Pandemie und den Klimawandel. In einer großen Kraftanstrengung gelingt es der EU, die Lage mittels eines militärisch und polizeilich flankierten humanitären Einsatzes zu stabilisieren. Um den Kristallisationskern EU entsteht eine lose Koalition globaler Mittelmächte, an der sich Staaten wie Australien, Großbritannien, Japan, Kanada und Südkorea beteiligen. Sie halten nach neuen Partnern Ausschau, da die USA ihre traditionelle Rolle als ordnungspolitischer Partner immer weniger wahrnehmen. Erfolgreiche Projekte wie die Initiative zur Verbindung des Green Deal mit gesundheitspolitischen Aspekten unter dem Schlagwort »One Health« festigen die Kooperation ebenso wie die flächendeckende Verbreitung eines effektiven Covid-19-Impfstoffs. Am 1. Februar 2025 begründen die 27 Staats- und Regierungschefs mit 17 weiteren Ländern des Nordens und des Südens die »Demokratische Allianz für globalen Fortschritt«, die sich dazu verpflichtet, ernst zu machen mit »Building Back Better«.
Szenario 2: Von der Staaten- zur Gesellschaftswelt
Der Schock der Corona-Krise führt zu einer tiefgreifenden Transformation der globalen Ordnung. Nichtstaatliche Akteure beginnen, Verantwortung für eine transnational verstandene politische Gemeinschaft zu übernehmen. Maßgeblicher Treiber ist der Unmut über die Unfähigkeit der Regierungen, die Bewältigung der planetarischen Herausforderungen anzupacken. Die Pandemie ist nur das aktuellste Beispiel, Klimawandel, sozioökonomische Ungleichheit und die Verbreitung von Nuklearwaffen folgen dichtauf. In der Weltöffentlichkeit wächst das Bewusstsein dafür, dass die wechselseitigen Abhängigkeiten in einer Vielzahl von Politikfeldern eine kollektive Herausforderung darstellen. Es wird nicht mehr toleriert, dass notwendige Problemlösungen fortwährend in die Zukunft verschoben werden, weil es lähmende Positionsdifferenzen zwischen mächtigen Regierungen gibt.
Reformimpulse gehen von substaatlichen Gebietskörperschaften wie Ländern, Regionen und Großstädten aus, die sich mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, Unternehmen und internationalen Organisationen vernetzen. Einige Regierungen, darunter die deutsche, britische, kanadische und mehrere skandinavische, fördern diese Initiativen, auch die Vereinten Nationen (UN) und die Europäische Union (EU) signalisieren ihre Unterstützung. Die kosmopolitische Stoßrichtung der Reformbemühungen löst zwar Widerstände bei politischen Kräften aus, die sich primär über religiöse oder ethnische Gruppenidentitäten definieren. Aber einer breiten Allianz substaatlicher und transnationaler Akteure gelingt es, mit dem Leitbild einer konsequent globalen Nachhaltigkeitspolitik politischen Gestaltungswillen zu mobilisieren.2 Der gesellschaftliche Rückenwind trägt dazu bei, dass sich mehr und mehr Regierungen kooperationswillig zeigen.
Narrative Entfaltung: Eine neue Hoffnung
Die Pandemie kann 2021/22 eingedämmt werden: Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit auf den Weg gebrachte Kampagne Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator zeigt Wirkung. Die Impfstoffhersteller kooperieren mit globalen Logistikkonzernen wie UPS und DHL und nichtstaatlichen Akteuren wie der Bill & Melinda Gates Stiftung. Organisiert wird die Verteilung von Impfstoffen, Medikamenten und Diagnoseinstrumenten in enger Abstimmung mit der WHO. Der Erfolg der Initiative bestätigt den Ansatz, dass lokal und interregional koordiniertes Handeln mit entsprechender gesellschaftlicher Unterstützung funktioniert; ein so verstandener Multilateralismus erfährt neue Wertschätzung in der Weltöffentlichkeit. 2023 schließen sich Aktivisten und Unternehmer um Greta Thunberg, Melinda Gates, Mark Andreesen und Jeff Bezos zur »Earth Future Alliance« zusammen, um diesen Governance-Ansatz auf weitere globale Herausforderungen zu übertragen. Unterstützt wird die Alliance von etablierten Organisationen der Zivilgesellschaft wie Amnesty International und Greenpeace. Aber auch Philanthropen stellen beträchtliche Teile ihres Privatvermögens für die Entwicklung innovativer »Global Solutions« für die vielen »Global Problems« zur Verfügung. Zunächst geht es der Alliance um die Regulierung technischer Detailfragen, etwa die einheitliche Datenerhebung für effektivere Pandemiebekämpfung. Daran schließt sich aber schon bald die Beschäftigung mit komplexeren Herausforderungen auf globaler Ebene an, darunter die Eindämmung des Klimawandels, die Ausgestaltung eines globalen Migrationsregimes und die Schaffung fairer Wirtschaftsbeziehungen.
US-Präsidentin Kamala Harris setzt noch entschiedener als ihr Vorgänger auf internationale Zusammenarbeit.
Im Windschatten dieser Entwicklungen gelingt es den Demokraten in den USA, ihre Machtposition trotz der Obstruktionspolitik der republikanischen Opposition zu festigen. 2025 wird Kamala Harris Nachfolgerin von Joe Biden. Getrieben von den transnationalen Initiativen, die sich durch einen erfolgsorientierten Pragmatismus auszeichnen, betreibt sie den Kurswechsel der amerikanischen Politik hin zu verstärkter internationaler Zusammenarbeit noch entschiedener. Auch der Nachfolger von Xi Jinping an der Spitze Chinas geht ab 2024 zu einer vorsichtigeren Politik über und nutzt internationale Kooperationsmöglichkeiten, um das Ansehen der Volksrepublik aufzubessern. Die Aussichten für tragfähige und global wirksame Vereinbarungen erscheinen inzwischen so günstig, dass die UN zum Jahresende 2025 zu einem »Summit of Humanity« einlädt, auf dem Regierungen, internationale Organisationen, Unternehmen und Vertretungen verschiedenster zivilgesellschaftlicher Stakeholder gleichberechtigt über einen »New Global Compact« verhandeln.
Szenario 3: Zersplitterung der internationalen Ordnung
Die Pandemie hat nur geringen Einfluss auf die Entwicklungsrichtung der internationalen Beziehungen. Den großen Mächten USA, China, Russland und EU misslingt es weiterhin, sich auf wirksame Regelsetzungen in wichtigen Feldern wie Gesundheit, Klima, Migration3 und Sicherheit4 zu einigen. Die Weltwirtschaft leidet unter den Folgen der Pandemie, die durch eine verbreitete »My country first«-Politik schwerwiegender als erhofft ausfallen: Anhaltende Kapitalabflüsse aus dem Globalen Süden einschließlich der Schwellenländer und die Relokalisierung vieler international integrierter Produktions- und Lieferketten in die Industriestaaten vertiefen sozioökonomische Ungleichheiten und verschärfen Verteilungskonflikte.5
Weltweit nimmt die politische Polarisierung zwischenstaatlich wie auch innerstaatlich zu, was die internationale Handlungsfähigkeit selbst kooperationsbereiter Regierungen lähmt. Die Konnektivitätskrise zieht eine Governance-Krise nach sich, die sich innenpolitisch wie international immer weiter verfestigt. Gewaltkonflikte häufen sich. Auch innerhalb der EU verstärken sich die Zentrifugalkräfte. Die Versuche gesellschaftlicher Akteure, transnationale Ordnungen aufzubauen, werden blockiert. Bis 2025 verdichten sich die Defizite bei der Bewältigung der gesundheits-, wirtschafts- und sozialpolitischen Folgen der Pandemie mit dem innenpolitischen Stillstand in den USA, dem außenpolitischen Vordringen Chinas und der Stagnation der europäischen Politik zu einem düsteren Szenario.
Narrative Entfaltung: Jeder kämpft für sich allein
In den USA gelingt es den Demokraten nur begrenzt, Reformen anzustoßen, um die Auswirkungen der Pandemie zu überwinden. Der Widerstand der Republikaner auf allen Ebenen blockiert Veränderungen und befeuert sporadische Gewaltausbrüche. 2024 setzt sich bei den Präsidentschaftswahlen die Republikanerin Nikki Haley durch. Der Wahlkampf wird durch den »neuen Kalten Krieg« mit China bestimmt, der sich nach militärischen Zwischenfällen im südchinesischen Meer verschärft. Die Niederlage der Demokraten ist auch auf die Folgen des Börsenkrachs 2023 zurückzuführen, der durch Chinas erfolgreiche Einführung einer eigenen Digitalwährung ausgelöst worden war. Haley verspricht, die USA durch eine totale Mobilisierung gegen China wieder zur Nummer eins zu machen. Dabei setzt sie auf eine Zusammenarbeit mit den Tech-Konzernen, die sich in den vergangenen Jahren immer enger mit der Regierung in Washington verbündet haben, um im Wettbewerb mit den chinesischen Kontrahenten bestehen zu können (»China Inc. vs. America Inc.«). Ziel ist es, den verlorengegangenen Vorsprung der USA in der Rüstungstechnologie zurückzugewinnen.
Die europäische Politik bleibt in wichtigen Bereichen zerstritten, beispielsweise in der Asyl- und Migrationspolitik und bei institutionellen Reformen, etwa der Abschaffung der Mehrheitsregel. Die umfangreichen Finanzmittel des Wiederaufbaufonds kommen primär politisch gut vernetzten Akteuren zugute und wirken so strukturkonservierend, beispielhaft im Agrarsektor. Mit dem inneren Zusammenhalt der Union schwindet auch ihr internationales Ansehen; Mitte der 2020er Jahre übt China in etlichen Mitgliedsländern erheblichen Einfluss aus. Durch die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels verschärfen sich gleichzeitig die Notlagen an der Peripherie Europas. Politische Krisensymptome, wirtschaftliche Misere und wiederkehrende Gewaltkonflikte verstärken den Migrationsdruck, der sich trotz aller Eindämmungsversuche der EU immer wieder Bahn bricht.
Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen
Die Szenarien verdeutlichen erstens, wie entscheidend außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit für die EU ist, und zwar im Sinne sowohl einer Begrenzung der Risiken als auch der Nutzung von Chancen. Diese Handlungsfähigkeit ist, zweitens, Voraussetzung für Koalitionsfähigkeit jenseits der EU, zum einen mit Staaten und nichtstaatlichen Akteuren auf der Basis geteilter Werte, zum anderen aber auch mit Partnern, deren Interessen kompatibel sind. Die Szenarien legen zudem nahe, dass unter den gegenwärtigen internationalen Rahmenbedingungen Effektivität wichtiger sein wird als prozedurale Legitimität. Dies impliziert, drittens, den Vorrang der Handlungsfähigkeit vor der Geschlossenheit: Außenpolitisch voranzuschreiten und zögernde Partner nachzuziehen erscheint besser, als alle mitnehmen zu wollen und dabei Zeit zu verlieren. Schließlich verweisen die Szenarien, viertens, auf die Bedeutung nichtstaatlicher Akteure: Gerade im Zusammenwirken mit der transnationalen Zivilgesellschaft verfügt die deutsche Diplomatie über die Möglichkeit, ihren Einfluss auf den Gang der Entwicklung zu erhöhen. Für all dies gilt es, fünftens, die innenpolitischen Voraussetzungen für eine gestaltungsfähige Außenpolitik zu verbessern. Sie braucht die Unterstützung der Gesellschaft ebenso wie geeignete Instrumente und Strategien.
Hanns Günther Hilpert / Bettina Rudloff / Paweł Tokarski
Covid-19 und die Weltwirtschaft: Herausforderungen für Deutschland und Europa
Die von der Pandemie ausgelösten Angebots- und Nachfrageschocks haben die Weltwirtschaft in die tiefste Rezession seit der großen Depression der 1930er Jahre gestürzt. Produktion, Einkommen und Beschäftigung sind auf breiter Front eingebrochen. Alle Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung sind angesichts der anhaltenden Covid-19-Virulenz höchst unsicher. Sehr wahrscheinlich aber dürfte sein, dass die nahe und fernere Zukunft von einem ständigen Abwägen zwischen »Gesundheitsschutz« auf der einen und »wirtschaftlicher Stabilität« sowie der Verfolgung weiterer Ziele wie »Bildung«, »Nahrungssicherheit« und »sozialer Frieden« auf der anderen Seite geprägt sein wird. Und dies in einer Zeit, in der die Ordnung, die Strukturen und Hierarchien der Weltwirtschaft vielfachen Belastungen und Veränderungen ausgesetzt sind. Die Wirtschaftspolitik und insbesondere die Finanzpolitik und die Handelspolitik stehen vor großen Herausforderungen.
Neue Kräfteverhältnisse, struktureller Wandel, soziale Folgen
Je nach Weltregion und Land sind die Spuren, die die Covid-19-Pandemie hinterlässt, unterschiedlich tief und breit. Der vergleichende Blick über den Globus zeigt, dass Ostasien, vor allem Nordostasien, die unmittelbaren Folgen der Gesundheitskrise ökonomisch relativ gut meistert. Praktisch alle übrigen Weltregionen – auch die westlichen Industrieländer, und unter diesen gerade auch die USA – erleiden erheblich größere wirtschaftliche Verluste, teilweise mit zweistelligen prozentualen Rückgängen des Bruttoinlandsprodukts (geschätzt für 2020). In Europa fällt der wirtschaftliche Einbruch in Deutschland und Skandinavien etwas geringer aus als in den Nachbarländern. Geradezu dramatisch ist der ökonomische Kollaps und daraus folgend die humanitäre Situation in einigen Schwellenländern (Brasilien, Mexiko, Indien).
Wenn sich, was durchaus plausibel ist, die gegenwärtigen Trends fortsetzen, dürfte auch künftig die wirtschaftliche und soziale Entwicklung global und regional divergent verlaufen, womit neue Spannungsfelder entstehen. Zu erwarten ist, dass infolge der Pandemie China und Ostasien an relativem ökonomischem Gewicht gewinnen und noch rascher als prognostiziert zum Gravitationszentrum der Weltwirtschaft werden. Politisch könnte daraus eine Kräfteverschiebung erwachsen.
Die pandemiebedingten Angebots- und Nachfrageschocks werden die Strukturen der Wirtschaft nachhaltig verändern. Während sich die Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen, zum Beispiel in den Bereichen Tourismus, Personenverkehr, Messewesen, auf absehbare Zeit kaum erholen dürfte, besteht im Gesundheitssektor ein enormer Versorgungsbedarf. Auf der Angebotsseite hat die Digitalisierung einen nachhaltigen Schub erfahren. Dabei bergen die Automatisierung der Produktion und die Verlagerung der Geschäftsprozesse in den virtuellen Raum Chancen und Risiken. Die Chancen liegen etwa für Deutschland und Europa in den Potentialen für eine Renaissance der Industrieproduktion. Andererseits könnte die Digitalisierung den Trend zu einer Verstärkung der sozialen Ungleichheit weiter beschleunigen, etwa indem Arbeit durch Roboter und Algorithmen ersetzt und Geringqualifizierte abgehängt werden. Ein weiteres Risiko besteht in der Tendenz der Digitalwirtschaft, Unternehmen mit monopolartiger Marktmacht hervorzubringen und den Wettbewerb zu beschränken.
Die Corona-Krise hat die Bedeutung des Klimaschutzes und von Nachhaltigkeit eindrucksvoll unterstrichen. Die von der Pandemie ausgehenden ökonomischen Belastungen erschweren indes die Umsetzung klimapolitischer Maßnahmen – finanziell und politisch-argumentativ. Wichtig sind daher eine höhere Kosteneffizienz und Zielgenauigkeit im Klimaschutz.
Die Pandemie trifft soziale Schichten und fachliche Qualifikationsniveaus unterschiedlich. Die ungleiche Verteilung von Einkommen, Vermögen und Lebenschancen dürfte sich verstärken, soziale und gesellschaftliche Spannungen und Konflikte werden sich voraussichtlich verschärfen.1 Wo sozialpolitisch nicht gegengesteuert wird, werden Gesellschaften weiter auseinanderdriften. Erhöhte öffentliche Ausgaben für Soziales, Arbeit und Gesundheit können zwar einen gewissen Ausgleich leisten und die entstehenden sozialen und politischen Krisen abmildern. Sie werden aber auch den langfristigen Trend zum Anwachsen staatlicher Sozialausgaben weiter festigen.
Finanzmärkte: Volatilität, Stabilisierungsversuche, Schuldenkrise
Die erste Welle der Covid-19-Pandemie löste sehr heftige Reaktionen an den internationalen Aktien-, Anleihe- und Rohstoffmärkten aus. Ende Februar und Anfang März 2020 verzeichneten die wichtigsten US-Börsenindizes höhere Rückgänge als während der globalen Finanzkrise. Ein weiterer starker Indikator für die Unsicherheit der Märkte hinsichtlich einer künftigen wirtschaftlichen Erholung ist das Verharren des Goldpreises in der Nähe seines im Sommer 2020 erreichten Rekordniveaus.
Als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie haben die großen Zentralbanken (Federal Reserve, Europäische Zentralbank, Bank of England, Bank of Japan) das vollständige Arsenal der geldpolitischen Instrumente eingesetzt, um die Realwirtschaft und den Bankensektor zu unterstützen und die Kosten des öffentlichen Schuldendienstes niedrig zu halten. Die Stabilisierungserfolge, die mit dieser expansiven Geldpolitik erreicht wurden, haben die Zentralbanken in ihrem Selbstverständnis bestärkt, sich in erster Linie auf die Aufrechterhaltung der Finanzstabilität und – ausgehend von einer flexibleren Interpretation des Inflationsziels – auf die Unterstützung der Realwirtschaft zu konzentrieren.
Der starke Anstieg der weltweiten Nachfrage nach Dollar zu Beginn der Pandemie hat die Dominanz der US-Währung im internationalen Finanzsystem und der Federal Reserve als Kreditgeber letzter Instanz einmal mehr unter Beweis gestellt. Allerdings haben die starke fiskalische Reaktion der EU und das im Vergleich zu den USA bessere Pandemie-Krisenmanagement Europas den Euro-Wechselkurs gegenüber dem Dollar wieder etwas ansteigen lassen. Das ist ein Signal des Vertrauens, könnte aber auch die wirtschaftliche Erholung verlangsamen. Eine dauerhafte Stärkung der internationalen Rolle des Euro wird jedoch kaum zu erreichen sein, ohne die wirtschaftlichen Grundlagen des Südens der Eurozone zu verbessern und ohne Fortschritte bei der Integration der europäischen Finanzmärkte zu erzielen. Die dominante Stellung der US-Währung im internationalen Finanzsystem dürfte daher Bestand haben, was die USA weiterhin in die Lage versetzen wird, die Verweigerung des Zugangs zum globalen Zahlungssystem als Druckmittel zu nutzen. Auf der anderen Seite ist die EU auf dem Weg, ihre Währungssouveränität und finanzielle Stabilität besser zu schützen, indem sie der erste große Wirtschaftsraum wird, der Krypto-Assets umfassend reguliert.2
In der durch die Pandemie verursachten Wirtschaftskrise hatte die G20 die Chance, ihre Führungsrolle als einziges global koordinierendes Finanzforum wiederherzustellen. Sie scheiterte jedoch an den eher nationalistisch orientierten USA und China sowie an der Steuerungsunfähigkeit Saudi-Arabiens, das als Gastgeber des G20-Gipfels fungierte. Die fiskalpolitischen Reaktionen auf Covid-19 erfolgten daraufhin eher unkoordiniert und eingebettet in nationale Konjunkturpakete von historischem Ausmaß.
Fiskalische Stimuli und rezessionsbedingte Steuerausfälle führen zu einem starken Anstieg der weltweiten öffentlichen Verschuldung. Zugleich zehrt die Krise Ersparnisse und Rücklagen auf, so dass auch die privaten Schulden anwachsen. Die Hypothek hoher öffentlicher und privater Schuldenstände dürfte einen Aufschwung, der von privatem Konsum und von Investitionen getragen wird, nachhaltig konterkarieren. Aber ohne Wirtschaftswachstum wird die Eurozone mit dem sich verschärfenden Problem übermäßiger Staatsverschuldung konfrontiert sein und nur ungünstige Optionen (Haushaltskonsolidierung, Schuldenrestrukturierung oder Schuldenvergemeinschaftung) zur Auswahl haben.
Um eine Schuldenkrise der Schwellenländer abzuwenden, sind die internationalen Institutionen bereits aktiv geworden. Im April einigten sich die G20-Finanzminister auf eine Initiative zur Aussetzung des Schuldendienstes für die ärmsten Länder. Diese können ihre Tilgungszahlungen bis Ende 2020 im Umfang von bis zu 11,5 Milliarden Dollar aufschieben.3 Die Covid-19-Pandemie hat auch bereits zu einer beispiellos hohen Nachfrage nach Finanzhilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank und der spezialisierten multilateralen Entwicklungsbanken geführt.
Internationaler Handel: Neue Trends oder alte Reflexe?
Stärker noch als die nationale Produktion und Einkommensentstehung beeinträchtigt die Corona-Pandemie den internationalen Handel. Ohnehin stagniert der Prozess der Globalisierung seit einigen Jahren. Tatsächlich ist seit längerem ein Rückbau des Handels in Wertschöpfungsketten in Richtung Regionalisierung und Renationalisierung zu beobachten.4 Parallel zu einem Schwinden des Vertrauens in multilaterale Regelungswerke hat ein schleichender Protektionismus um sich gegriffen, und Handelskonflikte nehmen zu. Auch Ansätze zu einer Stärkung der ökonomischen Resilienz waren schon vor Corona zu beobachten, etwa im Kontext von Naturkatastrophen wie dem Tsunami 2011 in Japan. Zusätzlich wirken Entwicklungen wie die Digitalisierung und Robotisierung zum einen renationalisierend, denn sie ermöglichen es, arbeitsintensive Fertigung dank neuer Technik an einem zentralen Produktionsstandort stattfinden zu lassen, statt sie wie bisher wegen geringer Lohnkosten auszulagern. Auf der anderen Seite aber können digitalisierungsfähige Dienstleistungen auch leichter in Niedriglohnstandorte verlagert werden. Ein weiterer Treiber der Renationalisierung ist die stärkere Berücksichtigung des Aspekts Nachhaltigkeit, angeheizt durch die größer gewordene Skepsis – zumindest in den Industrieländern –gegenüber der Globalisierung und offenem Handel als Ziel per se. Diese Tendenz wird noch gestützt von den Bestrebungen, sich von der empfundenen chinesischen Dominanz unabhängig zu machen.
Die Erwartungen und Ansprüche an Berlin steigen durch die Pandemie – in Europa wie in der Welt.
Insgesamt ist das Volumen von Handel und Investitionen seit Beginn der Corona-Krise deutlich geschrumpft. Über das Jahr gerechnet dürfte der Welthandel gut doppelt so stark zurückgehen wie das Welt-Bruttoinlandsprodukt.5 Auch bei Auslandsinvestitionen prognostiziert die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) für 2020 einen Rückgang von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.6 Der Handelseinbruch war unmittelbar zurückzuführen auf Unterbrechungen der Wertschöpfungsketten infolge nationaler Lockdowns und Grenzschließungen: Überall auf der Welt reagierten Staaten seit Ende Februar mit mittlerweile bald 300 handelspolitischen Maßnahmen, die vor allem medizinische Güter und Dienstleistungen betrafen. Negativ wirken sich vor allem Exportbegrenzungen aus.
Die EU zählt dabei nach Brasilien, Indonesien und Russland zu jenen Akteuren, die seit Krisenbeginn die meisten Handelsmaßnahmen ergriffen haben.7 Sogar innerhalb der Union kam es zu bislang im Binnenmarkt unbekannten Ausfuhrverboten, die etwa für deutsche und französische Schutzausrüstung galten.
Allerdings haben Staaten weltweit und auch die EU viele Maßnahmen beschlossen, die den Handel erleichtern, zum Beispiel Senkungen der Zölle für Schutzausrüstung oder beschleunigende Prüfverfahren für Standards.8
Schlussfolgerung: Komplexe Resilienz für die Wirtschafts-, Handels- und Finanzpolitik
Für die Außenwirtschaftspolitik Deutschlands ist die EU der relevante Handlungsrahmen. Die deutschen Einfluss- und Wirkungsspielräume leiten sich zuvorderst von der Wirtschaftskraft und der Resilienz des Standorts Deutschland ab. Insofern sollte die politische Reaktion der Bundesregierung auf die weltwirtschaftlichen Herausforderungen, die sich mit der Pandemie stellen, sowohl die nationale wie die europäische Ebene im Auge haben.
So ist zunächst festzustellen, dass im Gefolge der Gesundheitskrise das relative Gewicht Deutschlands zunehmen wird. Die Erwartungen und Ansprüche an Berlin wachsen sowohl in Europa als auch in der Welt. Wirtschaftliche Größe als Machtressource taugt aber nur, wenn sie mit wirtschaftlicher Leistungs- und politischer Handlungsfähigkeit verbunden ist. Vordringlich muss es der Bundesregierung daher allgemein – und auch unabhängig von der Corona-Krise – um »gute« Wirtschaftspolitik für den Standort Deutschland gehen, die einen sozialen Ausgleich schafft, dabei aber sozial- und finanzpolitisch nachhaltig bleibt, den digitalen und klimapolitischen Strukturwandel fördert, ohne dabei die Gesellschaft zu überfordern, und sich auf Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit ausrichtet.
Finanzpolitisch wird es sowohl in Deutschland als auch für Europa notwendig sein, die Wirtschaft weiter mit fiskalischen Stimuli zu unterstützen. Angesichts des starken Anstiegs der öffentlichen und privaten Verschuldung werden die Zentralbanken über einen längeren Zeitraum Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen müssen. Übermäßige Staatsverschuldung in Verbindung mit einem geringen Wirtschaftswachstum wird zu einem wachsenden wirtschaftlichen und politischen Problem in der Eurozone und in der EU werden. In Anbetracht dessen wird von Deutschland mehr Führung und eine größere Bereitschaft gefordert werden, Risiken im Bereich der Fiskalpolitik, der Geldpolitik und des Bankensektors zu teilen.
Der Einbruch der Weltwirtschaft hat auf globaler Ebene keine ausreichende, koordinierte Reaktion ausgelöst. Ohne internationale Zusammenarbeit wird es aber sehr viel schwerer werden, die Weltwirtschaft wieder auf einen Wachstumspfad zurückzuführen und eine internationale Schuldenkrise abzuwenden. Die G20-Finanzminister sollten daher ihre Bemühungen um eine Koordination der Finanzpolitik verstärken und die Niedrigeinkommensländer durch Lockerung der Kreditbedingungen unterstützen.
Die handelspolitischen Strategien der EU werden sich im Spannungsfeld von Renationalisierung und Internationalisierung bewegen,9 zwischen Maßnahmen einerseits, die die europäische Produktion stärken oder deren Verwundbarkeit bei strategischen Gütern mindern, und andererseits solchen, die Bezugsquellen und Wertschöpfungsketten diversifizieren und den Handel erleichtern. Dabei kann es nicht im Interesse eines großen Exporteurs sein – wie es die EU und auch Deutschland sind –, einer kurzsichtigen Devise wie »Reshoring ist die neue Globalisierung« zu folgen. Die EU sollte daher dem Trend zur Schwächung der multilateralen Handelsregulierung im Verbund mit gleichgesinnten Partnern entgegenwirken: Ein Beispiel dafür ist der gemeinsam mit Kanada und Neuseeland bei der WTO eingebrachte Vorschlag, strengere Kriterien für Verbote zu definieren, sogenannte essentielle Güter zu exportieren. Auch eine Nutzung plurilateraler Abkommen kann kollektivem Agieren wieder mehr Raum verschaffen und überdies den Handel Covid-relevanter Güter und Dienstleistungen stärken: Das Pharmazieabkommen etwa ließe sich über Arzneimittel hinaus auch auf Ausrüstungsgüter ausdehnen.10
Kai-Olaf Lang / Claudia Zilla
Kein Aufwind für populistisches Regieren in Corona-Zeiten
In Krisensituationen geraten eingeübte oder institutionalisierte Handlungsrepertoires unter Druck. Das gilt auch für die Covid-19-Pandemie, während der sich in beinahe sämtlichen Ländern der Welt zumindest temporär das herkömmliche Regieren verändert hat. Diese Veränderungen können Inhalt und Modus politischer Entscheidungen sowie die Konstellation der daran beteiligten Personen und Institutionen betreffen. Bildet die von der Covid-19-Pandemie geprägte Situation einen fruchtbaren Boden dafür, dass populistisches Regieren Aufwind erhält?
Unter populistischem Regieren verstehen wir einen Führungsstil, der auf einem Deutungs-, Diskurs- und Beziehungsmuster basiert, mit dem Regierende versuchen, das von ihnen umworbene »Volk« unter dem Vorzeichen einer moralisch aufgeladenen Freund-Feind-Dichotomie gegen einen bestimmten Sektor der Gesellschaft (»Establishment«, »politische Klasse«, »Oligarchie« etc.) in Stellung zu bringen. Typische Handlungsweisen bzw. Tendenzen populistischen Regierens sind: (1) Konstruktion eines antagonistischen Moments in der Gesellschaft und darauf bezogene Förderung politischer Polarisierung und gesellschaftlicher Mobilisierung, (2) Personalisierung der Politik, Machtkonzentration in den Händen des bzw. der Regierenden und in der Folge Abbau institutioneller Kontrollen, (3) Einschränkung des Pluralismus und der Rechte insbesondere der Opposition und von Minderheiten.1
Im internationalen Vergleich lässt sich keine durchgehende Intensivierung dieser Handlungsweisen im Kontext der Pandemie beobachten, denn es müssen stets weitere Faktoren hinzukommen, die populistisch-autoritäre Tendenzen beim Regieren fördern oder bremsen. Besondere Relevanz haben dabei die Situationsdeutung durch die Exekutive sowie die Rolle von Legislative und Judikative.
Regieren unter »Corona«
Eine weit verbreitete und wichtige Komponente des anfänglichen epidemiologischen Krisenmanagements waren in populistisch wie in nichtpopulistisch regierten Staaten restriktive Maßnahmen zur Eindämmung der Virus-Ausbreitung. Sie erforderten einerseits rasches und entschlossenes Regierungshandeln und erlegten andererseits Gesellschaft und Wirtschaft zahlreiche Einschränkungen auf. Vielerorts haben Regierungen den Ausnahmezustand erklärt oder Notstandsgesetze erlassen, um gesundheits- und wirtschaftspolitische Ressourcen effektiv zu mobilisieren. Während die Öffentlichkeit auf Corona fokussiert war, wurden in zahlreichen Fällen unpopuläre Gesetze mit Konfliktpotential zügig erlassen. Verschiedene Einheiten des Sicherheitsapparats wurden eingesetzt, um Quarantänen abzusichern (etwa die Polizei in den Straßen) und das Gesundheitssystem zu unterstützen (beispielsweise durch die Ausweitung der Aufgaben von Streitkräften). Viele Regierungen nutzten bei ihrem Krisenmanagement einen martialischen Diskurs: Sie erklärten dem Virus den Krieg oder sagten ihm den Kampf an. Fragen einer weit verstandenen nationalen Sicherheit rückten hoch auf die politische Agenda, der Staat gewann an Zentralität.
Dieses Handlungsrepertoire lässt sich aber nicht nur und auch nicht in allen Ländern beobachten, die populistisch regiert werden. Einerseits finden sich viele seiner Aspekte im Krisenmanagement nichtpopulistischer Regierungen wieder. Andererseits setzt ein solches Handlungsrepertoire voraus, dass die Covid-19-Pandemie als Krise aufgefasst bzw. dargestellt wird, als Corona-Krise, und das ist keineswegs zwingend.
Reaktionen populistischer Regierungen
Die USA und Brasilien gehören zu den am stärksten von der Pandemie getroffenen Ländern. Ende November verzeichneten sie die höchsten Zahlen an Covid-19-Todesfällen weltweit; gemessen an der Zahl der Infizierten, die seit Ausbruch der Krankheit registriert wurden, lagen sie auf dem ersten bzw. auf dem dritten Rang.2 Doch Donald Trump und Jair Bolsonaro, ihre populistisch regierenden Präsidenten, haben die Pandemie lange nicht als bedeutende Gesundheitsgefährdung aufgefasst (bzw. tun sie das bis heute nicht), die eine besondere Bewältigungsstrategie erfordert. Ähnlich verzögert reagierten Boris Johnson in Großbritannien, Manuel López Obrador in Mexiko, Daniel Ortega in Nicaragua und Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei – allesamt Staatschefs, die das Infektionsrisiko monatelang herunterspielten.
Ihre relativierende Haltung nährt sich häufig zum einen aus der Verachtung der akademischen Elite, von Expertentum und fachlich spezialisierten internationalen Organisationen, die mehrheitlich vor den Gefahren warnten; damit geht bei Trump und Bolsonaro das Bemühen einher, das Testen zu stoppen und Statistiken zurückzuhalten oder zu manipulieren, die ihre Deutung in Frage stellen. (Diese Art von restriktiver Informationspolitik war allerdings auch schon vor der Pandemie zu beobachten.) Bolsonaro und Trump entschieden sich zum anderen für die Priorisierung der Wirtschaft und gegen einen Lockdown, womit sie sich gegen entsprechende Maßnahmen der Gouverneure stellten. Bolsonaro versuchte sogar, die Entscheidungen der Bundesstaaten aufzuheben, doch wurde er durch Urteile des Obersten Gerichtshofs zugunsten der Gouverneure gebremst.3 Der populistische, polarisierende Diskurs Trumps und Bolsonaros wird so um eine Corona-Komponente angereichert: Wer im Lande Eindämmungsmaßnahmen befürwortet, ist gegen das Volk, das unbeeinträchtigt seiner Arbeit nachgehen und an seiner Freiheit festhalten will. International wird das als Feind wahrgenommene China nun auch als Virusexporteur und die Weltgesundheitsorganisation als autoritäre, fremdartige, von chinesischen Interessen dominierte Einrichtung charakterisiert.
Wird hingegen die Covid-19-Pandemie als Krise angesehen bzw. deklariert, kann sie zum Anlass genommen werden, politisch durchzugreifen. Ob dabei die Tendenzen populistischen Regierens virulenter werden, hängt stark vom Kontext ab. In Indien schränkte die Regierung von Narendra Modi die Meinungs- und Pressefreiheit ein, um sowohl die kritische Berichterstattung über das Krisenmanagement als auch die Verbreitung von Fake News zu unterbinden. Der Lockdown bot auch einen willkommenen Vorwand, die anhaltenden Proteste gegen die Änderung des Staatsbürgerrechts aufzulösen. In El Salvador schloss das menschenrechtsverletzende Krisenmanagement von Präsident Nayib Bukele »Eindämmungszentren« für die Internierung von Personen ein, die gegen die Ausgangssperre verstießen. Dies erfolgte auf der Grundlage mehrerer Notstandsdekrete der Exekutive und unter expliziter Missachtung der Beschlüsse des Verfassungsgerichtshofs.
Sind aber diese Angriffe auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Ausdruck eines Corona-bedingten, neuartigen oder verschärften autoritären Regierungshandelns? Nicht in jedem Falle: Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro macht in erster Linie Rückkehrende aus dem verfeindeten Nachbarland Kolumbien für den Ausbruch der Pandemie im eigenen Land verantwortlich, bezeichnet sie stigmatisierend als »Biowaffen« und lässt sie in Quarantänelager einsperren. Unter Verweis auf die Corona-Krise rief er bereits im März 2020 per Dekret den Alarmzustand aus. Allerdings hebt sich dieses politisch-juristische Vorgehen nicht vom autokratischen Hintergrund ab: Spätestens seit 2015 wird in Venezuela – mit den verschiedensten Begründungen und unter Zustimmung der gleichgeschalteten Gewalten – konsekutiv und lückenlos der Ausnahmezustand immer wieder neu erklärt oder verlängert.4 Dass die Regierung sich nun auf die Pandemie zur Begründung des jüngsten Notstandsdekretes bezieht, ist ein eher willkürlicher Akt.
In der Europäischen Union (EU) waren es zunächst Maßnahmen der Regierungen in Polen und Ungarn, die während der Pandemie Aufmerksamkeit erregten. In Polen ging es vor allem darum, dass die größte Regierungspartei PiS und deren Parteichef Jarosław Kaczyński an dem Termin für die erste Runde der Präsidentschaftswahlen festhalten wollten, der ursprünglich für den 10. Mai vorgesehen war. Unter den Bedingungen der Pandemie und des Lockdowns war aber kein fairer Wahlkampf möglich, und die geplante Umstellung auf eine ausschließliche Briefwahl hätte sich aufgrund der Kürze der Zeit technisch nur schwer umsetzen lassen. Der PiS wurde denn auch vorgeworfen, sie wolle unter Inkaufnahme von gesundheitlichen Risiken und Verfahrensmängeln die Wahlen um jeden Preis durchboxen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Chancen für Amtsinhaber Andrzej Duda, den Kandidaten der Regierungspartei, hervorragend waren, aber im Laufe der folgenden Monate zu schwinden drohten. Erst als ein kleinerer Koalitionspartner der PiS sich querlegte, wurde ein späterer Wahltermin (zwei Runden, im Juni und Juli) angesetzt.
In der Pandemie riskieren die Regierenden, an Glaubwürdigkeit, Autorität und Legitimität zu verlieren.
In Ungarn kreiste die Diskussion um ein Gesetz zum »Gefahrenzustand«, das der konservativen Regierung, die aus den Parteien Fidesz und KDNP besteht, Sondervollmachten zur Bekämpfung der Pandemie gab. Das Parlament verabschiedete das Gesetz Ende März mit einer Zweidrittelmehrheit. An dem Gesetz wurde unter anderem kritisiert, dass es keine Befristung der außerordentlichen Befugnisse für die Regierung vorsehe und die Verbreitung von Fake News im Kontext der Pandemie unverhältnismäßig sanktioniert werde. Tatsächlich enthielt das Gesetz aber Bestimmungen, die dem Parlament Kontrollrechte einräumten, insbesondere die Beendigung des Gefahrenzustandes zu jedem von ihm gewählten Zeitpunkt. In der Tat betrieb Ungarn ein konsequentes Krisenmanagement und führte eine Vielzahl teils umstrittener Regelungen ein. Seitens der Opposition wurde unter anderem kritisiert, dass die Hälfte der Mittel zur Finanzierung politischer Parteien einem neugeschaffenen Spezialfonds zur Pandemiebekämpfung zukommt, womit angeblich das deutlich sichtbarere Regierungslager favorisiert werde. Gleichwohl unterschied sich das Gros der ergriffenen Maßnahmen kaum von denen in anderen europäischen Ländern. Das umstrittene Gesetz wurde in der zweiten Juni-Hälfte zurückgenommen. Ein anschließend verabschiedetes neues Gesetz weist der Regierung für künftige »gesundheitliche Krisensituationen« allerdings weiterhin ähnliche Spezialkompetenzen zu, die eine wirksame Bewältigung medizinischer Notlagen ermöglichen sollen. Trotz der Kritik, die von der Opposition und im Ausland geübt wurde, sah die EU jenseits der Artikulierung allgemeiner Besorgtheit keinen Anlass dafür, als Reaktion auf das ungarische Pandemiemanagement und konkret auf das Notstandsgesetz neue Maßnahmen gegen Ungarn einzuleiten.
Sowohl in Polen als auch in Ungarn waren die Regierungen bei der Eindämmung der Covid-Pandemie zumindest während der ersten Welle recht erfolgreich. Die Regierungsparteien nahmen die Pandemie ernst und reagierten rasch und restriktiv. In keinem der beiden Länder hat die Pandemie diese Parteien bisher substanziell geschwächt, ebenso wenig hat sie dazu geführt, die Machtfülle der Regierungsparteien zu bereichern. Umstrittene Maßnahmen wie Reformen der Kommunalfinanzen in Ungarn, infolge derer Einkommensquellen der Städte auf Regionen oder auf die nationale Ebene verlagert wurden, hätten auch vor oder nach der Pandemie getroffen werden können.
Kein eindeutiger Trend
In der Gesamtschau zeigt sich somit bisher kein klarer qualitativer Trend: Die Corona-Krise wirkt nur in einigen populistisch regierten Ländern als Katalysator für eine Intensivierung polarisierender Politik bzw. autoritärer Maßnahmen. Populistisch Regierende, die die Gefahren der Covid-19-Pandemie herunterspielten und sich gegen Eindämmungsmaßnahmen wandten, haben (zumindest zeitweise) an Zustimmung in der Bevölkerung eingebüßt. Die Corona-Krise erweist sich insofern keineswegs als große Chance für polarisierendes Regieren und neue Formen der Machtsicherung oder ‑ausweitung. Sie stellt für Regierende eher ein Risiko dar, an Glaubwürdigkeit, Autorität und Legitimität zu verlieren – insbesondere durch den Umgang mit den sozialökonomischen Folgen. Höchst relevant in diesem Zusammenhang ist der Grad an Machtdiffusion im politischen System: Föderalismus und (noch) unabhängige Gerichtshöfe können als Gegenkraft zum »Durchgreifen« aus der Hauptstadt fungieren. Zudem ist von Belang, ob der Notstand per Gesetz vom Parlament oder per Dekret vom Präsidenten verhängt wird. Nicht jeder Notstand stellt eine Gefahr für Demokratie und Rechtsstaat dar.
Die außenpolitischen Konsequenzen sind bislang ebenfalls eher überschaubar. Das vielfach prognostizierte Neuarrangement im Wettkampf der großen Mächte, das auch durch neue Gegenmachtallianzen populistisch geführter Länder eintreten sollte, ist nicht erkennbar – genauso wenig die Entstehung einer neuen Internationalen der Populisten. Die Effekte der chinesischen »Maskendiplomatie« sind nicht so drastisch wie erwartet, und wo sie spürbar sind, betreffen sie Staaten unabhängig vom Politikstil ihrer Regierungen. Populistische Regierungen streben infolge der Krise auch nicht durchgängig danach, sich aus internationalen bzw. weltweiten Strukturen und Vernetzungen zurückzuziehen. Auch für Populisten ergab sich aus der Pandemie bislang kein manifester Deglobalisierungsimpuls – obschon gerade größere oder industriell entwickelte Länder bzw. Volkswirtschaften künftig Bestrebungen zeigen könnten, mehr wirtschaftliche, industrielle oder infrastrukturelle Autonomie zu erlangen (was auch wieder ein Ansinnen ist, das nicht allein populistische Parteien charakterisiert) und diese Ambitionen in einen souveränistischen Diskurs einzubinden.
Populistische Regierungen handelten in der Pandemie unterschiedlich: Einige sahen darin keine Krise, andere demonstrierten Entschlossenheit, wieder andere beriefen sich auf Covid-19, um schon zuvor übliches Regierungshandeln zu begründen. Insgesamt lässt sich also kein eindeutig populistisches, rechtspopulistisches oder autoritäres Handlungsmuster im Kontext von Corona identifizieren. Einige problematische Züge waren bereits vor der Pandemie charakteristisch für das Regierungshandeln. Andere Komponenten ihrer Handlungsrepertoires sind nicht »Markenzeichen« polarisierender Politik, sondern schlicht Elemente aus dem Maßnahmenspektrum »entschlossener« Pandemiebekämpfung, die sich auch in nichtpopulistischem Regierungshandeln ausmachen lassen.
Allerdings sollten im Kontext konfrontativ-polarisierenden Politikaustrags die längerfristigen Folgen der Pandemie nicht unbeachtet bleiben. Polarisierende Politik gedeiht in Krisenzeiten. Eine langanhaltende Wirtschaftskrise könnte populistischen Parteien und Akteuren durchaus Rückenwind verleihen. Derlei Gruppierungen und Persönlichkeiten mit Regierungsverantwortung mögen oftmals außerstande sein, ökonomische Krisen zu meistern. Aber sie können Auftrieb erfahren, sofern sie das Vertrauen der Bevölkerung behalten und in der Lage sind, Konflikte umzudeuten oder zu generieren, welche die Krise überlagern. Denn solche Akteure mobilisieren Unzufriedenheit und machen sich Orientierungslosigkeit und Verunsicherung zunutze. Dies gilt insbesondere für Parteien in der Opposition. Aber auch populistische Akteure in Regierungsverantwortung könnten profitieren, wenn es ihnen gelingt, die Unzulänglichkeiten in ihren Ländern als extern verursachte und durch innere Konkurrenten verschlimmerte Unbill darzustellen.
Claudia Major / Marco Overhaus / Johannes Thimm / Judith Vorrath
Kein »Lockdown« der Gewalt: Covid‑19 verschärft die Gefahr von Konflikten und erschwert ihre Bearbeitung
Die globale Covid‑19-Pandemie hat das Bewusstsein dafür geschärft, dass die Folgen einer Gesundheitskrise für das gesellschaftliche Zusammenleben, die Wirtschaft und den Handel ähnlich disruptiv sein können wie die Bedrohung durch Gewalt, zum Beispiel in Form eines bewaffneten Konflikts oder des internationalen Terrorismus.
Gleichzeitig kann sich die Pandemie auch auf »klassische« Sicherheitsbedrohungen auswirken. Klare Aussagen über kausale Zusammenhänge zwischen der Infektionskrankheit und globaler (Un-)Sicherheit sind zwar praktisch nicht möglich. Zu vielfältig und komplex sind etwa Ursachen und Dynamiken bewaffneter Konflikte. Indirekt könnte die Pandemie jedoch negative Konsequenzen für aktuelle Gewaltkonflikte haben oder die Gefahr neuer Gewaltausbrüche erhöhen, indem sie das Verhalten beteiligter Akteure oder die Kontextbedingungen negativ beeinflusst und so als Konflikttreiber wirkt.
In den ersten Monaten, als sich Covid‑19 weltweit ausbreitete und Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen wurden, hatten 75 Staaten keinen Rückgang gewaltsamer Ereignisse oder sogar eine Zunahme zu verzeichnen. In deutlich weniger Staaten waren die Zahlen rückläufig. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), António Guterres, rief nach Ausbruch der Pandemie zu einem globalen Waffenstillstand auf, doch hat das bislang nicht dazu geführt, dass Kämpfe dauerhaft eingestellt oder gar bewaffnete Konflikte beigelegt worden wären. Zwar sank die Zahl einzelner Gewaltereignisse anfangs, aber das lag vor allem an einer starken Abnahme der Gewalt in Syrien und Afghanistan, die wenig mit der Pandemie zu tun hatte.1 Besonders in Libyen, Nigeria und im Jemen, wo es nach Guterres’ Appell zunächst positive Signale gegeben hatte, nahm die Gewalt anschließend wieder zu. Im Oktober 2020 plädierte der UN‑Generalsekretär vor dem Sicherheitsrat erneut für eine Waffenruhe im Jemen; dies zeigt, dass sich in laufenden Konflikten durch die Pandemie als solche wenig am Kalkül der Akteure geändert hat.2
Dennoch lassen sich drei Mechanismen identifizieren, über die sich die Pandemie negativ auf die globale Sicherheit auswirken kann, die also potentielle Konflikttreiber sind: Erstens werden Staaten durch die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen von Covid‑19 fragiler. Zweitens wachsen die Spannungen zwischen Groß- und Regionalmächten aufgrund der Instrumentalisierung von Covid‑19 und der Verschiebungen bei internationalen Wertschöpfungsketten weiter. Und drittens fehlt es (sowohl kurz- als auch langfristig) an Kapazitäten für die Krisenprävention, Stabilisierung und Friedenssicherung, weil Entscheidungsstrukturen blockiert und finanzielle Ressourcen knapper werden.
Zunehmende staatliche Fragilität
Der Bericht »States of Fragility 2020« der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sieht in Covid‑19 einen systemischen Schock für fragile Staaten, der Risiken für sie verschärft, während ihre Kapazitäten zur Bewältigung dieser Risiken schrumpfen. Vielerorts hat die Pandemie wirtschaftliche Probleme verstärkt, die fragile Staaten schon zuvor geplagt hatten. Entwicklungsländer, die bereits mit Leistungsbilanzdefiziten, Abwertung ihrer Währung und steigender Auslandsverschuldung konfrontiert waren, geraten in zusätzliche Schwierigkeiten. Einbrüche bei der weltweiten Nachfrage nach Rohstoffen, aber auch im Tourismussektor treffen einige dieser Staaten schwer. Hinzu kommt, dass externe Quellen wie Rücküberweisungen versiegen und internationale Hilfsmaßnahmen sich auf sehr viele betroffene Staaten verteilen. In zahlreichen Entwicklungs- und Schwellenländern steigen die Preise für Güter des täglichen Bedarfs, Arbeitslosigkeit und sozioökonomische Ungleichheit nehmen zu. Bereits als fragil eingestufte Staaten sind besonders von den erwähnten Folgen betroffen, zumal sie in der Regel einen sehr hohen Anteil an Beschäftigten im informellen Sektor aufweisen.
Wenn sich Verteilungskonflikte zuspitzen, kommt es umso mehr auf die Steuerungsfähigkeit der Regierungen an. Doch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie verringern den ohnehin begrenzten Handlungsspielraum vieler Regierungen in fragilen Staaten. Zudem dürfte das Vertrauen in staatliche Institutionen in solchen Ländern sinken, in denen der Zugang zu sowieso schon mangelhafter medizinischer Versorgung und öffentlichen Dienstleistungen während der Pandemie sehr ungleich ist oder die Beschränkungen des öffentlichen Lebens mit »harter Hand« und unter Verletzung von Menschenrechten durchgesetzt wurden.
Teilweise haben nichtstaatliche Gewaltakteure in der Pandemie Hilfe und quasistaatliche Leistungen erbracht. So unterschiedliche Gruppierungen wie die Taliban in Afghanistan, Kartelle in Mexiko und Gangs in Südafrika haben Lebensmittel und Gesundheitsinformationen verteilt und mitunter Ausgangssperren durchgesetzt. Ob sie damit ihre Kontrolle und ihren Rückhalt in der Gesellschaft dauerhaft ausbauen können, ist offen. Doch im Wettstreit um Autorität und Legitimität drohen ohnehin schon schwache Staaten weiter an Boden zu verlieren.
Der Gefahr einer von Covid‑19 verstärkten Abwärtsspirale sind nicht nur Staaten ausgesetzt, die laut OECD bereits als extrem fragil gelten, etwa Afghanistan, Haiti oder die Demokratische Republik Kongo. Besorgniserregend ist die Situation gerade in Ländern, die noch nicht zu dieser Kategorie gezählt werden, wo die Folgen der Pandemie aber auf eine erodierende Sicherheitslage oder eine stark polarisierte politische Landschaft treffen. Ersteres ist beispielsweise in Mosambik, Letzteres in Simbabwe der Fall.
Die Pandemie als potentieller Treiber von Rivalitäten zwischen Groß- und Regionalmächten
Die Corona-Pandemie kann auch als zusätzlicher Treiber bestehender Konflikte zwischen Groß- und Regionalmächten wirken. Diese Konflikte bergen einerseits die Gefahr, in eine direkte militärische Konfrontation zu eskalieren. Andererseits verleiten sie die involvierten Mächte dazu, in laufende bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen oder innerhalb von Drittstaaten einzugreifen und so deren Lösung zu erschweren.
Bereits vor dem Ausbruch der Pandemie sahen sich Groß- und Regionalmächte wie die USA und China, Indien und China, die Türkei und Russland sowie Iran und Saudi-Arabien in einem mehrdimensionalen Wettbewerb um Einfluss und Ressourcen. Solche Rivalitäten sind meist durch Nullsummendenken und Sicherheitsdilemmata gekennzeichnet. Die Pandemie ist dann Konflikttreiber, wenn ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen diese Länder unterschiedlich hart treffen und darüber hinaus zu Veränderungen in den internationalen Wertschöpfungsketten und Investitionsbeziehungen führen. Denn eine solche Entwicklung schürt die bereits vorhandenen Ängste vor einem relativen Machtverlust und schafft zugleich Anreize, die Auswirkungen der Pandemie zum eigenen Vorteil zu nutzen.
Besonders deutlich wird dies in den Beziehungen zwischen den USA und China. Zum einen befinden sich Washington und Peking in einem Deutungskampf darüber, wer für den Ausbruch und die rasante Ausbreitung von Covid‑19 verantwortlich ist. Zum anderen hat die Pandemie die globale Gesundheitspolitik, in der die Rivalen bis 2020 entgegen aller sonstigen strategischen Konkurrenz kooperiert hatten, nun ebenso zum Schauplatz ihres Antagonismus gemacht.
Die Erwartung, dass China sich erheblich schneller von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erholen könnte als die USA und andere westliche Länder,3 dürfte in Washington einen konfrontativen Kurs gegenüber Peking begünstigen.
Auch die weit zurückreichende Rivalität zwischen Indien und China, die Anfang Mai 2020 in gewaltsamen Grenzstreitigkeiten in der Kaschmir-Region kulminierte, wird durch die Pandemie eher befeuert. So sah die indische Regierung nach dem Ausbruch der Seuche die Chance, ausländische Investitionen, die in China getätigt werden sollen, ins eigene Land zu lenken – und wird von den USA ausdrücklich dazu ermutigt, »Wertschöpfungsketten von China ab[zu]werben«.4 Sowohl Indien als auch China versuchen zudem, durch Hilfslieferungen medizinischer Güter ihren internationalen Einfluss vor allem in Süd- und Südostasien auszuweiten.
Statt mehr Kooperation zu bewirken, wurde Corona nur ein weiterer Faktor im Kalkül machtpolitischer Interessen.
In anderen Konstellationen gibt es allerdings wenig Anzeichen dafür, dass die Corona-Pandemie tatsächlich als unmittelbarer Konflikttreiber wirkt. Das gilt beispielsweise für Russland und die Türkei, die miteinander um Einfluss unter anderem im Schwarzen Meer und im südlichen Kaukasus ringen, zuletzt auch, indem sie im Konflikt um Bergkarabach unterschiedliche Seiten unterstützten.
In der Gesamtschau hat die Pandemie nicht zu mehr Kooperation zwischen Groß- und Regionalmächten geführt. Stattdessen wurde sie zu einem weiteren Faktor im Kalkül bestehender machtpolitischer Interessen.
Geschwächte Institutionen und knappere Ressourcen
Die Rivalitäten zwischen den Groß- und Regionalmächten schwächen nicht nur die Weltgesundheitsorganisation (WHO), und dies just in einer Zeit, in der sie am meisten gebraucht wird. Sie ziehen darüber hinaus auch fast alle Foren globaler Kooperation in Mitleidenschaft. Das betrifft ebenfalls den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der bislang kaum auf die friedens- und sicherheitspolitischen Herausforderungen durch Covid‑19 reagiert hat. Vielmehr behinderten und verwässerten insbesondere die USA und China vor dem Hintergrund der Pandemie dessen Beschlüsse.
Anders als bei der Ebola-Epidemie in Westafrika 2014–2016 hat Washington bis dato keine Versuche unternommen, die globale Reaktion auf die Corona-Pandemie zu koordinieren. Während der Präsidentschaft Donald Trumps haben sich die USA weniger in einer internationalen Verantwortung gesehen; sie vermittelten kaum noch in aktuellen Auseinandersetzungen mit hohem Konfliktpotential, sei es zwischen Staaten, wie der Türkei, Griechenland und Frankreich, oder innerhalb von Organisationen, etwa den UN. Bisher sind andere Länder weder willens noch in der Lage, die USA in dieser Rolle zu ersetzen. Nicht nur politisch, vor allem finanziell geraten die UN zusehends in schweres Fahrwasser. Der Bericht des Generalsekretärs vom Oktober betont, dass die finanzielle Situation 2020 schlechter geworden ist im Vergleich zum Vorjahr, das bereits von einer tiefgreifenden Liquiditätskrise der UN gekennzeichnet war.5 Wie weitgehend die Kurskorrektur unter Präsident Joseph Biden ausfallen wird, ist noch nicht absehbar. Doch die Zahlungsmoral vieler anderer Staaten hinsichtlich der jährlichen Beiträge wird sich in Anbetracht schrumpfender Budgets kaum verbessern.
Generell stehen infolge der Corona-Pandemie weniger Ressourcen zur Konfliktbearbeitung zur Verfügung. Die meisten entwickelten Länder, auch die Staaten der Europäischen Union (EU), mobilisieren erhebliche öffentliche Finanzmittel für ihre eigene wirtschaftliche Erholung. Während die Kosten für Maßnahmen zur Unterstützung der eigenen Gesellschaft massiv steigen, brechen gleichzeitig Steuereinnahmen weg, mit denen typischerweise internationale Stabilisierungsmaßnahmen finanziert werden.
Internationale Akteure wie die EU und die Nato haben ebenso wie die beteiligten Staaten seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 ihre Einsätze angepasst. Temporäre Einschränkungen, etwa bei Aufgaben, Kontakten und Bewegungsfreiheit, sowie Teilevakuierungen und Quarantänezeiten bei Rotationen haben internationale Einsätze beeinträchtigt, was die lokale und regionale Sicherheitslage zum Teil verschlechtert hat. Zum Beispiel ging das zeitweilige Einfrieren der internationalen Ausbildungsmissionen im Irak und in Mali mit mehr Unsicherheit einher. Zudem erschweren Reisebeschränkungen und die Aussetzung von Konferenz- und Gipfelformaten klassische diplomatische Initiativen und informelle Verhandlungsansätze. Schließlich hat die öffentliche und politische Aufmerksamkeit für sich anbahnende oder eskalierende Gewaltkonflikte mit der Pandemie merklich abgenommen.
Fazit
Angesichts der Gleichzeitigkeit verschiedener sicherheitspolitischer Negativtrends infolge der Corona-Pandemie und der aus ihr resultierenden Verknappung von Ressourcen ist es nötig, klare Prioritäten zu setzen bei der Prävention und Bearbeitung von Konflikten. Krisenprävention ist ein traditionelles Kernanliegen der deutschen Sicherheitspolitik. Dabei sollte der Fokus auf jenen fragilen Staaten liegen, in denen sich die (sicherheits-)politische Situation mit den Folgen von Covid‑19 zuzuspitzen droht. Außerdem gilt es zu verhindern, dass internationale Institutionen wie die Vereinten Nationen kapitulieren müssen, weil die Zahlungsmoral einiger ihrer Mitglieder weiter sinkt. Priorisierung kann dabei auch eine regionale Dimension haben. So wird mit europäischen Partnern am ehesten ein ausgeweitetes Engagement in der europäischen Nachbarschaft möglich sein, etwa in der Sahelzone.
Grundsätzlich ist es weiterhin notwendig, die Resilienz von Staaten und Gesellschaften zu stärken. Regierungen, die Vertrauen genießen, sind handlungsfähiger, ob bei der Eindämmung von Infektionskrankheiten oder im Umgang mit gesellschaftlichen Spannungen. Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ungleichheit macht Gesellschaften weniger anfällig für externe Schocks, darüber hinaus sichert sie gesellschaftlichen Frieden. Die Leitlinien der Bundesregierung »Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern« und die ressortgemeinsamen Strategien bieten hierfür viele Ansatzpunkte. Was die Maßnahmen angeht, muss das Rad also nicht neu erfunden werden.
Trotz knapper Finanzen ist es wichtig, der Versuchung zu widerstehen, beim internationalen Engagement zu stark zu kürzen. Während reiche Staaten billig Geld leihen können, bleibt den armen Ländern häufig nur die Austerität. Solidarität mit schwächeren Staaten, sei es im Rahmen des Europäischen Aufbauplans oder durch Schuldenerlasse in außereuropäischen Regionen, könnte sich als gute Investition in globale Sicherheit erweisen. Lassen sich Mittelkürzungen nicht vermeiden, sollten diese in der EU und der Nato mit den USA abgestimmt werden, um durch Synergien negative Folgen zu minimieren.
Auf die Rivalitäten zwischen Groß- und Regionalmächten kann deutsche und europäische Politik nur sehr begrenzt Einfluss nehmen. Entsprechende Vermittlungsangebote oder ‑versuche sollten dann gemacht werden, wenn eine realistische Perspektive für Deeskalation besteht. Die jüngste Vereinbarung zwischen den libyschen Konfliktparteien zeigt, dass durchaus Fortschritte möglich sind, mit einem langen Atem und wenn alle relevanten Akteure eingebunden werden – immer vorausgesetzt, die betroffenen Parteien haben daran ein Interesse.
Janis Kluge / Günther Maihold / Stephan Roll / Christian Wagner
Die Schwellenländer und die Corona‑Pandemie
Sind die Schwellenländer die großen Verlierer der Corona-Krise? Zumindest zu Beginn der Pandemie kamen viele Analysen zu diesem Schluss.1 Als große Profiteure der dynamischen Globalisierung der letzten drei Jahrzehnte schien diese Ländergruppe, die, je nach Abgrenzung, große Volkswirtschaften wie China und Indien, Rohstoffexporteure wie Brasilien, Russland und Saudi-Arabien sowie kleinere Staaten wie Marokko oder Chile umfasst, in besonderem Maße unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu leiden.
Die Argumente für diese These liegen auf der Hand: Wie Industrieländer sind die Schwellenländer auf vielfältige Weise durch ihre Kapital- und Gütermärkte, durch Migration und Tourismus in die Weltwirtschaft eingebunden und von dieser Verflechtung existenziell abhängig. Im Unterschied zu diesen verfügen sie aber oftmals nicht über die finanziellen und institutionellen Voraussetzungen, um dem externen Schock einer Pandemie zu begegnen.
Die meisten Schwellenländer sind zudem wirtschaftlich vorgeschwächt in die Krise geraten. Bereits vor der Pandemie geriet das Wachstum der großen Volkswirtschaften Indiens und Chinas ins Stocken. In China machte sich unter anderem der Handelsstreit mit den USA bemerkbar. Die Ökonomien der Rohstoffexporteure Brasilien, Russland und Saudi-Arabien stagnierten bereits seit dem Einbruch der Weltmarktpreise 2014/15.
Acht Monate nach Beginn der Pandemie zeigt sich indes: Covid-19 trifft zwar alle Schwellenländer, aber die sozioökonomischen, finanziellen und politischen Folgen sind sehr verschieden. Bereits bestehende Divergenzen innerhalb dieser Staatengruppe werden durch die Pandemie noch verstärkt. Auch vor der Gesundheitskrise waren die Schwellenländer keineswegs eine homogene Staatengruppe – durch Corona werden sie sich aber in Zukunft noch stärker voneinander unterscheiden.
Sozioökonomische Folgen
Der Kontrast beim Erfolg der Corona-Eindämmung könnte in der Gruppe der Schwellenländer kaum größer sein. Äußerst erfolgreich waren die Staaten der Mekong-Region, allen voran Vietnam und Thailand. Auch in China gelang es, das Virus weitestgehend unter Kontrolle zu bringen. Das schützte nicht nur die örtlichen Gesundheitssysteme vor einer Überlastung, sondern erlaubte es auch, auf dauerhafte Eingriffe in das Wirtschaftsleben zu verzichten.
Wo die Eindämmung über massive Lockdowns nicht gelang, etwa weil zu spät reagiert wurde oder die politischen Voraussetzung eine effektive Eindämmung des Virus unmöglich machten, geriet die Pandemie schnell außer Kontrolle. So verloren die Regierungen Brasiliens und Indonesiens wertvolle Zeit, indem sie die Gefahren der Pandemie verharmlosten.2 Heute finden sie sich mit vielen anderen Schwellenländern unter den weltweit am stärksten von Corona betroffenen Staaten, zu denen auch Indien, Russland und Südafrika gehören.
Besonders die ärmeren Schwellenländer wie beispielsweise Indien waren früh gezwungen, die vollständige Eindämmung des Virus als Ziel aufzugeben. Einen langen und harten Lockdown, der für ein Unterbrechen von vielen Tausend Infektionsketten notwendig gewesen wäre, konnten sie sich weder leisten, noch ließ er sich organisatorisch im Land durchsetzen. Eine gezielte Unterstützung für wirtschaftliche Opfer der Pandemiebekämpfung war alleine schon aufgrund des großen Anteils an Beschäftigten im informellen Sektor nicht möglich. Damit musste die Gesundheitskrise hingenommen werden, um eine möglicherweise bedrohlichere wirtschaftliche Krise und die damit einhergehenden Folgen für die politische Stabilität abzuwenden.
Für das Ausmaß der ökonomischen Schäden ist allerdings nicht nur der Grad der Ausbreitung der Infektionskrankheit, sondern auch die Struktur der Wirtschaftssysteme entscheidend. Exportorientierte Staaten konnten von einer relativ schnellen Erholung der Güternachfrage profitieren, wobei die Energieexporteure länger auf den Turnaround warten müssen. Wo den Exportnationen auch noch die Eindämmung des Virus gelang, wie in China und Vietnam, wird im Jahr 2020 trotz Weltwirtschaftskrise ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts erwartet.
Wo hingegen Tourismus oder Rücküberweisungen von Arbeitsmigrantinnen und ‑migranten wesentliche Säulen der Wirtschaftssysteme sind, war die Wirtschaft auch durch eine erfolgreiche Bekämpfung von Corona nicht zu retten. So rechnet das tourismusorientierte Thailand infolge der internationalen Reisebeschränkungen mit einer Reduzierung seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 8,5 Prozent.3 Besonders für die ärmeren Schwellenländer, in denen die Eindämmung des Virus nicht gelungen ist, wie etwa in Indien, Südafrika und Mexiko, wird ein Einbruch des BIP um mehr als 10 Prozent erwartet.4
Folgen für Devisenreserven und Staatsverschuldung
Zu Beginn der Pandemie kam es in allen Schwellenländern zu starken Kapitalabflüssen. In der Folge schrumpften alleine im März 2020 die Devisenreserven der wichtigsten Schwellenländer um insgesamt rund 100 Milliarden US-Dollar.5 Der Internationale Währungsfonds (IWF) verzeichnete eine Rekordzahl von Hilfeersuchen.6 Für einige Wochen herrschte die Sorge, dass die Corona-Krise viele der Staaten in eine Schuldenkrise treiben könnte. Noch im Vorfeld der Pandemie war die öffentliche und private Kreditaufnahme der Schwellenländer auf ein Rekordniveau gestiegen, weil internationale Investoren händeringend Alternativen zu den Niedrigzinsen der Industrieländer suchten.
Im Mai 2020 entspannte sich die Situation bei der Liquidität zumindest teilweise wieder. Einige Schwellenländer konnten sich in großem Umfang frisches Kapital verschaffen. Insgesamt wurden Anleihen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar begeben.7 Profitieren konnten dabei zwar in erster Linie die Staaten mit guten Bonitäts-Ratings und solche, die sich bereits unter dem Schutzschirm des IWF befanden.8 Nur wenige Länder nahmen allerdings neue große Rettungsprogramme des IWF in Anspruch (Ägypten und Ukraine). Zu Ausfällen beim Schuldendienst kam es nur bei solchen Staaten, bei denen sich die Zahlungsunfähigkeit schon vor der Pandemie angekündigt hatte (z.B. Argentinien).
Die vorübergehende Entspannung an den internationalen Finanzmärkten bedeutet allerdings nicht, dass die finanziell schwächer aufgestellten Schwellenländer aus dem Schneider sind. Auch wenn die akute Krise durch steigende Verschuldung im In- und Ausland gemeistert werden kann, drohen chronische Folgewirkungen. Beispielsweise lässt es die soziale Situation in Brasilien auf absehbare Zeit gar nicht zu, dass die Regierung eine nachhaltige Haushaltspolitik verfolgt. Diese Staaten müssen daher bei der Verschuldung höhere Risikoprämien bezahlen. Die wachsenden Schuldenberge der von Corona schwer getroffenen Staaten könnten sich insbesondere dann rächen, wenn sich die finanziellen Bedingungen auf dem Kapitalmarkt ähnlich wie im März noch einmal deutlich verschlechtern.9
Im Verlauf der Pandemie hat China seine Sonderrolle unter den Schwellenländern noch einmal unterstrichen.
Unter den Schwellenländern stechen allerdings einige wenige Staaten hervor, denen keine externe Verschuldungskrise droht, die vielmehr selbst Geldgeber notleidender Staaten sind. Das gilt in erster Linie für China.10 Durch seine gewaltigen Währungsreserven wäre Peking auch dann kaum in Schwierigkeiten geraten, wenn die Eindämmung der Pandemie nicht gelungen wäre. Darüber hinaus ist das Land selbst in der Lage, ärmeren Schwellenländern unter die Arme zu greifen und ihnen gegebenenfalls auch Schulden zu erlassen.11 Auch Russland verfügt über große Reserven, die der Ölexporteur überdies in der Krise kaum angerührt hat.12
Politische Folgen
Die innenpolitischen und institutionellen Voraussetzungen waren mitentscheidend dafür, dass die Schwellenländer das Virus mit sehr unterschiedlichem Erfolg bekämpften. In China wurde das robuste Vorgehen der Regierung durch die gefestigten autoritären Strukturen und die intensive Überwachung der Bevölkerung begünstigt. In anderen Schwellenländern waren die Regierungen wegen der schwachen staatlichen Strukturen nicht in der Lage oder nicht willens, weitreichende Kontaktbeschränkungen durchzusetzen. Brasilien, Mexiko, Indien und Indonesien verzeichnen auch aufgrund mangelnder staatlicher Eingriffsmöglichkeiten anhaltend hohe Ansteckungs- und Todeszahlen.
Die politischen Rahmenbedingungen konditionieren nicht nur den Verlauf der Krise, sie werden ihrerseits von der Pandemie verändert. Auch hier wurden große Unterschiede zwischen den Schwellenländern sichtbar. Einige Regierungen waren in der Lage, die Krise zu nutzen, um politische Ziele durchzusetzen oder Macht zu konsolidieren. So konnte in Indien die Modi-Regierung im Windschatten der Pandemiebekämpfung ihre protektionistische Wirtschaftspolitik weiter vorantreiben und ihre Macht gegenüber den Bundesstaaten stärken. In Brasilien erwies sich die subnationale Ebene im Vergleich zur Staatsführung als deutlich effektiver bei der Umsetzung der Eindämmungsmaßnahmen, was allerdings der Beliebtheit von Präsident Jair Bolsonaro keinen Abbruch tat. In Russland wiederum minderten die Corona-Politik und die Wirtschaftskrise das Vertrauen der Bevölkerung in die politische Führung drastisch. In Belarus war der Umgang mit Corona ein Mitauslöser der politischen Krise nach den Präsidentschaftswahlen.
Im Verlauf der Pandemie hat China seine Sonderrolle unter den Schwellenländern noch einmal unterstrichen. Obwohl das Land Ausgangspunkt der Pandemie war, geht die politische Führung gestärkt aus der Krise hervor. Nach der erfolgreichen Eindämmung des Virus könnte das Land daher neue Strahlkraft für Regierungen anderer Schwellenländer entfalten, insbesondere wenn es als Geldgeber oder als Lieferant von Impfstoffen auftritt. Im Gegensatz dazu haben Regionalorganisationen, die von Schwellenländern getragen werden, bislang kaum eine Rolle gespielt. Als Ausnahme ist hier die Afrikanische Union hervorzuheben, die sich durch ihre koordinierende Rolle bei der Bekämpfung der Pandemie auf dem afrikanischen Kontinent bewährt hat.
Trends und Implikationen für die deutsche und die europäische Politik
Die starke Ausdifferenzierung der Schwellenländer hat nicht erst mit der Corona-Pandemie begonnen, doch sie hat durch die Gesundheitskrise deutlich an Fahrt gewonnen. Das gilt insbesondere für China, das seine Stellung festigen oder gar ausbauen konnte, aber auch für jene Staaten, die aufgrund sehr verschiedener Dynamiken im Zuge der Pandemie eher geschwächt wurden. Es steht zu erwarten, dass sich diese Ausdifferenzierung zukünftig fortsetzt.
Treibender Faktor könnte dabei neben Umfang und Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Erholung, der Tragfähigkeit der Staatsverschuldung und der allgemeinen politischen Stabilität vor allem die Verlagerung von Produktionsprozessen sein. Bereits seit Jahren zeichnet sich diesbezüglich in den Industriestaaten eine Tendenz zum »Insourcing« ab: In vielen dieser Länder sehen die Gesellschaften die »ungebremste« Globalisierung aufgrund ökologischer und ethischer Erwägungen zunehmend kritisch. Diese Haltung verknüpft sich mit der Forderung, Produkte wieder »näher am Kunden« zu fertigen.
Die Pandemie dürfte hier zumindest in einigen Wirtschaftsbereichen als Trendverstärker wirken. Bei wichtigen Branchen (wie medizinischem Equipment) werden Industrieländer zusehends auf regionale Wertschöpfungsketten bestehen. Auch Unternehmen werden versuchen, ihre Lieferketten besser vor Unterbrechungen zu schützen, indem sie teilweise wieder in die Staaten der Endmontage verlegt werden.
Dabei werden auch von diesem Prozess keineswegs alle Schwellenländer gleichermaßen betroffen sein. Neben der direkten Rückverlagerung von Produktionsstätten in Industriestaaten könnten Schwellenländer wie Mexiko, Vietnam oder Indien auch von dem Bemühen um eine größere Diversifizierung von Produktionsketten profitieren – möglicherweise in Teilen auch zu Lasten Chinas. Insgesamt ist das Land aufgrund seiner Kostenvorteile, Infrastruktur und seiner schieren Größe als Handelspartner allerdings nicht zu ersetzen.
Die Unterschiedlichkeit der Entwicklungsdynamiken der Schwellenländer verdeutlicht, dass der Nutzen einer entsprechenden Kategorisierung dieser Staaten begrenzt ist. Für Deutschland und seine europäischen Partner empfiehlt sich vielmehr, diese Staaten während und nach der Pandemie differenziert zu betrachten.
Politische Spielräume und Handlungsbedarf ergeben sich dabei für Deutschland vor allem gegenüber denjenigen Staaten, die von der Pandemie besonders betroffen wurden. Sie könnten zwar wirtschaftlich an Bedeutung verlieren, bleiben aber aus deutscher und europäischer Sicht ein wichtiger Bezugspunkt für internationale und regionale Zusammenarbeit. Unter den betreffenden Ländern finden sich viele mittelgroße Volkswirtschaften, die von einem offenen internationalen Handelssystem abhängig und damit, etwa in der Allianz für Multilateralismus, für Deutschland auch Partner sind.
Im Rahmen der Pandemiebekämpfung sollten die Europäer gerade diesen Staaten Angebote machen. So sollte die Frage der Lieferung von Impfstoffen zu bezahlbaren Preisen genutzt werden, um die Beziehungen zu den ärmeren Schwellenländern zu intensivieren. Gelingt es nicht, sich hier als Partner der geschwächten Schwellenländer zu positionieren, besteht das Risiko, dass zwei andere Akteure aus dieser Gruppe in die Lücke stoßen: China und Russland. Beide Staaten unterhalten fortgeschrittene Impfstoffprogramme und bringen sich gegenüber anderen Schwellenländern als Impfstofflieferanten in Stellung.
Vor allem aber werden die ärmeren Schwellenländer zunehmend auf internationale Finanzhilfen, Schuldenmoratorien und Umschuldungen angewiesen sein. Deutschland und seine europäischen Partner haben in den internationalen Finanzinstitutionen und multinationalen Entwicklungsbanken diesbezüglich eine gewichtige Stimme. Zugleich sind sie für viele Schwellenländer bedeutende bilaterale Geber. Gerade wenn es darum geht, größere Hilfsprogramme der internationalen Finanzinstitutionen mit bilateralen Hilfen oder Schuldenerlass zu flankieren, sollte diese Position genutzt werden, um auf die Verbesserung mangelhafter politischer Rahmenbedingungen, auf eine klimaschonende Wirtschaftspolitik und die Einhaltung von Menschenrechten zu drängen.
Susan Bergner / Melanie Müller / Annette Weber / Isabelle Werenfels
Größere Fragilität in Afrika: Gefragt sind Ansätze auf allen Ebenen
Die Covid-19-Pandemie trifft den gesamten afrikanischen Kontinent, denn Nord- und Subsahara-Afrika sind durch gesellschaftliche, wirtschaftliche und religiöse Strukturen, gemeinsame Institutionen und den Einfluss externer Akteure miteinander verflochten. Im Zuge der Pandemie hat die Afrikanische Union (AU) ihre Bemühungen um ein kontinentales Vorgehen intensiviert, die oft durch subregionale Initiativen ergänzt werden. Externe Akteure wie die EU oder Deutschland können und sollten diese Ansätze unterstützen.
Pandemiefolgen: Besonders heikel für Transitionsländer und fragile Demokratien
Zu Beginn der Pandemie wurden bereits vorhandene Dynamiken verstärkt, die mit Gesellschaftsverträgen und politischen Systemen zusammenhängen. Das gilt für autoritäre Staaten ebenso wie für Transitionsländer und junge Demokratien. In fast allen Staaten mit autoritären Tendenzen, wie in Simbabwe oder Algerien, lieferte die Pandemie Regierungen einen Vorwand, Repressionen gegen unliebsame politische Akteure zu verschärfen, die digitale Kontrolle über Gesellschaften auszubauen und unabhängige Medien zu gängeln. Wirtschaftliche Schieflagen wurden infolge von Covid-19 noch dramatischer. Das erschwert den Erfolg von Herrschaftsmodellen, mit denen mangelnde politische Freiheiten durch Chancen auf wirtschaftlichen Aufstieg und durch einen effektiven Staat kompensiert werden sollen, wie etwa in Marokko. Die schon vor der Pandemie existierende enorme soziale Ungleichheit nahm zu, als Lockdowns verhängt wurden, die wirtschaftliche Einbrüche zur Folge hatten.
Äthiopien, Sudan und Tunesien reagierten schnell und entschieden auf Covid-19, setzten auf Abschirmung der Bevölkerung und schlossen Flughäfen und Grenzen. Äthiopien tat sich zudem dadurch hervor, dass es die Verteilung medizinischer Hilfsgüter in der Region und zeitweilig auf dem gesamten Kontinent koordinierte. Sudan und Tunesien können als Staaten gelten, in denen das Vertrauen zwischen Bevölkerung und Regierung erhalten oder gestärkt wurde, etwa durch das Demonstrationsrecht, proaktive Kommunikation und Beteiligung der Bevölkerung an schwierigen Entscheidungen. Dort ist das Vertrauen in die Regierung gewachsen, so dass die Maßnahmen gegen die Pandemie zunächst weitgehend befolgt wurden. Erst in deren weiterem Verlauf schwand die Unterstützung seitens der politischen Opposition, nahmen Querelen unter den Eliten zu. In Tunesien brach die Regierung auseinander, im Sudan bröckelt die Transition, allerdings vorwiegend wegen des wirtschaftlichen Drucks. Diese Ereignisse machten in beiden Ländern die Eindämmung der Pandemie schwieriger.
Auch in Staaten mit demokratischer Tradition wie beispielsweise Südafrika wurden Grundrechte eingeschränkt, und teilweise gingen Sicherheitskräfte gewaltsam gegen die Zivilbevölkerung vor. Unterschiede beim Umgang mit demokratischen Freiheitsrechten zeigten sich gerade in Transitionsländern: Im Sudan etwa wurde im Staatsfernsehen unparteiisch über Proteste berichtet, wohingegen die Regierung in Äthiopien das Internet nach ähnlichen Vorkommnissen für Wochen sperrte.
Der Einbruch der afrikanischen Volkswirtschaften dürfte ebenfalls negative Konsequenzen für die politische Verfasstheit zahlreicher Staaten haben. Schätzungen der Vereinten Nationen (UN) zufolge ist das Bruttoinlandsprodukt in einigen afrikanischen Ländern um bis zu 7,8 Prozent gesunken.1 Die coronabedingte Verschärfung von Wirtschaftskrisen wird voraussichtlich eine mehrjährige Rezession nach sich ziehen und daher mittelfristig ungünstige Auswirkungen auf die Länder haben. Sehr wahrscheinlich werden Armutsrate und soziale Ungleichheit weiter steigen.2 Destabilisierende Proteste und weiter schwindendes Vertrauen in die fragilen Demokratisierungsprozesse dürften die Folge sein.
Für 2021 ist in Afrika mit deutlich mehr politischen Unruhen und Konflikten zu rechnen.
Es hängt von Weitsicht und Präsenz der Reformer in Regierungen und Gesellschaften ab, ob die in einigen Staaten buchstäblich lebensbedrohenden Wirtschaftskrisen mehr demokratische Öffnungen oder aber stärkere Repressionen bewirken werden. Für 2021 ist damit zu rechnen, dass der Druck der Bevölkerungen auf Regierungen massiv steigt und dass deutlich mehr politische Unruhen und Konflikte auftreten. In bestehenden Konflikten, Bürgerkriegen und klimabedingten Verteilungskämpfen spielt Covid-19 als zusätzlicher Faktor eine destabilisierende Rolle. Je weniger die Regierungen in der Lage sind, die Bevölkerung ihrer Länder vor den Folgen der Pandemie zu schützen und sie zu versorgen, desto mehr wächst die Gefahr, dass bewaffnete Gruppierungen Zulauf erhalten, die bessere Lösungen versprechen. Dies ist bereits in Mosambik und in Somalia geschehen. Im Sudan hingegen hat die Ausbreitung von Covid-19 die Bereitschaft der bewaffneten Opposition befördert, sich mit der Regierung zu verständigen.
Kritische Infrastruktur: Vom Kollaps bis hin zu neuen Chancen
Covid-19 hat vor Augen geführt, wie schwach die kritische Infrastruktur in Afrika ist. Nationale Lockdowns und regionale Grenzschließungen hatten punktuelle Versorgungsengpässe zur Folge. In Ostafrika etwa bewirkten Ausgangssperren, die Schließung von Häfen und Flughäfen sowie Mobilitätsbeschränkungen, dass wichtige Lieferketten von Nahrungsmitteln, Ersatzteilen und anderen Gütern behindert oder unterbrochen wurden. Agrarprodukte gelangten nicht mehr auf städtische Märkte, der innerregionale Warenverkehr war durch Grenzschließungen blockiert. Gleiches gilt für das südliche Afrika. Simbabwe und Mosambik litten bereits 2019 unter Nahrungsmittelkrisen, deren Verschärfung schon prognostiziert worden war, bevor sich die Pandemie ausbreitete. In zahlreichen Ländern waren es vor allem die ausgedehnten informellen Sektoren, die von Lockdowns und erliegender lokaler Produktion besonders hart getroffen wurden.
Die Eindämmung der Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass einzelne kritische Infrastrukturen nicht isoliert betrachtet werden können. Nicht nur die Verfügbarkeit von Krankenbetten und Beatmungsgeräten spielt eine entscheidende Rolle, sondern auch die Versorgung der Gesundheitseinrichtungen mit Strom und Wasser und die Anzahl an ausgebildetem Personal. Wegen der unsicheren Stromversorgung konnten in vielen afrikanischen Staaten Beatmungsgeräte nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Gleichzeitig fehlt es an Personal, das in der Lage wäre, solche Geräte zu bedienen und instand zu halten. In Uganda können aus diesem Grund manche Krankenhäuser ihre Kapazitäten nicht ausschöpfen. Generell sind die Kapazität der Verwaltungen und der Zugang zu Dienstleistungen ein wichtiger Indikator für die Leistungsfähigkeit von Staaten.
Auf dem afrikanischen Kontinent gibt es aber auch positive Beispiele dafür, wie vorhandene (Gesundheits-) Infrastruktur erfolgreich genutzt wird, Schwachstellen erkannt und gezielte Gegenmaßnahmen ergriffen werden. So hat die Pandemie auch Chancen eröffnet und unerwartet schnelle Modernisierungsschritte ermöglicht. Das gilt besonders für Staaten mit einem höheren Infrastrukturniveau und der Bereitschaft, flexibel und zielgerichtet zu handeln, um die Gesundheitskrise abzufedern. Marokko und Tunesien haben während der Pandemie die Entbürokratisierung vorangetrieben. Dazu haben sie beispielsweise den informellen Sektor in die Krisenhilfen einbezogen, Akteure im Gesundheitswesen digitalisiert und vernetzt sowie Ausgangssperren mit Hilfe von Apps überwacht. Letzteres ist allerdings eher als zweischneidige Maßnahme zu werten, da sie zugleich autoritäre Tendenzen stärken könnte.
Die Rolle externer Akteure und afrikanisches Engagement
Staatliche Akteure, prominente Geschäftsleute und Philanthropen, regionale und subregionale Organisationen sowie lokale Zivilgesellschaften waren zu Anfang der Pandemie sichtbarer als gewichtige multilaterale Akteure wie die UN oder die EU. Gerade was materielle Unterstützung betrifft, waren nichtstaatliche Akteure im März und April 2020 sehr präsent, während die EU erst im Juni mit finanziellen Beiträgen zur afrikanischen Kontinentalstrategie zur Eindämmung von Covid-19 in Erscheinung trat und Länder wie Deutschland oder Japan erst im Juli folgten. Bei einigen afrikanischen Ländern schwand nicht nur das Vertrauen in die EU, sondern zunächst auch in multilaterale Krisenbewältigung.
Vor allem China versuchte sich zu profilieren, indem es öffentlichkeitswirksam für schnelle Hilfslieferungen sorgte und diese medial in Szene setzte. Doch weder diese Inszenierungen noch der im Juni kurzfristig anberaumte China-Afrika-Gipfel können darüber hinwegtäuschen, dass sich das Chinabild in vielen afrikanischen Staaten gewandelt hat. Animositäten erzeugte China nicht nur durch seinen intransparenten Umgang mit dem Ausbruch von Covid-19. Ebenso unbeliebt machte es sich durch die Ungleichbehandlung von Afrikanerinnen und Afrikanern in China während der Pandemie und dadurch, dass es in den Handelsbeziehungen mit afrikanischen Ländern auf deren einseitige Abhängigkeit aus war. Positiv dagegen werden die Überlegungen der EU zur Entschuldung und Unterstützung des Schuldenmanagements gesehen, denn viele hoch verschuldete Länder in Afrika befürchten, dass die Schuldenspirale sich immer schneller drehen wird.
Besonders wichtig waren aber auch die afrikanischen Initiativen. Materiell besser ausgestattete Staaten des Kontinents, zum Beispiel Marokko, betrieben ungeachtet eigener Infrastrukturdefizite Gesundheitsdiplomatie und lieferten Medikamente sowie medizinische Ausrüstung in zahlreiche afrikanische Länder. Multilaterale Akteure wurden im Laufe der Krise immer besser sichtbar, vor allem die AU mit den Africa Centres for Disease Control and Prevention (CDC) und die übrigen afrikanischen Regionalorganisationen. Die Westafrikanische Gesundheitsorganisation (WAHO) der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) bündelt zusammen mit afrikanischen und externen Partnern Ressourcen für regionale Kapazitäten. Sie bietet ihren Mitgliedstaaten technische wie finanzielle Unterstützung an und kann auf Governance-Strukturen zurückgreifen, die anhand der Erfahrungen mit früheren regionalen Gesundheitskrisen aufgebaut wurden. Das Engagement von Africa CDC, teilweise gefördert von Deutschland und anderen europäischen Staaten, erstreckt sich mittlerweile auf Initiativen zur gemeinsamen Beschaffung von Material, zur kontinentalen Koordinierung von Gesundheitsfachkräften und zur Modellierung von Szenarien.
Mehr Koordination innerhalb der AU lässt sich auch bei den sozioökonomischen Herausforderungen erkennen. Der Vorsitzende der AU-Kommission, Moussa Faki, setzte sich für die Entschuldung afrikanischer Staaten ein, wobei ihm etliche afrikanische Staats- und Regierungschefs den Rücken stärkten. Und obwohl der für Juli geplante Start des Handels im Rahmen der Panafrikanischen Freihandelszone (AfCFTA) wegen Covid-19 zunächst verschoben wurde, hält die AU an dem Vorhaben fest. Sie hofft, dass ein Schnellstart nach dem Ende der Pandemie positive Auswirkungen auf die regionale Wirtschaftsentwicklung haben wird.
Afrikanische Lösungen für Afrika
Die vielfältigen Herausforderungen in Afrika offenbaren, wie wichtig koordiniertes Handeln auf allen Ebenen von lokal bis kontinental ist, um die Pandemie und ihre sozioökonomischen Folgen einzudämmen und afrikanische Staaten widerstandsfähiger gegenüber künftigen Krisen zu machen. Covid-19 und die Folgen haben auf dem afrikanischen Kontinent neue Initiativen und Unterstützung für regionale Kooperation ausgelöst. Externe Akteure sollten solche Initiativen behutsam voranbringen helfen, ohne sie zu vereinnahmen oder mit unrealistischen Anforderungen zu blockieren. Dabei sollten sie an vielversprechende Politikansätze anknüpfen, etwa regionales Gesundheitsmanagement, Infrastrukturentwicklungsprojekte, AfCFTA, Förderung und Ausbau lokaler Wirtschaftsentwicklung sowie regionaler Lieferketten. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten sich zudem dafür einsetzen, dass afrikanische Staaten und Institutionen fortan besser in internationalen Gremien vertreten sind.
Gesundheitsgerechtigkeit
Schon seit einiger Zeit steht die Frage auf der internationalen Tagesordnung, wie Impfstoffe gerecht verteilt werden sollen. Die AU hat sich zum globalen Verteilungsmechanismus »Access to Covid-19 Tools« der WHO bekannt und fördert auf dem Kontinent klinische Studien zu Impfstoffen. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sollten ihre Solidarität in der globalen Impfstoffdebatte unter Beweis stellen. Sie sollten in Zusammenarbeit mit der AU dafür eintreten, dass faire Kriterien für die globale Verteilung aufgestellt werden.
Schuldenmanagement und Abfederung sozioökonomischer Krisen
Für viele afrikanische Staaten wiegen die ökonomischen Auswirkungen der Pandemie besonders schwer. Erste Initiativen internationaler Partner verfolgen das Ziel, die schlimmsten Krisen abzumildern, sie werden aber nicht ausreichen. Zudem ist zu erwarten, dass weitere Staaten in Schuldenkrisen rutschen. Angesichts dringend notwendiger Investitionen in die Infrastruktur könnte es die ohnehin volatile Situation vieler Länder weiter verschärfen, wenn deren staatliche Handlungsfähigkeit durch Verschuldung blockiert wird. Aus diesem Grund wird eine der wichtigsten Aufgaben für internationale Partner in den kommenden Jahren darin bestehen, afrikanischen Ländern und der AU beim Umgang mit der Verschuldungsproblematik zur Seite zu stehen.
Zentral ist dabei die Frage der Verteilungsgerechtigkeit. So sollten frei werdende Mittel dazu verwendet werden, steigende Armut und zunehmende soziale Ungleichheit abzufedern und auf diese Weise dazu beizutragen, dass die sozioökonomischen Differenzen nicht noch größer werden. Programme sollten sich dabei aber nicht nur auf Armutsminderung konzentrieren, sondern auch auf den gleichberechtigten Zugang zu Dienstleistungen und Infrastrukturen.
Verzahnung kritischer Infrastrukturen
Für den Ausbau kritischer Infrastruktur lohnt es sich, nicht nur nationalstaatliche, sondern auch gesellschaftliche Ansätze zu verfolgen, etwa Gesundheitsakteure auf lokaler Ebene einzubinden. Gleichzeitig müssen kritische Infrastrukturen besser ineinandergreifen, um Krisen bewältigen zu können und so die nötige Resilienz aufzubauen. Die Infrastrukturen lassen sich besser verzahnen, wenn vor allem die Digitalisierung ausgeweitet wird. Auch hier bestehen Ansätze innerhalb der AU, und schon jetzt lassen sich »best practices« in afrikanischen Staaten identifizieren. Daraus ergeben sich Anknüpfungspunkte für europäisches Engagement.
Fragile Demokratien und Transitionsgesellschaften besonders unterstützen
Vor allem in Transitionsgesellschaften und jungen Demokratien, die sich mit (Gesundheits-)Krisen konfrontiert sehen, sind Erhaltung und Stärkung oder auch der Verlust von Vertrauen und Legitimität relevant. Zivilgesellschaftliche Gruppierungen und die Akteure der demokratischen Transition betrachten hier gerade europäische Staaten als Verbündete. Europa sollte deshalb Staaten in fragilen Übergangsprozessen so unterstützen, dass sie ihre Bevölkerungen dank solider kritischer Infrastruktur zuverlässig versorgen können.
Steffen Angenendt / Nadine Biehler / Raphael Bossong / Anne Koch
Die Auswirkungen der Covid‑19-Pandemie auf das internationale Wanderungsgeschehen
Die Covid‑19-Pandemie verändert die Triebkräfte von Flucht und Migration nicht grundlegend – wohl aber die politischen und administrativen Rahmenbedingungen von Flucht und Migration sowie die wirtschaftlichen Perspektiven der Betroffenen. Weltweit haben Regierungen die inner- und zwischenstaatliche Mobilität in Form von Einreise- und Aufenthaltsbeschränkungen massiv begrenzt, um die Pandemie einzudämmen.1 Diese erzwungene Immobilisierung hat schwerwiegende wirtschaftliche Folgen, von denen sich viele Länder – vor allem die wirtschaftlich weniger entwickelten – nur sehr langsam erholen werden. Migranten und Menschen auf der Flucht sind davon besonders betroffen, da sie oft nur eingeschränkte Rechte haben, häufiger als Einheimische prekär beschäftigt sind und in Krisensituationen als Erste ihre Arbeitsplätze verlieren. Die Folgen der Immobilisierung gehen weit über Einzelschicksale hinaus und haben gesamtwirtschaftliche Bedeutung: Schätzungen zufolge wurden vor der Pandemie 9,4 Prozent des globalen Sozialprodukts durch Migrantinnen und Migranten erwirtschaftet.2 Dieser Beitrag wird spürbar sinken. So zeichnet sich für das Jahr 2020 bereits ab, dass die globalen Geldtransfers von Migranten, die häufig einen beträchtlichen Teil der Haushaltseinkommen und des Bruttoinlandsprodukts armer Länder ausmachen, um mehr als 20 Prozent zurückgehen werden.3
Aktuelle und künftige Wanderungstrends
Die verstärkten Grenzkontrollen, temporären Grenzschließungen4 und das Aussetzen humanitärer Aufnahme- bzw. Resettlementprogramme5 schlagen sich in einer drastischen Abnahme grenzüberschreitender Wanderungen nieder: Von Februar bis August 2020 lag die Zahl der Menschen auf der Flucht, die im europäischen Mittelmeerraum ankamen, jeden Monat deutlich unter der Vergleichszahl aus den Vorjahren.6 Zudem hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex in der ersten Jahreshälfte 2020 für den europäischen Raum 20 Prozent weniger irreguläre Einreisen als im Vorjahr registriert.7 Entsprechend wurden auch weniger Asyl-Erstanträge gestellt: Laut der Europäischen Asylagentur EASO waren es im August 2020 insgesamt 36 124, während im Vergleichsmonat 2019 noch 51 256 Anträge eingegangen waren.8 Darüber hinaus wurden 2020 bis Oktober 11 899 Menschen im Rahmen von Resettlementprogrammen in sichere Drittstaaten gebracht, 2019 waren es insgesamt 63 726.9 Auch bei regulärer Arbeitsmigration ist derzeit ein Rückgang zu beobachten. Die Nachfrage ist eingebrochen, weil die Arbeitsmigration im Kontext der Pandemie voraussetzungsvoller geworden ist – etwa aufgrund zusätzlicher Pflichten, Auskunft über den Reiseweg zu geben, aufgrund medizinischer Nachweise und erweiterter Gesundheitskontrollen – und weil die Wanderung aus Sicht der Migranten und Migrantinnen mit gesundheitlichen Risiken verbunden sein kann. Ähnliches gilt für die Bildungsmigration.
Erstmals seit dreißig Jahren steigt die globale Armutsquote – damit drohen neue Verteilungskämpfe.
Zahlreiche Migranten sind wegen verlorener Einkommensmöglichkeiten und unsicherer Zukunftsperspektiven in ihre Heimatregionen und Herkunftsländer zurückgekehrt. Solche Rückwanderungen haben nicht nur innerhalb von Ländern, sondern auch zwischen Ländern zugenommen, zum Beispiel aus den Golfstaaten nach Indien, aus Kolumbien nach Venezuela oder aus den USA nach Mexiko.
Für die kommenden Jahre sind vier grundlegende Trends beim Wanderungsgeschehen zu erwarten:
Erstens wird die wirtschaftliche Rezession den Bedarf an Arbeitsmigranten für einen noch nicht absehbaren Zeitraum generell reduzieren. Gleichwohl wird in einigen Wirtschaftssektoren der dringende Arbeitskräftebedarf anhalten und nicht aus dem inländischen Potential gedeckt werden können. Viele Regierungen werden sich weiterhin bemühen, Arbeitskräfte für diese Schlüsselsektoren anzuwerben; die Konkurrenz um diese Migranten und Migrantinnen wird härter werden. Die Pandemie hat – zusätzlich zu dem seit langem bestehenden Bedarf an hoch qualifizierten Arbeitskräften – den akuten Bedarf bei einigen geringer qualifizierten Tätigkeiten aufgezeigt. In der ersten Phase der Pandemie hat die Bundesregierung beispielsweise ermöglicht, dass trotz der strikten Grenzschließungen 80 000 osteuropäische Saisonarbeitskräfte für die Landwirtschaft einreisen konnte.
Zweitens wird die Zahl von Flüchtlingen und Vertriebenen weiter steigen: Laut Weltbank drohen im Jahr 2020 weltweit circa 60 Millionen Menschen in extreme Armut (Einkommen unter 1,90 US-Dollar pro Kopf/ Tag) zu fallen.10 Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schätzt, dass davon insbesondere Menschen in fragilen Kontexten betroffen sein werden; dort könnten circa 26 Millionen Menschen (das sind 43 Prozent der genannten 60 Millionen) in extreme Armut geraten.11 Das heißt, die globale Armutsquote wächst zum ersten Mal seit dreißig Jahren wieder an.12 Ziel 1 der Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, Armut in jeder Form und überall zu beenden, wird somit schwer zu erreichen sein.13 Aller Voraussicht nach werden neue Verteilungskämpfe weitere unfreiwillige Wanderungsbewegungen auslösen.14
Drittens werden irreguläre Wanderungen zunehmen: Werden die legalen Zuwanderungswege weiter reduziert, während der Wanderungsdruck in vielen Herkunftsländern aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage zunimmt, wird es zu mehr irregulären Wanderungen kommen. Zum Teil wird es sich hierbei um einen Nachholeffekt handeln, da Migrationswillige, die in der ersten Jahreshälfte 2020 durch die Mobilitätskontrollen und das Infektionsgeschehen abgeschreckt wurden, sich nun wieder auf den Weg machen. Gerade die wohlhabenden Staaten werden jedoch ihre Instrumente zur Mobilitätskontrolle ausbauen, etwa in Form biometrischer Reisedokumente, vernetzter Datenbanken und anderer Techniken zur Überwachung von Kommunikationsmitteln und Grenzräumen. Angesichts der engmaschigen Kontrollen werden die Betroffenen immer riskantere Routen nutzen und dabei größere Gefahren eingehen, die Nachfrage nach den Diensten professioneller Schlepper wird steigen. Bedeutende Regularisierungsprogramme für undokumentierte Einwanderer – wie etwa im ersten Halbjahr 2020, als in Portugal und Italien Tausende Erntehelfer legalisiert wurden – werden vermutlich die Ausnahme bleiben.
Viertens ist mit einem Anstieg von Binnenwanderungen zu rechnen: Zum einen ist die Binnenmigration für viele, die ihre Heimatorte auf der Suche nach besseren wirtschaftlichen Perspektiven verlassen, die näherliegende Option. Schon vor Beginn der Pandemie gab es mehr als zweieinhalbmal so viele Binnen- wie grenzüberschreitende Migrantinnen und Migranten.15 In Ermangelung legaler Zuwanderungswege und angesichts verschärfter Grenzkontrollen dürfte sich dieses Verhältnis weiter in Richtung Binnenmigration verschieben. Zum anderen gilt Ähnliches für Menschen, die vor gewaltsamen Konflikten fliehen: Weil das Konfliktpotenzial gerade in besonders fragilen Staaten wächst, wird wahrscheinlich auch die Binnenvertreibung zunehmen.
Mögliche Pfade für die migrationspolitische Zusammenarbeit
Die internationale und die europäische Kooperation zu Flucht und Migration haben den Stresstest der Pandemie nicht bestanden. Die Regierungen haben auf die Herausforderungen durch die Pandemie in erster Linie mit unilateralen Maßnahmen reagiert. Im Bereich Migration und Flucht werden die Steuerungsprobleme voraussichtlich größer werden: Auf der einen Seite stehen die erhöhte Schutzbedürftigkeit von Migranten und Menschen auf der Flucht sowie der wachsende Bedarf an wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe, auf der anderen Seite auf absehbare Zeit deutlich weniger staatliche Ressourcen und vermutlich auch ein nachlassender Handlungswille. Zwei Entwicklungspfade sind denkbar:
Einerseits eine fortgesetzte Renationalisierung und Bilateralisierung der europäischen und globalen Migrationspolitik. Getrieben werden könnte eine solche Politik durch rechtspopulistische globalisierungskritische oder nationalistische Bewegungen, wenn diese angesichts der stark geschwächten Arbeitsmärkte und Volkswirtschaften neuen Aufwind erhalten und rassistische Ressentiments gegenüber Migranten mit Blick auf vermeintliche Gesundheitsgefahren schüren. Vereinbarungen mit Herkunfts- und Transitstaaten würden noch stärker auf Grenzsicherung und Kontrolle von Wanderungsbewegungen ausgerichtet, zu Lasten regionaler Kooperationsansätze. Die Zugangswege für Asylsuchende blieben eingeschränkt, lang andauernde Internierungen, Push-backs und erzwungene Rückführungen von Schutzsuchenden in unsichere Herkunfts- und Transitländer könnten zunehmen. Menschen auf der Flucht würden kaum noch internationale Hilfe erhalten, und Regierungen und Zivilgesellschaften in Entwicklungsländern wären bei der Bewältigung von Flucht und Vertreibung weitgehend auf sich allein gestellt. Die derzeit schon unhaltbaren Zustände in vielen Flüchtlingslagern würden sich mit großer Sicherheit verschlechtern, weitere humanitäre Katastrophen wären wahrscheinlich. Auf mittlere Sicht wäre es noch schwieriger als bisher, Migration partnerschaftlich zu steuern und die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu verfolgen.
Andererseits wäre ein gegenläufiger Entwicklungspfad vorstellbar, nämlich eine Stärkung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit anderen Aufnahme-staaten, vor allem aber mit Herkunfts- und Transitländern. Die bestehenden internationalen Rahmenabkommen und Governancestrukturen wurden bislang kaum genutzt, insbesondere die Möglichkeiten des 2018 beschlossenen Globalen Paktes für Migration (GCM). Dieser von 164 Staaten gebilligte Pakt böte zahlreiche Möglichkeiten für zwischenstaatliche Kooperation unter Krisenbedingungen.16 Bislang haben die Unterzeichnerländer sich jedoch nur ansatzweise um eine Umsetzung bemüht. Einen Kooperationsrahmen könnten außerdem bieten: die Abkommen über den Schutz von Arbeitsmigranten der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), internationale Vereinbarungen und Prozesse wie der ebenfalls 2018 verabschiedete Globale Pakt für Flüchtlinge (GCR) oder das Globale Forum für Migration und Entwicklung (GFMD). Ziel wäre es, aufnehmende Länder auch bei der Pandemieeindämmung in deren Gesundheitsbereich zu unterstützen, gemeinsame Vorgehensweisen für Gesundheitskontrollen an Grenzübergängen einzurichten und standardisierte Gesundheits- bzw. Impfnachweise für Migranten zu etablieren.
Grundsätzlich wäre die Gelegenheit für eine engere Kooperation günstig: Der Mangel an ausländischen Arbeitskräften auch in Sektoren, die für die Pandemiebewältigung relevant sind, und die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Infektionsreduzierung könnten neue Möglichkeiten der Integration eröffnen, etwa durch neue Regularisierungsprogramme. Vornehmlich die Notwendigkeit einer flächendeckenden Immunisierung könnte dazu genutzt werden, die Lebenssituation und Verwundbarkeit von Flüchtlingen und Migranten stärker in den Blick zu nehmen. So könnte das Menschenrecht auf Gesundheit in den EU-Mitgliedsländern zunehmend auch Menschen unabhängig vom Aufenthaltsstatus gewährt werden, nicht zuletzt um zu verhindern, dass sich das Virus unter undokumentierten Migrantinnen und Migranten ausbreitet. Internationale Hilfsleistungen für die Verteilung eines Covid‑19-Impfstoffes könnten damit verbunden werden, die Situation in humanitären Einrichtungen für Menschen auf der Flucht zu stabilisieren, indem zum Beispiel medizinisches Personal in Flüchtlingslagern bei Impfkampagnen bevorzugt wird.17
Handlungsmöglichkeiten
Die skizzierten Entwicklungspfade sind nicht naturgegeben, vielmehr hängen sie von politischer Entscheidung und Gestaltung ab. Da zwischenzeitlich die Zuwanderungszahlen gesunken sind, außerdem Grenzschließungen und harte Abschreckung wirksamer zu sein scheinen als erwartet, ist zumindest in Europa die Versuchung groß, unilaterale Wege zu beschreiten. Doch die Kosten dafür wären hoch: Mittel- und langfristig wäre der wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Bedarf an einer wirksamen, kohärenten und entwicklungsfördernden Migrationspolitik nicht zu erfüllen, und auch eine an menschenrechtlichen Grundsätzen orientierte Flüchtlingspolitik wäre nicht zu erreichen.
Im Einklang mit der Ausrichtung der deutschen Politik auf multilaterale Ansätze sollte die Bundesregierung daher alles vermeiden, was nationalen Alleingängen weiteren Vorschub leisten könnte. Oberstes Ziel sollte weiterhin sein, die multilaterale Zusammenarbeit bei Flucht und Migration zu stärken, um auf dem oben skizzierten Entwicklungspfad der internationalen Kooperation voranzukommen. Die Bundesregierung sollte sich der Aushöhlung des internationalen Asylregimes und der Verletzung völkerrechtlicher Pflichten entgegenstellen. Auch in Zukunft sollte sie sich trotz aller Widerstände für eine europäische Verantwortung und Lastenteilung bei der Bewältigung der Fluchtbewegungen einsetzen. Schließlich sollte sie Mittel mobilisieren, um im EU-Rahmen Lösungen für Menschen auf der Flucht und in den Erstaufnahmeländern zu finden, um Zugangswege für Asylsuchende offen zu halten und um die Resettlementprogramme für Flüchtlinge wieder aufzunehmen und auszubauen. Hierbei sollte die Bundesregierung darauf drängen, die Potentiale des im September 2020 von der EU-Kommission vorgeschlagenen Pakets für Asyl und Migration18 auszuschöpfen; eine Fokussierung auf Abschreckung sollte allerdings verhindert werden.
Im Migrationsbereich gilt es, die künftigen strukturellen Bedarfe (vor allem an Gesundheitsfachkräften) zu identifizieren und eine vorausschauende Migrationspolitik in Partnerschaft mit den Herkunftsländern zu entwickeln. Dazu gehören innovative Formen der Zusammenarbeit, zum Beispiel transnationale Ausbildungspartnerschaften, ein erweiterter Zugang zu (Aus-)Bildungsvisa sowie »talent partnerships« oder »talent pools«. Dabei wird es mittelfristig nicht ausreichen, bei der Rekrutierung vorrangig auf die EU- bzw. die Staaten der Europäischen Freihandelszone (EFTA) zu setzen: Künftig wird ein großer Anteil der benötigten qualifizierten Arbeitskräfte aus Drittstaaten stammen müssen.
Die anhaltende Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Covid‑19-Pandemie lässt keine zuverlässigen Aussagen darüber zu, welche langfristigen Auswirkungen die Pandemie auf Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und die internationale Ordnung haben wird. Der Verlauf bleibt abhängig von der staatlichen Handlungsfähigkeit, was ein effektives Gesundheitskrisenmanagement angeht sowie die Abfederung unerwünschter sozialer und ökonomischer Nebenwirkungen der eingeführten Gesundheitsschutzmaßnahmen. Eine Rolle spielen ferner die Ergebnisse der internationalen Zusammenarbeit, die die Resilienz von Gesundheitssystemen stärken soll. Impfstoffe gelten als ein effektives Mittel zur Eindämmung von Infektionskrankheiten. Sollte die Entwicklung eines wirksamen und sicheren Covid‑19-Impfstoffes erfolgreich sein, muss dieser in ausreichender Menge schnell produziert und gerecht verteilt werden.
Im weiteren Verlauf der Covid‑19-Pandemie sind zwei Szenarien für die globale Gesundheitspolitik und insbesondere für die Verteilung eines Impfstoffes denkbar.
Szenario 1: Globales Handeln in alten Mustern
Trotz massiver Anstrengungen und hohem Mittelaufwand von Industriestaaten und privaten Akteuren gelingt es erst im Frühjahr 2021, einen wirksamen und sicheren Impfstoff gegen SARS-CoV‑2 zu entwickeln. Nichtpharmazeutische Gesundheitsschutzmaßnahmen wie Abstands- und Hygieneregeln sowie Früherkennung durch effektive Test- und Meldestrategien blieben bis dahin das politische Mittel der Wahl. Die Maßnahmen erforderten von den Gesellschaften eine hohe Akzeptanz und Durchhaltevermögen; Kontaktbeschränkungen und der ständige Nachweis eines negativen Testergebnisses bestimmten den Alltag auf allen Ebenen.
Als die neue US-Administration unter Joseph Biden als eine der ersten politischen Handlungen den Verbleib der USA in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verkündete, atmete die »Global Health Community« auf. Jedoch ist damit die Krise der globalen Gesundheitsgovernance nicht überwunden. Andere WHO-Mitgliedstaaten, etwa Deutschland, Japan und Frankreich, aber auch die Europäische Union (EU) haben wegen des Schocks eines möglichen Austritts der USA eigene Reformvorschläge und Ideen erarbeitet, wie sich die Sonderorganisation für Gesundheit in Zukunft aufstellen könnte. Diese Länder erheben nun einen Führungsanspruch, den zuvor die USA innehatten. Die USA, stark betroffen von der Covid‑19-Pandemie im eigenen Land, priorisieren weiterhin Gesundheitssicherheitsprogramme der WHO. Dazu gehören Frühwarn- und Monitoringsysteme, Polio-Programme im Nahen und Mittleren Osten sowie Biosicherheitsprojekte vor allem in Regionen mit schmelzenden Permafrostböden. Andere, drängende WHO-Prioritäten wie die flächendeckende allgemeine Gesundheitsversorgung (Universal Health Coverage, UHC)1 werden von den USA nicht weiterverfolgt.
In den G-Formaten schlägt Präsident Biden gegenüber China und den chinesischen Versäumnissen zu Beginn der Pandemie zwar einen anderen Ton an, bleibt politisch aber auf der gleichen Linie wie sein Vorgänger Donald Trump. Biden fordert eine lückenlose Aufklärung sowie künftig die Möglichkeit, unabhängige Expertinnen und Experten der WHO in Länder zu entsenden, in denen der Verdacht auf ein Ausbruchsgeschehen besteht. China hat währenddessen die Gesundheitskontrollmaßnahmen hart durchgesetzt und es geschafft, das Infektionsgeschehen im eigenen Land dauerhaft einzudämmen. International wirbt es mit der Effektivität seines politischen Handelns.
Bei der 74. Weltgesundheitsversammlung im Mai 2021 können sich die Mitgliedstaaten auf keine umfassende WHO-Reform einigen – zu unterschiedlich sind die Reformvorschläge Europas und der USA. Die USA, Brasilien, Russland und China lehnen es ab, über Sanktionsmöglichkeiten der WHO bei Nichtbefolgung ihrer Empfehlungen und Regelwerke zu verhandeln. Brasilien kündigt seinen Austritt aus der WHO an. Das Programm für Gesundheitskrisen erhält zwar dank freiwilliger Mittel einzelner Staaten eine kurzfristig gesicherte Finanzierung, indes gilt dies keineswegs für das priorisierte Arbeitspaket zur UHC.
Schon früh in der Pandemie haben Deutschland, Frankreich, Japan und China für einen potentiellen Impfstoff das Narrativ des globalen öffentlichen Gutes geprägt. Der gleichberechtigte Zugang zu Impfstoffen ist von der Europäischen Kommission als Zielvorgabe übernommen und von Entwicklungsländern, Nichtregierungsorganisationen und der WHO sehr begrüßt worden. Die EU unterstützt die Bemühungen der WHO, mit Hilfe der Multi-Akteurs-Partnerschaft (Access to COVID‑19 Tools [ACT] Accelerator)2 einen Mechanismus für die gerechte Verteilung eines Impfstoffs (COVAX)3 zu erreichen. Doch wird dieses Versprechen nicht eingehalten.
Einerseits stehen aufgrund der weltweiten und gleichzeitigen Nachfrage nach einem Impfstoff vor allem diejenigen Staaten unter Druck, die über leistungsfähige Forschungs- und Entwicklungskapazitäten verfügen. Solange Impfstoffe nicht in ausreichender Menge produziert werden können – und dürfen –, ist keine gerechte Verteilung möglich. Staaten mit eigener Produktionskapazität sind nicht willens, alle Mittel des internationalen Patentsystems auszuspielen. So werden Zwangslizenzen bisher nicht dafür verwendet, die Produktion der Impfdosen an möglichst vielen Standorten hochzufahren. Nur die Unternehmen, die den Impfstoff selbst entwickelt haben, produzieren ihn auch. Als Folge stehen geeignete Produktionsstandorte still, zum Beispiel in Brasilien und Indien.
Die EU-Mitgliedstaaten ziehen es vor, die Lizenzierung neuer medizinischer Produkte weiterhin auf nationaler Ebene zu kontrollieren, weshalb sie die traditionelle freiwillige Lizenzierung wählen. Hierbei macht die eigene Pharmaindustrie ihren Einfluss geltend, die verhindern will, dass durch eine Veränderung der Patentvergabe ein Präzedenzfall geschaffen wird. Sie befürchtet, dies könne Debatten über Patente für Behandlungsmethoden anderer Krankheiten die Tür öffnen und zu Preisminderung bzw. Gewinneinbußen führen. Selbst massive Kritik hat kein Umdenken hinsichtlich Patentregelungen bewirkt; beispielsweise fordern Ärzte ohne Grenzen und Oxfam Zwangslizenzen, um Preise für Gesundheitsgüter zu senken. Afrikanische Staatsoberhäupter äußerten in offenen Briefen die Bitte um Technologietransfer und einen Covid‑19-Patentpool – sie blieb ungehört.
Andererseits übernehmen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Japan Teile der Finanzierung von Impfstoffentwicklung, ‑produktion und ‑verteilung für die Länder des Globalen Südens, wie es COVAX vorsieht. Die Impfstoffdosen für ihre eigenen Bevölkerungen beziehen sie allerdings direkt von den Pharma- und Biotechnologieunternehmen, da sie Abnahmegarantien und Vorkaufsrechte verhandelt haben.
Der in Kooperation zwischen dem deutschen Biotechnologieunternehmen BioNTech und dem US-amerikanischen Pharmakonzern Pfizer entwickelte Impfstoff wird im Sommer 2021 in den USA und in Deutschland zugelassen. Die Verhandlungen dieser Unternehmen mit der WHO, der Impfallianz Gavi und der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) scheitern mit der Folge, dass dieser Impfstoff vertraglich nicht Teil von COVAX wird. Mit diesem ersten zugelassenen, sicheren und wirksamen Impfstoff werden daher zuerst die US-amerikanische und die deutsche Bevölkerung geimpft sowie die Bevölkerungen jener Länder, die sich bei diesen Unternehmen Vorkaufsrechte gesichert und Abnahmegarantien vertraglich geregelt haben.
Die EU gerät in eine heikle Lage: Sie muss entscheiden zwischen etablierter Praxis, Wirtschaftsinteressen und globaler Solidarität.
Deutschland als ein Staat, der in der Außenpolitik intensiv für den Impfstoff als globales öffentliches Gut warb, verteilt ihn nun vorrangig an die eigene Bevölkerung. Die EU gerät in die unbequeme Lage, dass sie entscheiden muss zwischen etablierter Praxis, Wirtschaftsinteressen ihrer Mitgliedstaaten und globaler Solidarität. Es kommt zu Verteilungskonflikten zwischen den EU-Staaten, den USA und Großbritannien, die in transatlantischen Handelsbeschränkungen münden. Die Afrikanische Union (AU) kritisiert das Vorgehen der EU und ihrer Mitgliedstaaten heftig und sieht das Versprechen globaler Solidarität gebrochen. Die Hoffnung, mittels freiwilliger Lizenzierung den Zugang zu Impfstoffen auch für ärmere Länder zu gewährleisten, wird enttäuscht. Appelle der WHO an globale Solidarität werden ignoriert, wodurch sie in ihrer Rolle geschwächt wird. Schließlich tritt Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus nach großem Druck afrikanischer Staaten von seinem Amt zurück.
Die traditionelle Marktlogik und die staatliche Kaufkraft bestimmen über den Zugang zu einem Impfstoff, nicht aber Kriterien wie der Grad an Betroffenheit, Vulnerabilitäten des Gesundheitssystems oder die Fähigkeit, Konflikte zu bewältigen. Die vielversprechende Impfstoffsäule des ACT-Accelerators, COVAX, die die Versorgung mit Impfstoffen beschleunigen sollte, verfehlt damit ihren Zweck. Alte Vorgehensweisen dominieren, erst spät wird der Überschuss an lebensnotwendigen Gesundheitsgütern Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen über öffentlich-private Partnerschaften gespendet. Auf diese Weise manifestieren sich bestehende internationale Abhängigkeiten und Machtverhältnisse.
Durch die etablierte Praxis der Vergabe von Rechten geistigen Eigentums wird zwar die Pharmaindustrie zufriedengestellt, jedoch wird die Zahl der Impfstoffproduzenten künstlich begrenzt. Dies hat zur Folge, dass die benötigte Menge an Impfstoffdosen nicht schnell genug produziert werden kann, um die globale Nachfrage bei steigenden Covid‑19-Fallzahlen zu decken. Während in reichen Staaten innerhalb weniger Monate mehr als 50 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, haben Staaten südlich der Sahara keinen Zugang zu einem Impfstoff.
Szenario 2: Gerechter Zugang
Die Einhaltung von Kontaktbeschränkungen, neue Frühwarnsysteme und effizientere Test- und Meldestrategien führen dazu, dass die Covid‑19-Fallzahlen in der EU und in vielen anderen Staaten auf einem akzeptablen Niveau gehalten werden können. Der internationale Reise- und Handelsverkehr ist dadurch weitgehend möglich.
Die vom ehemaligen US-Präsidenten Trump ausgelöste Krise der globalen Gesundheitsgovernance endet, als die Biden-Administration den Verbleib der USA in der WHO erklärt. Die 74. Weltgesundheitsversammlung im Mai 2021 nimmt die Empfehlungen des Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response4 größtenteils an. Es wurde beauftragt, die weltweite Krisenbewältigung und die Rolle der WHO zu begutachten. Auch die von Frankreich und Deutschland eingebrachten Reformvorschläge finden Unterstützung, sogar bei der Biden-Regierung. So verdoppeln und flexibilisieren die WHO-Mitgliedstaaten ihre Pflichtbeiträge an die Organisation und stärken das Mandat des WHO-Programms für Gesundheitskrisen. Die Internationalen Gesundheitsvorschriften (International Health Regulations, IHR),5 das bindende Regelwerk für die internationale Infektionskontrolle, werden reformiert. Die Mitgliedstaaten beschließen unangekündigte Inspektionen nationaler Gesundheitssysteme und Ausbruchsgeschehen. So kann die WHO bei Verdacht auf ein Ausbruchsgeschehen ohne Ankündigung Fachleute in Mitgliedsländer entsenden.
Sanktionsmöglichkeiten seitens der WHO bei Nichtbefolgung von WHO-Regeln lehnen die Mitglieder jedoch weiterhin ab. Zu sehr befürchten China, Russland und die USA die Verletzung ihrer staatlichen Souveränität. Daher gewinnt die WHO zwar in einzelnen Programmen an Handlungsmöglichkeiten, aber nicht an Durchschlagskraft. Die Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Mitgliedstaaten an die WHO und ihrer tatsächlichen Leistungsfähigkeit bleibt also bestehen. Dennoch können sich europäische Konzepte in WHO-Gremien und ‑Resolutionen durchsetzen: Sie zielen darauf ab, öffentliche Gesundheitssysteme auszubauen und sie bedarfsgerecht und resilient zu gestalten, außerdem Gesundheit als öffentliches Gut sowie die Rolle der WHO als Wissenschaftsorganisation zu stärken.
Nachdem Deutschland und Kanada Zwangslizenzen für essentielle Impfstoffe und Behandlungsmethoden dauerhaft gesetzlich verankert haben, ziehen Frankreich, Italien und Großbritannien nach. In der EU werden neue Modelle und Rahmenbedingungen in der Gesundheitsforschung und der Entwicklung von Medizinprodukten diskutiert und erprobt, die sich nicht auf das etablierte Verfahren des Patentschutzes stützen. Um künftig hohe Preise für lebensnotwendige Gesundheitsgüter zu vermeiden, werden die Kosten für Forschung und Entwicklung von den Endpreisen essentieller Impfstoffe und Medikamente entkoppelt (Delinkage). Forschung und Entwicklung werden durch Forschungsprämien, öffentlich-private Produktionspartnerschaften und sozialverträgliche Lizenzierung so finanziert, dass die Verkaufspreise nur geringfügig über den Herstellungskosten liegen und die Produkte infolgedessen erschwinglicher werden.
Nach China und den EU-Mitgliedstaaten, die sich bereits seit Sommer 2020 an COVAX beteiligen, treten nun auch die USA bei. All diese Staaten haben gemeinsam entschieden, über die Plattform Impfstoffdosen sowohl für die eigene Bevölkerung zu beziehen als auch für Länder mit weniger Finanzspielraum mitzufinanzieren. Für humanitäre Impfstoffkontingente wurde ebenfalls gesorgt. Zum Jahreswechsel 2020/21 wird der von BioNTech und Pfizer entwickelte Covid‑19-Impfstoff als erster Impfstoff gegen SARS-CoV‑2 zugelassen. Als Teil des von der WHO koordinierten ACT-Accelerators und seiner Impfstoffsäule COVAX6 erfolgt die weltweite Verteilung über einen durch COVAX festgelegten und gerechten Schlüssel.
Aufgrund der Verwendung von Patentpools und Technologietransfers im Rahmen von COVAX sind Produktionsstandorte in den USA, Japan, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Indien in der Lage, den Impfstoff in großen Mengen schnell nachzuproduzieren. In Ländern mit schwachen Gesundheitssystemen wurde die Zeit genutzt, um Infrastruktur dort zu verbessern und zu schützen, wo eine sichere und gekühlte Verteilung des Impfstoffes besonders schwierig ist. Gleichberechtigt erhalten alle Länder, die COVAX beigetreten sind, im ersten Schritt für 3 Prozent ihrer Bevölkerung den BioNTech/Pfizer-Impfstoff.
Um weltweit die gerechte Verteilung zu kontrollieren und mögliche Verteilungskonflikte zu moderieren, haben die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen (P5) mit Unterstützung der WHO die neue Kontrollinstanz »Access2Health« geschaffen. Die italienische Präsidentschaft initiiert im Rahmen der G20 zusammen mit der EU, der AU und der WHO das Programm »Resilient One Health Systems – Achieving SDG 3«7. Hochrangige Politikerinnen und Politiker führen regelmäßig Simulationen zur Reaktion auf Gesundheitskrisen durch, etwa während der Weltgesundheitsversammlung und der Gipfeltreffen der G20- und G7-Staaten.
Das Versprechen, einen Impfstoff als globales öffentliches Gut auf der ganzen Welt gerecht und zügig zu verteilen, wird eingelöst mit Hilfe einer breiten Allianz von Staaten mit und ohne eigene Produktionskapazitäten sowie mit tatkräftiger Unterstützung durch die EU. Am 21. November 2022 verkündet der wiedergewählte WHO-Generaldirektor Dr. Tedros, 65 Prozent der Weltbevölkerung seien nun gegen das neuartige Coronavirus geimpft.
Empfehlungen
Um den Zugang zu einem Impfstoff als globales öffentliches Gut zu gestalten, müssen jetzt die Weichen gestellt, die passenden Instrumente gewählt und weiterentwickelt werden. Dazu zählen unter anderem:
-
Die Stärkung der WHO sollte für die deutsche globale Gesundheitspolitik oberste Priorität haben. Notwendig sind dafür die Begleitung des IHR-Reformprozesses, die Bereitschaft, die Pflichtbeiträge zu erhöhen, sowie weitere Entsendung und Nachwuchsförderung.
-
Um durch die COVAX-Plattform einen gerechten Zugang sicherzustellen und Solidarität zu beweisen, könnte Deutschland erstens die eigenen bereits verhandelten Abnahmegarantien und gesicherten Vorkaufsrechte mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen in die COVAX-Plattform überführen, zweitens bei den G20 für ein vergleichbares Verhalten werben.
-
Eine Sonderinitiative, zum Beispiel in Form einer »Coalition for Resilient Health Systems – Build Back Better after Covid‑19«, könnte zusammen mit der EU und der WHO Gesundheitssysteme umfassend stärken.
-
Bei allen Entscheidungen zur Impfstoffentwicklung, ‑beschaffung und ‑verteilung sollte geprüft werden, ob die Anschlussfähigkeit an eine europäische und globale Verteilung gegeben ist.8
Marianne Beisheim / Susanne Dröge
Klar zur Wende? Internationale Klima- und Nachhaltigkeitspolitik gestalten
Die Covid-19-Pandemie bremst die Klima- und Nachhaltigkeitspolitik merklich. Obwohl die Folgen des Klimawandels, beispielsweise die Waldbrände in den USA oder Dürren in Europa, weiterhin eine hohe mediale Präsenz haben, sind die Verhandlungen zur Umsetzung des Pariser Abkommens ins Stocken geraten. Die Gespräche über das Regelbuch des globalen Klimaabkommens sollen auf der 26. Vertragsstaatenkonferenz (COP26) abgeschlossen werden, die aber erst mit einem Jahr Verspätung stattfinden kann. Ein Blick auf die Daten zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) macht deutlich, dass es teils noch langsamer vorangeht (beispielsweise bei SDG 4: Hochwertige Bildung) und auch Rückschritte zu verzeichnen sind (SDG 1 Keine Armut, SDG2: Kein Hunger). Auf politischer Ebene zeigt das Scheitern der Verhandlungen über eine Ministererklärung des Hochrangigen Politischen Forums für nachhaltige Entwicklung (HLPF) im Juli 2020, dass Begriffe wie »Green Recovery« oder »Decarbonization« aktuell nicht konsensfähig sind.
Dieses »Lahmen« der internationalen Klima- und Nachhaltigkeitspolitik ist fatal, müssen doch für das als kritisch deklarierte Zieljahr 2030 zügig die Weichen gestellt werden. Dies gilt insbesondere für die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung und die SDGs, aber auch für die Klimapläne der Europäischen Union (EU). Die Bundesregierung und die EU müssten also schleunigst nachlegen, um die selbstgesteckten Ziele bis 2030 zu erreichen und die dazu erforderliche internationale Kooperation voranzubringen.
Zwei Szenarien: Die Welt im Jahr 2030
Anhand von zwei Szenarien für 2030 lässt sich illustrieren, wie es aussehen könnte, wenn entweder »Alle an Deck« kämen, um sich für wirksamem Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung einzusetzen, oder aber Deutschland und die EU »Allein im Sturm« stünden.
Szenario »Alle an Deck« – Im Jahr 2030 sind viele SDGs nahezu erreicht. Beim Klimaschutz gibt es große Fortschritte, bis auf wenige Ausnahmen berichten die UN-Mitgliedstaaten regelmäßig, wie im Pariser Abkommen vereinbart, und bessern ihre nationalen Ziele nach. Wichtiger Wendepunkt war die Initiative, die US-Präsident Joe Biden im Jahr 2021 zur Stärkung der multilateralen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Pandemie gestartet hatte. Bei vielen UN-Mitgliedstaaten hatte sein Vorstoß die Erkenntnis gefestigt, dass sie letztlich mehr davon profitieren werden, wenn sie mit anderen Staaten in die gleiche Richtung arbeiten. In der Folge setzten sie sich für eine bessere Koordination von Politiken und eine ausreichende Finanzierung multilateraler Anstrengungen ein.
Die Europäische Union konnte in diesem positiven Umfeld Kernelemente ihres über 50 Projekte umfassenden Green Deals erfolgreich umsetzen.1 Das Ziel von minus 55 Prozent Treibhausgasemissionen wird erreicht. Darüber hinaus realisierte die EU in der vergangenen Dekade Pilotprojekte, die die Machbarkeit des für 2050 ausgerufenen Ziels der Klimaneutralität erweisen. So ist es inzwischen möglich, »grünen« (klimaneutralen) Stahl zu wettbewerbsfähigen Produktionskosten herzustellen, ein Resultat der EU-weiten Wasserstoffoffensive.2 Zudem ist es gängige Praxis, dass die Union und ihre wichtigen Handelspartner den jeweiligen Marktzugang für nachhaltig und klimafreundlich produzierte Waren erleichtern. Klimafreundliches Planen und Produzieren hat sich in den Geschäftsmodellen der Finanzinstitute und des überwiegenden Teils der Unternehmen etabliert. Die Kreislaufwirtschaft hat einen Anteil von über 50 Prozent am Ressourcenumsatz erreicht. Die Investitionsstimmung in der EU für weitere umwelt- und klimaschonende Projekte ist positiv, da der Markt dafür ständig wächst. Erwartet wird, dass die EU über Technologien zur Entnahme von CO2 ihre weiteren Klimaziele sogar übererfüllen könnte.
Szenario 2 »Allein im Sturm« – Im Jahr 2030 sind die SDGs und die Prozesse des Pariser Abkommens nur noch Makulatur. Die UN ist schwächer denn je. Aufgrund ihrer inneren politischen Spaltung sind die USA weitgehend mit sich selbst beschäftigt, die politische Aufmerksamkeit für globale Güter ist gering.3 Andere Mitgliedstaaten konnten oder wollten den damit verbundenen Ressourcenverlust nicht kompensieren. Auch in Europa erschwerte es die anhaltende interne Uneinigkeit der EU, in New York positive Impulse zu setzen. Die in der 2030-Agenda und im Pariser Abkommen festgelegten Prozesse werden nur noch von wenigen Staaten befolgt. Die großen Verschmutzerstaaten können ihre nationalen Interessen verfolgen, ohne dass sie Widerstände erwarten müssen. 2021 und 2022 enttäuschte die EU viele Entwicklungsländer, weil sie ihnen keine zusätzliche Unterstützung für die Umsetzung der Ziele gewährte. Angesichts der massiven Vertrauenskrise scheiterten auch alle Anläufe, Post-2030-Zielkataloge zu etablieren. Das Klimaregime ist 2030 vor allem ein Nebenschauplatz der verschärften Verteilungskämpfe um Ressourcen. Einige Länder hatten sich in der letzten Dekade an plurilateralen Club-Lösungen versucht, aber jenseits von Absichtserklärungen war keine kritische Masse handlungswilliger und ‑fähiger Staaten zusammengekommen.
Die EU hält zwar am Green Deal fest, aber wegen der fehlenden internationalen Hebelwirkung sind die Fortschritte bescheiden. Auch innerhalb Europas kann der Green Deal kaum Erfolge verbuchen. Zentrale Vorhaben sind in Anbetracht leerer Kassen vertagt, unter anderem die EU-weite Wasserstoffoffensive. Das Vertrauen in eine EU-weite Solidarität ist gering. Die Energiepolitik ist geopolitisch determiniert, viele EU-Staaten setzen auf althergebrachte Konzepte der Versorgungssicherheit. Die Entkoppelungs- und Autarkiebestrebungen wichtiger Handelspartner haben dafür gesorgt, dass den EU-Unternehmen überregionale Marktzugänge fehlen. Aus Wettbewerbsgründen liegt das Vorhaben auf Eis, die CO2-Preise stetig steigen zu lassen. Aufgrund der Entkopplung von wichtigen Rohstoffmärkten hat die Kreislaufwirtschaft zwar einen Anteil von gut 30 Prozent am Ressourcenumsatz erreicht, international nicht nachhaltige Lieferketten werden aber in Kauf genommen. Die Investitionsstimmung in der EU für weitere umwelt- und klimaschonende Projekte ist negativ.
Jenseits dessen wäre ein »Business As Usual«-Szenario denkbar, bei dem Deutschland und die EU ab 2021 zwar keine zusätzlichen wirkmächtigen Maßnahmen ergreifen würden, aber auch nicht hinter die bisherigen Pläne zurückfielen. Dies würde nicht ausreichen, um längerfristige Impulse in Richtung USA und China zu senden oder auch zahlreiche weitere Länder mitzuziehen. Was also könnte die Bundesregierung 2021 tun, um die deutschen und EU-weiten Vorhaben in der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik so zu fördern, dass international möglichst viele mit an Deck kommen? Und welche Signale sollten vermieden werden, damit Deutschland und die EU nicht »allein im Sturm« manövrieren müssen?
Hebel für eine nachhaltige Wirtschaftsordnung ansetzen
Die internationale Lage wird 2021 weiterhin von pandemiebedingten Unsicherheiten geprägt sein. Wegen der Folgen der Gesundheitskrise wird die Agenda von kurzfristigen politischen Zwängen beherrscht; 2021 sollte die Bundesregierung aber wieder stärker Kosten-Nutzen-Analysen mit einem längeren Zeithorizont in den Blick nehmen. Rufe nach einer resilienten, sozialverträglichen und die Versorgung sichernden Wirtschaftsordnung wurden bereits laut. Die Klima- und Nachhaltigkeitsagenden enthalten wichtige Bausteine für eine solche Ordnung. Vorhaben des Green Deal zielen etwa darauf, den Umgang mit natürlichen Ressourcen auf Kreisläufe auszurichten, was nicht nur die Umwelt weniger belasten würde, sondern auch sozialverträglicher und krisenfester wäre. Auch das Lieferkettengesetz sollte entsprechend weiterentwickelt werden. Die Wasserstoffstrategien der EU und Deutschlands könnten als Vorzeigeprojekte internationale Signalwirkung entfalten, wenn es gelänge, diese im Jahr 2021 schneller umzusetzen. Hierfür sollte eine Zusammenarbeit mit Angebotsländern vorangetrieben werden, bei der die klimafreundliche Erzeugung von Wasserstoff und dessen Transport im Mittelpunkt stehen. Dies könnte unter anderem mit Hilfe langfristiger Verträge gelingen.4
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halten ambitionierte, rasche und kohärente Politikwenden für unumgänglich, sollen die Klima- und Nachhaltigkeitsziele erreicht werden.5 Die Bundesregierung und die im Wahlkampf stehenden Parteien sollten 2021 dem Drängen widerstehen, beim Umgang mit den Folgen der Pandemie auf vermeintlich »bewährte« Silo-Politiken zurückzufallen oder auf Wachstum durch Ressourcenverbrauch zu setzen. Stattdessen sollten die Mittel der Corona-Hilfspakete konsequent mit Klima- und Nachhaltigkeitszielen verknüpft werden. Dies würde die intergenerationale Gerechtigkeit erhöhen, denn so würde die Generation, denen diese Schulden aufgebürdet werden, von den Investitionen auch profitieren. Auf die Bedeutung der intragenerationalen Gerechtigkeit inmitten der Pandemie hat der UN-Generalsekretär hingewiesen: Wir säßen eben nicht in einem Boot – zwar trieben wir alle auf demselben Meer, aber einige in Superjachten, während andere sich an schwimmende Trümmer klammern müssten.
In New York überzeugen
Die Bundesregierung sollte 2021 deutlich stärkere Akzente setzen, um international als Zugpferd in der Klima-und Nachhaltigkeitspolitik glaubwürdig zu sein. Besonders wichtig ist dies im Juli, wenn Deutschland den zweiten Bericht zur Umsetzung der SDGs beim HLPF in New York präsentieren wird.6 Dies ist eine Chance, die internationale Debatte über Wege aus der Krise mitzugestalten. Das wird aber nur Aussicht auf Erfolg haben, wenn Deutschland auf überzeugende eigene Anstrengungen verweisen kann. Dafür müsste es der Bundesregierung gelingen, bei der Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2021 Maßnahmenpakete zu schnüren, die eine entschiedene Transformation hin zu nachhaltiger Entwicklung ermöglichen und sowohl den Herausforderungen gerecht werden als auch die Folgen und Lehren aus der Pandemie schlüssig aufnehmen. Im Entwurf der Strategie werden für Deutschland sechs Transformationsbereiche identifiziert, in denen Fortschritte besonders relevant seien, nämlich Energiewende und Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges Bauen und Verkehrswende, nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme, schadstofffreie Umwelt und schließlich menschliches Wohlbefinden, Fähigkeiten und soziale Gerechtigkeit. Die bislang genannten Maßnahmen sind jedoch nicht geeignet, kohärente Wendemanöver mit internationaler Signalwirkung zu vollziehen.
Die Bundesregierung könnte auch ausloten, welche Transformationsbereiche bei ihren internationalen Partnern auf Interesse stoßen, um dann um Verbündete für gemeinsame Initiativen zu werben. Grundsätzlich sollten solche Koalitionen der Willigen mit Angeboten an die Partner verbunden sein, wie etwa eine Kooperation bei technologischen Innovationen oder ein privilegierter Marktzugang. Deutschland sollte sich gezielt dafür einsetzen, entsprechende strategische Überlegungen in der EU-Koordination in New York aufs Tapet zu bringen und zu fördern, um die von der UN ausgerufene Aktionsdekade rasch mit Leben zu erfüllen.
Klimadiplomatie hochfahren
Die pandemiebedingten finanziellen Unsicherheiten werden 2021 ein großes Hemmnis sein bei allen Bemühungen, die Weichen in der Klimapolitik auf Kooperation zu stellen. Auch deshalb ist es notwendig, dass die britische und italienische Leitung der COP26 in Glasgow und des G7- (Großbritannien) bzw. G20-Gipfels (Italien) durchsetzungsstark auftritt. Deutschland und die EU sollten ihre Klimadiplomatie noch intensiver betreiben und zusammen mit Großbritannien 2021 einen werbenden und zugleich fordernden Ton gegenüber den Nachzüglern anstimmen. Der Wahlsieg Bidens bringt es mit sich, dass die EU und Deutschland der neuen US-Administration zügig zurück ins Boot helfen können, ebenso den klimapolitisch unentschlossenen Ländern. Mittelfristig sollte dann vor allem ein »Race to the top« für klimaschonende Technologien initiiert werden.
Flankierend zur Allianz für den Multilateralismus sollten Deutschland und die EU erwägen, weitere Clubs zu etablieren, um dauerhaft jene Länder bei der Stange zu halten, die den USA folgen würden, sollten diese erneut den Rückzug antreten wollen. Immerhin ist es nicht auszuschließen, dass in vier Jahren der »Trumpism« in die US-Außenpolitik zurückkehrt und die EU auf lange Sicht »allein im Sturm« steht. Um diesem Szenario zu begegnen, sollte bereits 2021 mit größerer Intensität die Idee verfolgt werden, eine proaktive Gruppe wirtschaftlich stärkerer Länder zu bilden. Aus der Riege der G20 müssten Australien, Indien, Japan, Kanada, Mexiko, Südafrika und Südkorea angesprochen werden. Weitere mittlere und kleine Staaten wie Chile, Marokko oder Neuseeland kämen ebenfalls in Frage. Attraktive Projekte wie der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft (siehe oben) oder handelspolitische Initiativen könnten dabei helfen, das Interesse an klimapolitischer Zusammenarbeit zu verstetigen.
Systemische Krisen fordern extreme Kosten, wenn man nicht rechtzeitig handelt – diese Einsicht könnte durch Corona wachsen.
Schon jetzt ist die Reform des klimapolitischen Instrumentenkastens der EU (»Fit for 55« mit grünen Investitionsregeln, CO2-Bepreisung, Wasserstoffoffensive, Energiepolitik) ein Signal in Richtung USA und anderer Handelspartner. Die Europäische Union wird damit als wichtiger Markt und Akteur in internationalen Organisationen (OECD, IWF, Weltbank, WTO) eine Marschroute vorgeben. Deutschlands Rolle sollte sein, die gesetzgeberischen Grundlagen der Hauptprojekte des European Green Deal mit voranzubringen. Starke diplomatische Signale gehen vom Vorhaben der Europäischen Kommission aus, die Wettbewerbsnachteile europäischer Unternehmen angesichts steigender Kosten für CO2-Emissionen an den EU-Grenzen mit einem Ausgleichsmechanismus abzufedern. Die Einführung eines CO2-Preises auf importierte Güter energieintensiver Branchen, wie Stahl oder Zement, wäre für die in Corona-Zeiten besonders strapazierten Außenwirtschaftsbeziehungen ein Stresstest. Die Maßnahme könnte aber ein Hebel für mehr klimapolitische Zusammenarbeit sein. Hier sollte das diplomatische Engagement ansetzen.
Pandiemieerfahrungen nutzen – Wendemanöver bewerben
Die Bundesregierung und die EU sollten das Jahr 2021 nutzen, um mit den oben genannten Maßnahmen Impulse für die nächste Dekade zu setzen. Der Green Deal hat, ebenso wie die nachhaltige Ausgestaltung der Konjunkturpakete, für die positive Beeinflussung des internationalen Umfelds in der Phase bis 2030 einen hohen Signalwert. Im weiteren Verlauf der Pandemie könnte die Einsicht wachsen, dass systemische Krisen extrem hohe Kosten verursachen, wenn nicht rechtzeitig und umfassend gehandelt wird. Die Reaktionen in Deutschland und Europa zeigen, dass eine gesellschaftliche Unterstützung für drastische Veränderungen und Eingriffe des Staates möglich ist, dass sich Chancen für eine ernsthafte Bearbeitung kritischer Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Bildung auftun. Die Bundesregierung könnte auf diesen Erfahrungen aufbauen und für gemeinsame Wendemanöver in der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik werben. Dafür sollte sie im Innern wie in den Außenbeziehungen ein Narrativ nutzen, das menschliche Sicherheit und Wohlfahrt in den Mittelpunkt stellt, und verdeutlichen, wie wichtig dafür der Schutz globaler Güter ist.
Melanie Müller
Versorgungssicherheit: Marktdynamiken und Machtverschiebungen einplanen
Die Covid-19-Pandemie und der von ihr verursachte Einbruch des globalen Handels haben in verschiedenen Weltregionen eine Debatte über Abhängigkeiten von globalen Lieferbeziehungen entfacht. Mittlerweile deuten sich geographische Machtverschiebungen in Lieferketten an. Noch ist ungewiss, wie sich diese Verschiebungen entwickeln werden, doch fest steht, dass politische Entscheidungsträger darauf Einfluss nehmen können. Für politische Akteure in Europa bietet sich eine Gelegenheit, neue Konzepte von Versorgungssicherheit zu entwerfen, die nicht nur den Zugang zu Gütern sicherstellen, sondern auch ein neues Verständnis der Resilienz von Lieferketten definieren, auch über die Herausforderungen der Pandemie hinaus. Gemeinsam mit den Partnern des Globalen Südens können Ansatzpunkte erarbeitet werden, um Handelsbeziehungen mittelfristig diverser und nachhaltiger zu gestalten. Auf diese Weise ließen sich die Partnerländer besser in Lieferketten einbinden und die regionale Wertschöpfung steigern.
Covid-19: Geographische Verschiebungen in Lieferketten
Als zu Beginn der Covid-19-Pandemie medizinische Schutzausrüstung knapp wurde, offenbarte sich, dass zahlreiche Regierungen in der akuten Phase des Lockdowns keinen gesicherten Zugriff auf essentielle Produkte hatten. Dieser Missstand und Engpässe bei der Versorgung mit nichtessentiellen Gütern haben eine Diskussion über strategische Güter, Produktionszweige, Versorgungswege und Bevorratung in Gang gesetzt, sowohl in der EU als auch in Ländern des Globalen Südens. Forderungen, welche diese Debatte in der EU prägen,1 reichen von »Nearshoring« und »Reshoring« – also die Zulieferung aus weiter entfernten Ländern in die unmittelbare Nachbarschaft zu verlagern oder zurück in das Land, aus dem sie ursprünglich ausgelagert worden war – bis hin zur Entkopplung bestimmter Märkte (»Decoupling«) und innerer Diversifizierung von Lieferketten. Redundante, also zusätzliche Zulieferstrukturen sollen solche internationalen Vernetzungen resilienter machen und damit ihre Funktionsfähigkeit gewährleisten. Verstärkt fordern Akteure in der EU eine strategische Autonomie in kritischen Produktionssektoren.2
Eine Projektionsfläche für diese Überlegungen ist China. Es bildet einen Knotenpunkt internationalen Handels und transnationaler Lieferketten und wird deshalb als Risikofaktor betrachtet. Dies zeigte sich etwa an den Versorgungsengpässen nach dem Lockdown in der Provinz Wuhan. Einige Länder haben bereits konkrete Schritte unternommen, um ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren. Die Regierung in Tokio beispielsweise unterstützt Firmen finanziell, die ihre Produktion nach Japan zurückverlagern.3 Auch europäische Unternehmen versuchen, zumindest Teile ihrer Produktion wieder in der EU anzusiedeln. Mittelfristig deuten sich geographische Machtverschiebungen in Lieferketten an. Sie haben zum Ziel, einseitige Abhängigkeiten zu verringern und damit Risiken für die eigenen Länder oder Regionen zu reduzieren. Bislang ist nicht abzuschätzen, was dies für die Rolle Chinas als wichtigstes Zentrum globaler Lieferbeziehungen bedeutet. Absehbar ist aber eine stärkere Verschiebung hin zu regionaler Diversität, so dass auch andere Regionen größere Bedeutung in Lieferketten haben werden und Chinas Macht in diesem Bereich wahrscheinlich abnehmen wird.
Covid-19 als Chance für mittelfristige Veränderungen von Lieferketten
Die Ausgangsbedingungen für Veränderungen von Lieferketten sind nicht in allen Weltregionen gleich. Viele Länder in Afrika oder Lateinamerika verfügen kaum über weiterverarbeitende Industrie und sind daher nur am Rande in weltweite Lieferketten einbezogen. Deswegen sind sie in hohem Maße abhängig von Importen und Exporten, ein Decoupling ohne eigene zusätzliche Industrialisierung ist ihnen daher nur schwer möglich. In der Afrikanischen Union (AU) beispielsweise wurde der für Juli 2020 geplante Start der Panafrikanischen Freihandelszone (AfCFTA) wegen der Pandemie verschoben. Das hat eine intensive Diskussion ausgelöst. Unterstützt durch regionale Industrialisierungsstrategien könnte es afrikanischen Ländern gelingen, die Abhängigkeiten vom Weltmarkt zu verringern und somit regionale Wertschöpfung zu fördern, argumentieren Befürworter der Freihandelszone.4
Dazu müsste in etlichen Ländern die lokale und teilweise auch die regionale Infrastruktur ausgebaut werden. Verhindert wird dies jedoch bis auf Weiteres durch die Schuldenkrise, die sich vielerorts aufgrund von Covid-19 noch verschärft.5 Kurzfristig ist ein kompletter Umbau der Lieferbeziehungen weder realistisch noch ökonomisch sinnvoll, da sich wirtschaftlich starke Länder, oft gefördert von der Politik vor Ort, als geopolitische und ökonomische Machtzentren etabliert haben. Seit dem Ausbruch der Pandemie lassen sich indes Machtverschiebungen in globalen Lieferketten beobachten: Weil unter anderem die Produktion in manchen Bereichen zum Erliegen kam und das Transportwesen zeitweise einbrach, hat sich das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage verändert. Die Folge waren Schocks sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite.
Gleichzeitig entstehen aus dieser Lage für Regierungen im Norden und im Süden aber auch Möglichkeiten für gemeinsames Gestalten. Mit Blick auf die Diversifizierung von Lieferketten und die Versorgungssicherheit ist es angezeigt, einen gründlichen Analyse- und Diskussionsprozess zu starten. Es geht darum, die spezifische Situation verschiedener Rohstoffe, Sektoren und Versorgungsgüter unter die Lupe zu nehmen. Das schließt deren Marktsituation, die Organisation von Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstrukturen ebenso ein wie die Akteure, die in die jeweiligen Lieferketten eingebunden sind. Ein Ziel muss sein, gemeinsam Defizite in der Resilienz der jeweiligen Lieferketten zu identifizieren. Insgesamt ist eine differenzierte sektor- und rohstoffbezogene Perspektive sinnvoll, die Faktoren wie das Vorkommen von Rohstoffen und ihre materielle Beschaffenheit, aber auch ihre Wiederverwertbarkeit berücksichtigt.
Sektor- und rohstoffbezogene Chancen identifizieren
Chancen für die Veränderungen von Lieferketten lassen sich am Handel mit metallischen Rohstoffen verdeutlichen. Sowohl die EU, die stark vom Rohstoffimport abhängt, als auch Rohstoffe fördernde Länder können Lieferbeziehungen konkret gestalten. Kurzfristig wird es darum gehen müssen, den Handel und die Lieferbeziehungen zu stabilisieren, da der gegenwärtige Einbruch auch für die Förderländer negative ökonomische Folgen hat. Staaten, die in hohem Maße von Exporten metallischer Rohstoffe abhängig sind, wurden von dem Handelseinbruch besonders hart getroffen.6 Deswegen dehnten einige von ihnen, wie zum Beispiel Südafrika, ihre Lockdowns nur teilweise auf den Bergbausektor aus, um den Betrieb nicht gänzlich einstellen zu müssen.7
Um die Abhängigkeit vom Rohstoffimport zu verringern, kann es mittelfristig für die EU ein Ansatzpunkt sein, geschlossene Rohstoffkreisläufe zu schaffen, denn einige metallische Rohstoffe wie beispielsweise Kupfer können bis zu 90 Prozent recycelt werden. Zwar würde eine schnelle Erhöhung der Recyclingquote in der EU nicht dazu beitragen, die geschätzten Bedarfe in den kommenden Jahrzehnten zu decken. Doch dürften Recycling und Urban Mining – die Rohstoffgewinnung im urbanen Raum8 – als wichtige Elemente der angestrebten Kreislaufwirtschaft auch im Rahmen des European Green Deal9 bedeutsamer werden, mit dem die Netto-Emissionen in der EU bis 2050 auf null gesenkt werden sollen. Im Globalen Süden kann die Wertschöpfung im Rohstoffsektor gesteigert werden, wenn die erste Verarbeitung bis hin zum Schmelzprozess (zumindest regional) näher an den Abbau verlagert und auf diese Weise regionale Wirtschaftsentwicklung gefördert wird. Hier können die Disruptionen durch die Pandemie, die womöglich noch länger anhalten, eine Chance sein, notwendige Strategien für industrielle Produktion weiterzuentwickeln.
Risiko, Resilienz, Verwundbarkeit – für solche Begriffe lässt sich durch Corona ein tieferes Verständnis gewinnen.
Auch sollten negative externe Effekte des Rohstoffsektors mitbedacht werden. Nicht eingepreist in die Produktion zum Beispiel sind nämlich Kosten für den Transport, der wiederum Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß hat. Die fehlende Umsetzung von Umwelt- und Sozialstandards verursacht unmittelbare Kosten für Personen, die von den negativen Folgen der Rohstoffgewinnung betroffen sind. Zudem wirkt sie sich auf die Produktionsprozesse aus. Streiks oder Proteste im Bergbausektor bringen Produktionsabläufe ins Stocken. Das bedeutet unmittelbare Kosten für die Unternehmen. Aber auch die betroffenen Staaten werden in Mitleidenschaft gezogen, weil ihnen Devisen entgehen. Für die Beseitigung von Umweltschäden wie die Verschmutzung von Wasser oder Boden muss häufig der Staat aufkommen. Hier entstehen also gesamtgesellschaftliche Kosten.10 In die Gewinnberechnungen fließen solche Aspekte nicht ein, obwohl Studien zeigen, dass die negativen externen Folgen etwa des Bergbaus besonders schwerwiegend sind.
Neue Konzepte von Versorgungssicherheit
Aus diesen Befunden lässt sich schließen, dass die Bedeutung globaler Versorgungssicherheit spätestens jetzt neu bedacht werden muss. Prävention und Schadensminderung für den Fall einer eingeschränkten Versorgungsleistung gilt es gleichzeitig in den Blick zu nehmen. Das Verständnis von Begriffen wie Risiko, Resilienz und Verwundbarkeit, über die gerade intensiv diskutiert wird,11 kann nun angesichts der neuen Erfahrungen mit einer Pandemie, aber auch vor dem Hintergrund anderer Herausforderungen weiterentwickelt werden.
In nächster Zeit stehen vielfältige Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse an, sowohl auf unternehmerischer als auch auf politischer Ebene: Wie soll das Verhältnis von Staat und Markt neu ausgehandelt werden? Wie lässt sich ein Gleichgewicht zwischen Effizienz und Sicherheit herstellen? Wie können Nachhaltigkeitspolitik und konjunkturelle Wiederbelebung in einer neuen Industriepolitik aufeinander abgestimmt und miteinander in Einklang gebracht werden? Welche Möglichkeiten haben (rohstoffreiche) Länder im Globalen Süden, davon zu profitieren?
Noch ist die Politik vorrangig damit beschäftigt, die Krise und ihre Folgen zu meistern, zumal nicht abzusehen ist, in welchem Zeitraum die akuten Herausforderungen überhaupt zu bewältigen sind. Doch auch in Europa müssen die politischen Akteure eine Diskussion über die zukünftigen Wege führen, wenn wichtige Weichenstellungen zwischen Marktdynamiken und Machtverschiebungen nicht verpasst werden sollen. Für die anstehende Debatte lassen sich folgende Ansatzpunkte neuer Konzepte transnational gedachter Versorgungssicherheit und ihrer Governance identifizieren:
Wenn es um Versorgungssicherheit geht, muss immer das internationale und regionale Umfeld mitbedacht werden. Rein nationale Denkmuster erweisen sich angesichts der international verknüpften Märkte als inadäquat.
Das deutsche und europäische Verhältnis zu machtvollen Akteuren wie China wird nicht nur politisch definiert, sondern auch durch eine Fülle von Austauschbeziehungen. Zudem spielt hinein, dass viele Länder im Globalen Süden wirtschaftlich und politisch eng mit China verwoben sind. Ohne exorbitante Kosten sind diese internationalen Marktdynamiken nicht kurzfristig umkehrbar. Es gilt, gemeinsame europäische Antworten zu finden, denn fatal wäre es, wenn die europäischen Positionen und Ansätze zur Versorgungssicherheit weiter auseinanderdrifteten.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Versorgungssicherheit verschiedener Weltregionen zu gewährleisten: Lieferketten können sowohl im Upstream- als auch im Downstream-Bereich regionaler angelegt werden, was eine Reihe von Ländern des Globalen Südens ohnehin anstrebt. Darüber hinaus lassen sich manche Regionen besser in transnationale Lieferketten einbinden. Die EU muss hier eigene Konzepte entwickeln, sollte aber auch andere Weltregionen beim Aufbau einer gesicherten Versorgung mit essentiellen Gütern unterstützen. Auf diese Weise ließen sich gravierende Versorgungsengpässe vermeiden, die finanzielle Unterstützung für die davon Betroffenen erfordern würden. Außerdem können Governance-Strukturen, die Nachhaltigkeits- und sozioökonomische Kriterien einbeziehen, entlang von Verarbeitungs- und Wertschöpfungsketten spezifischer Rohstoffe angepasst werden. Langfristig hegt Governance Risiken ein, kurzfristig schafft sie mehr Transparenz.
Versorgungssicherheit ist als Ziel sinnvoll, aber für Deutschland und Europa nur jenseits kurzsichtiger protektionistischer Reaktionen denkbar. Auch die Relokalisierung, also die Verlegung von Lieferketten – in diesem Fall in die EU –, ist nur in gewissem Maße hilfreich, und wenn, dann jeweils bezogen auf spezifische Produkte und Gütergruppen. Allerdings müsste zunächst geklärt werden, ob und inwiefern sie strategischen Charakter haben.
Bei der strategischen Planung ist es wichtig, in variablen Zeithorizonten zu denken. Die Vorlaufzeiten bei verschiedenen Gütern wie Rohstoffen sind extrem lang, so dass sich ein abgestuftes Vorgehen in einer kurz-, einer mittel- und einer langfristigen Dimension anbietet. Da Spezifika von Sektoren mitberücksichtigt werden müssen, helfen keine One-Size-Fits-All-Ansätze, sondern nur sektorbezogene Analysen.
Für politische Entscheidungen ist es zudem nötig, ein erweitertes Verständnis der Resilienz von Lieferketten zu entwickeln. Über die Erwartung an die Stabilität von Lieferbeziehungen hinaus müssen dabei verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit mitbedacht, die menschenrechtlichen Folgen einbezogen und diese auch vor dem Hintergrund der negativen externen Effekte betrachtet werden. Ein solches Verständnis bietet Möglichkeiten, Produktionsbedingungen weltweit nachhaltiger zu gestalten und zu helfen, Lieferbeziehungen resilienter zu machen.
Gerade längerfristige Planungshorizonte eröffnen Chancen, Staaten im Globalen Süden gezielt in ihrer Fähigkeit zu unterstützen, Standards umzusetzen. Damit ließe sich besser verhindern, dass wegbrechende Lieferbeziehungen kurzfristige negative Folgen zeitigen. Um zu tragfähigen Lösungen zu gelangen, müssen Politik und Wirtschaft bald den Dialog mit ihren Partnern, aber auch untereinander aufnehmen.
Europa und sein Umfeld
Peter Becker / Kai-Olaf Lang / Barbara Lippert / Paweł Tokarski
Die Pandemie und die EU: Integrationsimpuls mit ungewisser Wirkung
Die Covid-19-Pandemie und die von ihr ausgelöste Rezession verursachen hohe ökonomische und soziale Kosten in der gesamten Europäischen Union. In dieser Ausnahmesituation konnten die 27 Mitgliedstaaten ihre politischen Gegensätze überwinden und sich auf ein Konjunkturpaket einigen, dessen Umfang in der EU-Geschichte beispiellos ist und das durch gemeinsame Schuldenaufnahme finanziert wird. Damit haben die Mitgliedstaaten zumindest vorübergehend ihre teils erheblichen Positionsdifferenzen überbrückt und Handlungsfähigkeit demonstriert. Allerdings zeigen alle Analysen und viele Prognosen, dass die Mitgliedstaaten und einzelne Wirtschaftszweige unterschiedlich stark von der Pandemie und deren sozioökonomischen Folgen getroffen wurden und werden. Das kann trotz des aktuellen Impulses für einen stärkeren Zusammenhalt neue Unwuchten und Ungleichzeitigkeiten im Integrationsprozess erzeugen. Darauf muss die Politik reagieren.
Chancen für Reformen
Der politische Kalender und die zeitliche Koinzidenz der Pandemie-Krise mit den europäischen Haushaltsverhandlungen gaben der EU die Möglichkeit, mit grundsätzlichen Veränderungen und Reformen effektiv auf die neue Lage zu reagieren. Diese Chance hat sie genutzt. Falls der Mehrjährige Finanzrahmen 2021–2027 (MFR) verabschiedet und die gleichzeitig aufgelegten weitreichenden Hilfs- und Rettungspakete umgesetzt werden, sind sie die naheliegenden Ausgangspunkte für weitere Integrationsschritte. Die Kommission erhält die Gelegenheit, selbst Schulden in größerem Umfang aufzunehmen, um Mitgliedstaaten in einer gesundheitspolitischen oder ökonomischen Notlage zu helfen. Mit der Einführung der Plastikabgabe wird erstmals seit 1988 eine neue Finanzierungsquelle für den EU-Haushalt geschaffen; weitere echte Eigenmittel sollen in den nächsten Jahren folgen. Der Schritt zu einer wirklichen europäischen Steuer wird dadurch deutlich kleiner. Diese Verständigung kommt einer integrationspolitischen Zäsur gleich. Die Krise wirkt unmittelbar als Reformkatalysator, so dass sich ungeahnte Perspektiven auftun.
Der Schutz und die Festigung des europäischen Binnenmarktes durch neuartige finanzielle Hilfsprogramme gehen weit über frühere Konjunkturstützungsmaßnahmen der EU hinaus. Künftig werden die Ausgaben aus dem EU-Budget auf die beiden großen Zukunftsthemen Klima und Digitalisierung ausgerichtet. Mit dem Europäischen Green Deal haben die EU und die europäischen Volkswirtschaften ihr neues Wachstumsmodell für das nächste Jahrzehnt vereinbart.
Auch die Europäische Zentralbank (EZB) stellt sich mit ihrer Geldpolitik in den Dienst der klimapolitischen Transformation der europäischen Wirtschaft. Durch gezielten Ankauf von Vermögenswerten und mit Sicherheitsanforderungen kann die EZB die grünen Ziele unterstützen. Einerseits wird die politische Rolle der EZB so über das begrenzte Mandat der Preisstabilität hinaus ausgeweitet und aufgewertet. Andererseits jedoch könnte in Zukunft ihr fiskalpolitischer Einfluss schwinden, wenn die europäische Wirtschaftspolitik enger abgestimmt und der europäische Haushalt als wirtschaftspolitisches Instrument genutzt wird. Noch spielt die EZB eine entscheidende Rolle, indem sie die Kosten des öffentlichen Schuldendienstes niedrig hält und die Insolvenz hoch verschuldeter Mitglieder der Eurozone verhindert.
Allerdings zeichnen sich in anderen Politikbereichen deutliche Unterschiede in Tempo, Dynamik und Tiefe der Entwicklung ab. Nur zögerlich aufgegriffen werden die Vorschläge zu einem Ausbau der gesundheitspolitischen Förderinstrumente der EU und die ersten Schritte zu einer gemeinschaftlichen europäischen Gesundheitspolitik. Die Personenfreizügigkeit schränkten die Mitgliedstaaten zunächst als Folge der Covid-19-Pandemie ein; die Grenzen öffneten sie dann je nach Infektionsgeschehen in ihren Ländern oder Regionen. Zwar gibt es Bestrebungen, die nationalen Pandemie-Politiken besser miteinander zu koordinieren und mit zusätzlichen Instrumenten wirkungsvoller zu implementieren. Ähnliches gilt für den Schutz der europäischen Außengrenzen. Nationale Souveränitätsreflexe stehen einer effektiveren gemeinschaftlichen europäischen Migrations- und Asylpolitik jedoch weiterhin entgegen. Die Pandemie hat auch in diesem Politikfeld keine erkennbare integrationspolitische Hebelwirkung entfaltet; ebenso wenig werden Asyl- und Flüchtlingspolitik Teil größerer Kompromisspakete.
Die Handlungsfähigkeit der EU umfassend stärken
Die Pandemie hat die bekannten Interessenunterschiede und Konflikte zwischen Nord und Süd, Ost und West sowie zwischen großen und kleinen Mitgliedstaaten nochmals sichtbar gemacht. Daher müssen die EU-Akteure darauf hinwirken, die zentripetalen Kräfte zu reduzieren, die Spannungen kontinuierlich auszutarieren und damit den Zusammenhalt der EU-27 zu festigen. Dazu reichen intergouvernementale Politikansätze nicht aus, wie die unmittelbare Reaktion der EU auf die plötzliche Herausforderung der Pandemie gezeigt hat.
Der Europäische Rat ist als intergouvernementales Organ par excellence auf die Gemeinschaftsinstitutionen und -verfahren angewiesen, um seinen Beschlüssen und Schlussfolgerungen rechtliche Geltung und politische Wirkung zu verleihen. Auch jene Mitgliedstaaten, die auf ihr Vetorecht und Einstimmigkeit pochen, werden ihre materiellen und politischen Ziele nicht ohne Rückgriff auf die Gemeinschaftsorgane und die gemeinschaftlichen Entscheidungsprozesse erreichen. Über Corona-Zeiten hinaus bleibt der Europäische Rat in der politischen Führungsrolle, trifft die Richtungsentscheidungen und ist die letzte Instanz für Streitbeilegungen. Die intergouvernementale Abstimmung oder die Formierung kleiner Interessengruppen, die spezifische Probleme lösen sollen, ist weiterhin Voraussetzung für Einstiegsoptionen, um den Weg zu gemeinschaftlichen Antworten im Kreis aller Mitgliedstaaten vorzubereiten.
Ohne die Initiative und Geschlossenheit des proaktiven deutsch-französischen Tandems werden auch künftig keine bedeutenden Integrationsschritte möglich sein. Zugleich aber ist offensichtlich, dass ein funktionierender Integrationsmotor allein nicht genügen wird, um die EU-27 voranzubringen. Stattdessen wird eine Dominanz des Tandems die Gräben in der EU-27 nur vertiefen. Wichtig bleiben Paris’ und Berlins enge Zusammenarbeit mit der EU-Kommission und die Pflege intensiver bilateraler oder mehrseitiger Beziehungen.
Allen voran die Europäische Kommission wird gefordert sein, als Hüterin des Gemeinschaftsinteresses und als neutraler Makler zwischen den Interessengruppen der Mitgliedstaaten zu agieren. Dazu wird es nötig sein, den Irrweg einer exponiert politischen Kommission zu verlassen, die sich als weltanschaulich oder parteipolitisch ausgerichtete Leitinstitution geriert. Politisch bleibt die Kommission in dem Sinne, dass sie vertrags- und prinzipiengebunden handelt und so jenen Regierungen die Stirn bieten kann, die gegen sie polemisieren.
Auf welchen Feldern gemeinsame Problemlösungen und der europäische Zusammenhalt gesucht und verstetigt werden können, wird die eigentliche europapolitische Frage sein. Die erfolgreiche Implementierung der neuen Instrumente und Ziele der EU – der Green Deal und der Konjunkturimpuls, der europäische Außengrenzschutz und eine gemeinschaftliche Asylpolitik, eine europäische Verteidigungspolitik oder die engere steuerpolitische Zusammenarbeit – wird zur Messlatte für Stärke und Nachhaltigkeit des Integrationsimpulses durch die Corona-Pandemie. Der (Mehr-)Wert der Integration muss die nationalstaatlichen Bedenken überwiegen. Neben der pragmatischen Kompromissfähigkeit erfordert diese Politik sowohl eine feste gemeinsame Wertebasis, auf der die schwierigen europäischen Aushandlungsprozesse gemeistert werden können, als auch gegenseitiges Vertrauen.
Brems- und Gegenkräfte
Die mögliche Schubkraft des Krisenmoments kann indes durch Gegenkräfte abgeschwächt werden. So wird sich trotz aller Hilfsanstrengungen die Schuldenkrise, der manche Staaten ausgesetzt sind, keineswegs bewältigen lassen, sondern fortsetzen und sogar verschärfen. Und infolge der Abschwungphase (siehe Graphik), welche die Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Weise betrifft, könnte die wirtschaftliche Divergenz in der Eurozone und der gesamten EU weiter zunehmen.
Unklar ist noch, ob die optimistisch dargestellten Reformmaßnahmen der neuen Klima- oder Digitalisierungsoffensive überall erfolgreich umgesetzt werden. Erfahrungen zeigen, dass eine unzulängliche Implementierung oder offenkundige Ineffizienzen die Spannungen und das Misstrauen zwischen den Mitgliedstaaten anfachen und damit den Zusammenhalt beeinträchtigen können. Nicht unterschätzt werden sollte, dass mögliche Gegenbewegungen seitens europaskeptischer Regierungen nicht nur die neuen Integrationsprozesse stoppen, sondern das normale Funktionieren der EU behindern können. Zudem wird es Versuche geben, die jüngsten Tendenzen einer Vertiefung im finanz- und wirtschaftspolitischen Bereich zu bremsen. Was die internationalen Beziehungen betrifft, können sowohl vermehrte politische Spaltversuche von Seiten einiger Großmächte als auch wirtschafts- oder währungspolitische Schwächen wie etwa die fortwährende Dominanz des US-Dollar gegenüber dem Euro zur Folge haben, dass das integrations- und kooperationsfördernde Potential der Krise nicht ausgeschöpft wird.
Ausblick: Die Pandemie – integrationspolitischer Katalysator oder nur Anstoß für eine Reformepisode?
In vielerlei Hinsicht wird es in der EU weitergehen wie bisher. Die Pandemie hat die Grundlagen der Integration, die bestehenden Institutionen und Entscheidungsverfahren weder grundsätzlich in Frage gestellt noch revolutioniert. Weiterhin müssen die gemeinsamen Interessen der 27 Mitgliedstaaten kontinuierlich neu erarbeitet, definiert und umgesetzt werden. Auch in Deutschland werden Bundesregierung und Bundestag debattieren, inwieweit die im Zuge der Pandemie angestoßenen Reformen fortentwickelt und als Sprungbrett für Vertiefung genutzt werden oder als Notbehelf bald wieder eingestellt werden sollten. Das weitere Integrationsgeschehen ist keineswegs determiniert. Aber die Erfahrung zeigt, dass ein bloßes Zurück, also zur EU vor der Pandemie, höchst unwahrscheinlich ist.
Der Erfolg der aufgelegten Maßnahmenpakete wird entscheidend dafür sein, ob die finanz- und wirtschaftspolitischen Hilfsprogramme der europäischen Integration weiterreichenden und nachhaltigen Schwung verleihen werden. Dies wird ein zentraler Bestimmungsfaktor dafür sein, ob die Anstrengungen der EU im Kontext der Pandemie zum Integrationssprungbrett werden oder nur eine Reformepisode anstoßen. Erweisen sich die Hilfen als Strohfeuer oder verpuffen wirkungslos, ist kaum damit zu rechnen, dass sich neue politische Dynamiken hin zu mehr Integration entfalten werden. Im Gegenteil, wenn die angestoßenen Maßnahmen europäischer Solidarität nicht zielorientiert und nachhaltig genutzt werden, könnte die Enttäuschung in den europäischen Gesellschaften dazu führen, dass die Europäische Union grundsätzlich in Frage gestellt wird. Zeichnet sich hingegen ein echter Mehrwert ab und gelingt es mit Hilfe finanzieller Unterstützung, dass sich vor allem die von strukturellen Problemen gebeutelten Volkswirtschaften spürbar erholen, könnte aus dem wirtschaftlichen Aufschwung ein Anstoß für mehr politisches Zusammenwirken in der Zukunft ergeben. Entsteht aber ein uneinheitliches und gemischtes Bild, bei dem einige Länder Hilfen effektiv nutzen, andere aber Mittel ohne sichtbaren Erfolg einsetzen oder Geld nicht sinnvoll ausgeben können, wird es schwer werden, einen Konsens für weitere Integration zu erzielen.
Vor diesem Hintergrund lassen sich einige Möglichkeiten skizzieren, die europapolitischen Entwicklungen der nächsten Jahre zu gestalten. Eine Bilanz der Hilfsmaßnahmen in Gestalt einer Halbzeitüberprüfung soll den Blick auf Erfolge und Misserfolge lenken. Sie werden sicher auch bei den politischen Auseinandersetzungen mit Blick auf die 2024 stattfindenden Europawahlen eine Rolle spielen.
Auch wenn der Wiederaufbaufonds erfolgreich implementiert wird, folgt nicht automatisch ein breiter Integrationsschub.
Parallel zu dieser Zwischenbilanz werden wichtige wirtschaftspolitische Debatten über Langzeitziele der Wirtschafts- und Währungsunion sowie des Binnenmarkts geführt werden. Neben einer Überprüfung der geldpolitischen Strategie der EZB, weiterer Risikoteilung innerhalb der Bankenunion und dem Aufbau der Kapitalmarktunion geht es dabei auch um erste Schritte zur Transformation der europäischen Volkswirtschaften auf ihrem Weg zur Klimaneutralität und um die Zukunft der europäischen Wettbewerbspolitik. Die richtige Balance zwischen dem Festhalten an eingespielten Strukturen und neuen Mechanismen zur Reaktion auf die fundamentalen Herausforderungen wird die Legitimität der neuen Instrumente beeinflussen und damit die Richtung der weiteren Integrationsschritte bestimmen. Wie viel wirtschaftliche Risikoteilung und Übertragung nationaler Regulierungskompetenzen auf supranationaler Ebene wollen die Mitgliedstaaten wagen, wie viel müssen sie akzeptieren und in welchen Bereichen können sie an ihren nationalen Regulierungsreservaten festhalten?
Mit diesen Richtungsentscheidungen sind zwangsläufig institutionelle Fragen verbunden, aber stets auch Fragen der politischen Verantwortung und der Machtverteilung.
Bedenken sollte die Bundesregierung, dass ein breiter angelegter Integrationsschub – gerade in den sensiblen Feldern Innen- und Justizpolitik, Währungs- und Fiskalpolitik sowie Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik – selbst dann nicht automatisch erfolgen wird, wenn der Wiederaufbaufonds erfolgreich implementiert wurde. Zusätzlich zum integrationspolitisch günstigen Moment bedarf es einer entschlossenen Führungsgruppe Gleichgesinnter. Diese muss Kernelemente eines ausgewogenen Reformpakets entwickeln und in einen Entscheidungsprozess einbetten, der auf einen Konvent und eine Regierungskonferenz zuläuft. Für alle Fälle: Noch die jetzige Bundesregierung sollte damit beginnen, solche offenen Koalitionen zu bilden, und an einer Agenda für mehr Handlungsfähigkeit und Legitimität der EU arbeiten.
Annegret Bendiek / Ronja Kempin
Europäische Außen- und Sicherheitspolitik in der Pandemie
»Europa wird in Krisen geschmiedet werden« – dieser Satz Jean Monnets hat gegenwärtig wieder Aktualität.1 Der »epische Europäische Rat« vom Juli 2020 hat die Handlungsfähigkeit der EU in der Krise unter Beweis gestellt. Den sozioökonomischen Folgen von Covid-19 setzten die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission das bisher größte Finanzpaket in der Geschichte der europäischen Integration entgegen: Mit dem neuen Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die nächsten sieben Jahre und dem auf vier Jahre befristeten Wiederaufbauprogramm »Next Generation EU« (NGEU) wurde ein Paket mit einem Volumen von insgesamt 1,8 Billionen Euro geschnürt.2 Die bereitgestellten Mittel zielen in erster Linie auf eine verbesserte finanzielle Ausstattung der Binnenpolitiken. Die Etats der EU für internationale Solidarität bleiben beschränkt.
Obgleich die globale Pandemie dem Multilateralismus zusetzt und China, Russland, aber auch die Türkei ihre expansiven Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitiken fortführen, hat die Gesundheitskrise die EU-Mitgliedstaaten nicht dazu bewegen können, von ihrer außenpolitischen Selbstbezogenheit abzurücken. Mit der Folge, dass die Fortentwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) bestenfalls stagniert. Debatten über eine Vergemeinschaftung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik mit der Einführung von qualifizierten Mehrheitsentscheidungen, aber auch Ideen zur Flexibilisierung außerhalb der EU-Verträge, wie sie zuletzt im Kontext der Schaffung eines Europäischen Sicherheitsrats diskutiert wurden, sind versandet. Die im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) angestoßenen Prozesse einer Binnenintegration werden dagegen fortgesetzt. Der pandemieinduzierte Integrationsschub, der sich insbesondere in der Wirtschaftspolitik zeigt, greift indes bislang nicht auf die Außen- und Sicherheitspolitik über. Damit sieht sich vor allem die »geopolitische Kommission«3 unter der Leitung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen innerhalb und außerhalb der Union enormen Erwartungen gegenüber, die Hebelwirkung, die das Milliardenprogramm EU-intern entfalten wird, nicht nur zur Stärkung der außen- und sicherheitspolitischen Resilienz, sondern auch zur Entfaltung einer ergebnisorientierten EU-Außenpolitik der EU zu nutzen.4 Dies dürfte nur gelingen, wenn die Kommission die Stärke der europäischen Wirtschaftskraft und des Binnenmarkts mit einer Außen- und Sicherheitspolitik verbinden kann, die ebenfalls vergemeinschaftet ist. Hier ist die Kommission jedoch abhängig von den Mitgliedstaaten: Die Vergemeinschaftung der GASP liegt in der alleinigen Kompetenz der EU-Staaten.
Multilateralismus erodiert – EU hält dagegen
Kurz nachdem die Pandemie Europa erreicht hatte, gelang es der EU, den Multilateralismus zu stärken. Die EU-Kommission trat dem Versuch der US-Administration entgegen, sich die Exklusivrechte an einem Impfstoff gegen das Coronavirus zu sichern. Mit dem Argument, dass Impfstoffe ein öffentliches Gut sind, gründete sie gemeinsam mit vielen anderen Ländern außerhalb der EU die Initiative »Global Response«. Zentrales Ziel des Formats war zunächst die Ausrichtung einer Geberkonferenz und eines Spendengipfels zur Eindämmung der Pandemie und ihrer Folgen, bei dem Ende Juni 2020 insgesamt knapp 16 Milliarden Euro gesammelt werden konnten.5 Empfänger der Gelder sind insbesondere die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und mehrere Allianzen zur Entwicklung von Impfstoffen und Heilmitteln. Der internationale Geber-Marathon der Europäischen Kommission hat zudem bislang 9,8 Milliarden Euro mobilisiert, die dem universellen Zugang zu Covid-19-Behandlungen, ‑Tests und Impfungen gegen Coronaviren dienen sollen. Auch in anderen Bereichen des auswärtigen Handelns arbeitete die EU-Kommission eng mit internationalen Akteuren zusammen, um die Pandemie einzudämmen und deren Folgen zu bekämpfen. Ihr ist es zum Beispiel gelungen, die IV. internationale Geberkonferenz für Syrien durchzuführen, bei der Hilfszahlungen in Höhe von 6,9 Milliarden Euro zugesagt wurden.6 Die EU hat ihr Ansehen als internationale Akteurin zu Beginn der Gesundheitskrise somit dort gefestigt, wo die EU-Kommission autonom gestalten kann.
Vielstimmigkeit in internationalen Krisen und Konflikten besteht fort
Schon vor dem Ausbruch der Pandemie hatten sich die Mitgliedstaaten vorgenommen, stärker auf geopolitische Veränderungen einzuwirken. Insbesondere im Umgang mit China, Russland und den USA wollten sie die »Sprache der Macht« erlernen.7 Diesen Anspruch konnte die EU in der Corona-Krise bislang nicht einlösen. Der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik (HV), Josep Borrell, hat sich während der Pandemie mit einer Nebenrolle zufriedengeben müssen. Allein bei der Abwehr von Desinformationskampagnen gelang es ihm, medial in Erscheinung zu treten.8 Der ihm unterstellte Europäische Auswärtige Dienst geht vehement gegen Falschmeldungen – nicht zuletzt über das Virus – vor. Erwogene Vorhaben, die vor der Corona-Pandemie noch die Diskussion bestimmt hatten, etwa die Einführung qualifizierter Mehrheitsentscheidungen, konnte er bislang ebenso wenig vorantreiben wie die Kommissionspräsidentin. Beide stoßen weiterhin auf den Widerstand einzelner Mitgliedstaaten. Auch bei dem Bemühen, Fragmentierungstendenzen entgegenzuwirken, die innerhalb in der EU im Hinblick auf ihre Partnerschaftsbeziehungen zu den USA und der Türkei wirksam sind, konnte der Hohe Vertreter keine Fortschritte erzielen.9
Im Gegenteil: Die Interessendifferenzen der Europäer in Bezug auf die Türkei haben sich während der Pandemie sogar noch verschärft, weil die südliche und die östliche Komponente der Europäischen Nachbarschaftspolitik gegeneinander ausgespielt wurden. Dass Griechenland und Zypern einer Verhängung von Sanktionen gegen das Regime des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko erst dann zustimmten, als sich die übrigen Mitgliedstaaten bereit erklärten, mit Sanktionen gegen die Türkei zu drohen, machte deutlich, wie hinderlich das Einstimmigkeitsprinzip für die EU-Außenbeziehungen ist.10 Obgleich bekannt ist, dass die Türkei wiederholt gegen das für Libyen geltende UN-Waffenembargo verstoßen hat, ließen die Mitgliedstaaten Ende August 2020 die Aufrufe des HV unbeantwortet, der Operation Irini angemessene militärische Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, um das Embargo durchsetzen.11 Schließlich verhallte der Appell des HV ungehört, dem chinesischen Divide-et-impera-Ansatz gemeinsam entgegenzutreten. Seiner Forderung nach einer »robusteren« Strategie gegenüber der Volksrepublik kamen die Mitgliedstaaten erst nach mehrmaligen Anläufen nach: Als Reaktion auf das für Hongkong erlassene Sicherheitsgesetz einigten sie sich im Juli 2020 auf gemeinsame Maßnahmen wie den Stopp der Ausfuhr von Überwachungstechnologien und Dual-use-Gütern. Die Differenzen mit China vermag indes auch die Europäische Kommission nicht zu bereinigen. Sie veröffentlichte im Juni 2020 ein Weißbuch zur »Gewährleistung fairer Wettbewerbsbedingungen bei Subventionen aus Drittstaaten«. Das Weißbuch kann als Antwort verstanden werden auf die wiederholt zurückgewiesene Forderung nach einem gleichberechtigten Marktzutritt für europäische Unternehmen auf den chinesischen Markt. Die EU hatte ihr Ansinnen mehrfach gegenüber der Führung in Peking artikuliert, ohne dass diese sich in der Frage bewegt hätte.
Finanzierung des auswärtigen Handelns verbleibt auf niedrigem Niveau
Dass die Entwicklung der GASP stagniert, macht auch die künftige finanzielle Ausstattung des Haushaltstitels »Nachbarschaft und die Welt« deutlich: Für den Zeitraum 2021–2027 sind dafür im Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 98,4 Milliarden Euro veranschlagt.12 Das sind lediglich 1,3 Milliarden Euro mehr als im vorangegangenen Budget (2014–2020). Die GASP im engeren Sinne erfährt sogar eine Abwertung: Im Zeitraum 2021–2027 soll der GASP-Anteil mit 2,4 Milliarden weniger als 2,5 Prozent der gesamten außenpolitischen Mittel der EU betragen. Nach aktueller Beschlusslage soll der Etat für dieses Politikfeld sogar um 10,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen MFR gekürzt werden. Die Annahme, dass infolge der Pandemie auch die Krisen und Konflikte in der Nachbarschaft der EU zunehmen werden, findet unter den EU-Mitgliedstaaten offenbar keinen Anklang. Vielmehr legt das Volumen der Mittel, die für das auswärtige Handeln der EU veranschlagt werden, die Deutung nahe, dass die Pandemie bei den Mitgliedstaaten den Wunsch bestärkt hat, die Bearbeitung von Krisen und Konflikten an Dritte zu delegieren. Im Zuge der Haushaltsverhandlungen haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Friedensfazilität (EFF) ein Finanzvolumen von 5 Milliarden Euro zugebilligt. Die EFF soll militärische friedensfördernde Maßnahmen finanzieren, die von Partnern durchgeführt werden. Die EFF-Mittel können außerdem dazu verwendet werden, Partnerländer militärisch auszustatten und auszurüsten. Die Friedensfazilität ist außerhalb des EU-Haushalts angesiedelt, weil Artikel 41 (2) EU-Vertrag (EUV) verbietet, Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen aus dem EU-Haushalt zu finanzieren.
Das Budget als Gelegenheit für eine Aufwertung der Kommission in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik
In der GSVP sind Mitgliedstaaten und EU-Kommission weiter darauf fokussiert, den im November 2016 vereinbarten »Umsetzungsplan für Sicherheit und Verteidigung« zu verfolgen und in Rechtsvorschriften zu gießen. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Corona-Pandemie auch auf die GSVP keinen Einfluss hat. Laufende Prozesse werden ohne Abstriche fortgesetzt. Augenfällig ist gleichwohl, dass die Mitgliedstaaten – anders als für die GASP – die Finanzmittel für die GSVP deutlich erhöht haben. Im Vergleich zum vorherigen MFR, in dem die Mitgliedstaaten 4,6 Milliarden Euro für die GSVP reserviert hatten, wird die Rubrik 5 (»Sicherheit und Verteidigung«) des Haushalts für die Jahre 2021–2027 mit einer Summe von 13,185 Milliarden Euro ausgestattet.13
Damit Corona in der GASP einen Integrationsschub auslösen kann, müssten sich die Mitgliedstaaten zur Supranationalität bekennen.
Zwei Folgen der Gesundheitskrise dürften die Zusammenarbeit in der GSVP überdies begünstigen: Die Corona-Pandemie hat die Sicht auf die USA verändert. Das wird aller Erwartung nach dazu führen, dass sich die zwischenstaatliche Kooperation der EU-Mitgliedstaaten in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik vertieft. Zweitens werden die Mitgliedstaaten mittelfristig ihre Verteidigungsbudgets kürzen müssen.14 Dieser Umstand wird es der EU-Kommission erlauben, über ihre Kompetenzen in der rüstungsindustriellen Entwicklung zusehends Einfluss auf die GSVP zu nehmen. Im MFR 2021–2027 haben die Mitgliedstaaten den Europäischen Verteidigungsfonds (EDF) verankert – und mit ihm das »Einfallstor« der Europäischen Kommission zu diesem Politikfeld aufgestoßen. Seit 2017 bemüht sich die Kommission darum, die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf- und auszubauen, indem sie die rüstungsbezogene Industrie-, Beschaffungs- und Forschungspolitik der Mitgliedstaaten integriert. Sie strebt offenkundig danach, die institutionelle Verankerung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu verschieben: von einem mitgliedstaatlich zu einem supranational dominierten Politikfeld. Nicht ohne Grund stützt sie ihre Vorschläge auf die Artikel 173 und 182 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Sie versucht auf diese Weise, die Begrenzungen der europäischen Verteidigungspolitik und die bestehenden mitgliedstaatlichen Vorbehalte zu umgehen und ihre Legislativvorschläge mit industriepolitischen, binnenmarktbezogenen Ansatzpunkten zu begründen.15
Zusammenführen, was zusammengehört
GASP und GSVP haben in der Corona-Pandemie also unterschiedliche Entwicklungen genommen. Während die GSVP finanziell eher gestärkt wird, stagniert die GASP bzw. wird partiell abgebaut. Mehr noch: Während die EU-Mitgliedstaaten wichtige Entwicklungsschritte verhindern (Mehrheitsentscheidungen), zerfasern die Zuständigkeiten für das Außenhandeln der EU in der EU-Kommission weiter. Fünf Kommissare sind nunmehr für Teilgebiete des auswärtigen Handelns verantwortlich. Die Kompetenzen für Europas digitale Souveränität liegen teilweise bei den Mitgliedstaaten, teilweise bei den Kommissaren für den Binnenmarkt und für den Verteidigungsfonds, für Wettbewerbs- und Industriepolitik, für Handel, teilweise aber auch beim Hohen Vertreter. Dessen Stellung innerhalb der Kommissionshierarchie blieb die eines regulären Vizepräsidenten und hat damit im Vergleich zur Juncker-Kommission formal an Gewicht verloren.
Damit die Corona-Pandemie auch in der GASP einen Integrationsschub auslösen kann, müssten sich die Mitgliedstaaten zur Supranationalität bekennen.16 Sie sollten jene Politikbereiche, in denen die Union bisher nur über eine begrenzte Kompetenzausstattung verfügt und die nicht der Gemeinschaftsmethode folgen, dem supranationalen Verfahren unterwerfen, indem sie die mit dem Vertrag von Lissabon eingeführte »Brückenklausel« (Art. 48 Abs. 7 EUV) nutzen. Nur so lässt sich die Soft Power der GASP mit der Hard Power der GSVP verzahnen. Nur so können der Binnenmarktschutz, die Absicherung von Lieferketten und Wertschöpfungsprozessen durch eine strategische Lagebildanalyse ergänzt werden. Resilienz, verstanden als smarte Resilienz, bedeutet, auf Herausforderungen frühzeitig, flexibel und abgestimmt zu reagieren.17 Nur auf diese Weise wird die EU auch das Funktionieren des Binnenmarkts gewährleisten. Drei Kernprojekte sind hierfür zentral:
In dem geplanten Schlüsseldokument der GSVP, dem »Strategischen Kompass«,18 müssen die Grundlagen zur gemeinsamen strategischen Vorausschau fixiert werden. Die Fähigkeit, mit dem Unerwarteten umzugehen, muss zur zentralen Fähigkeit Europas, zum Attribut seiner Resilienz werden. Unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft wurde eine gemeinsame Bedrohungsanalyse initiiert. Im Juni 2020 hat der Außenministerrat den Hohen Vertreter der EU für die Außen- und Sicherheitspolitik damit beauftragt, dieses Dokument in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten zu erarbeiten. Der Kompass soll unter französischer Ratspräsidentschaft Anfang 2022 fertiggestellt sein.
Die Außen- und die Sicherheitspolitik müssen strategisch miteinander verzahnt werden. Die EU-Kommission sollte in ihrem Bestreben unterstützt werden, die verschiedenen Instrumente des auswärtigen Handelns der EU zu verflechten, vor allem die Handels- und Investitionspolitik mit diplomatischen Bemühungen, aber auch mit sicherheits- und verteidigungspolitischen Maßnahmen.19 Unter Vorsitz des HV sollte auf intergouvernementaler Ebene ein ständiger Rat der Verteidigungsminister eingerichtet werden. Dieser sollte die strategischen Prioritäten koordinieren, aber auch die Verteidigungsstrategien der Mitgliedstaaten aufeinander abstimmen. Die Fähigkeit der EU zum Krisenmanagement sollte in Pandemiezeiten durch Rückgriff auf Artikel 44 EUV gestärkt werden. Krisenmanagementmaßnahmen im Namen der EU ließen sich auf Gruppen von willigen Mitgliedstaaten übertragen.
Allein durch massive Investitionen in die technologische und digitale Struktur der Informations- und Kommunikationstechnik kann die EU widerstandsfähiger gegenüber externen Schocks werden und eine nachhaltigere Wirtschafts- und Sozialpolitik aufbauen.20 Im Bereich der Digitalisierung werden die Europäer weiterhin nicht mit den USA und China konkurrieren können. Die EU-Staaten dürfen insbesondere bei der Schlüsseltechnologie der Künstlichen Intelligenz, die für eine künftige Außen- und Sicherheitspolitik von zentraler Bedeutung sein wird, nicht länger hinter den USA herhinken.
Raphael Bossong / Bettina Rudloff
Resiliente Versorgung in Krisenzeiten: Mehr politikfeldübergreifende Koordination zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten
Die Bekämpfung der Covid‑19-Pandemie hat die Europäische Union (EU) und ihre Mitgliedstaaten vor Schwierigkeiten gestellt, die verschiedene strategische Fragen aufwerfen: Wie kann die EU in Zukunft gegenüber solchen heftigen Krisen widerstandsfähiger, also resilienter werden? Dahinter stehen drei Herausforderungen, die zwar seit langem diskutiert werden, aber nun durch die Corona-Krise bei hochrangigen Politikern und Politikerinnen Priorität gewonnen haben.
Erstens verdeutlicht die Pandemie, wie schnell durch transnationale Kaskadeneffekte ernsthafte Schäden entstehen können, und zwar über alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sektoren hinweg. Die Corona-Krise ist vergleichbar mit anderen schwerwiegenden systemischen Risiken1 – etwa dem Klimawandel oder der Abhängigkeit von verwundbaren globalen Informationsnetzwerken. Resilienz gegenüber diesen Risiken muss deshalb eine große Bandbreite sogenannter »kritischer Infrastrukturen« umfassen, die für das Funktionieren unserer Gesellschaft und Wirtschaft als entscheidend angesehen werden.
Dazu wäre freilich zu klären, was genau einzelne Politikfelder und oft auch einzelne Mitgliedstaaten unter »kritischen« Strukturen verstehen. Die zurzeit vorhandenen Unterschiede diesbezüglich erschweren eine gemeinschaftliche Analyse, wie europaweit wirkenden Risiken sinnvoll begegnet werden kann.
Daran schließt sich die zweite Herausforderung an: die kohärente Koordinierung meist national beschlossener Krisenmaßnahmen. Wie schwierig dies ist, trat in der ersten Phase der Pandemiebekämpfung offen zutage: Die ersten national angestoßenen Reaktionen erwiesen sich teils als kontraproduktiv, etwa die eingeschränkte Personenfreizügigkeit und der begrenzte Binnenhandel selbst für dringend benötigte medizinische Güter. Die EU-Kommission hatte große Mühe, den Binnenmarkt und die Schengen-Zone aufrechtzuerhalten. Anders als die Mitgliedstaaten hat die EU jedoch bislang keine eigenständige Notfallkompetenz für den Schutz der öffentlichen Ordnung. Daher müssen andere Mechanismen und Mittel zum operativen Krisenmanagement gefunden werden.2
Drittens ist langfristig abzuwägen, wie Versorgungssicherheit und Resilienz am besten gestärkt werden können: ob nach innen durch Protektionismus oder gemeinschaftlich durch internationale Offenheit und Vernetzung.3 Im akuten Krisenmanagement drängen typischerweise protektionistische Ansätze in den Vordergrund. Allerdings profitieren gerade Deutschland und die EU von internationaler Arbeitsteilung – nicht nur für die eigene Versorgung, sondern auch als großer globaler Anbieter essentieller Dienstleistungen und Güter (der indes unter versorgungsbedingter Protektion anderer Akteure leidet).
Erste Schritte zur Reform strategisch wichtiger Infrastrukturen und Industrien
Als unmittelbare Antwort auf die Pandemie hat die EU-Kommission das Ziel einer »Gesundheitsunion« ausgegeben.4 Eine vertragliche Änderung der EU-Zuständigkeit für die öffentliche Gesundheit steht derzeit aber nicht in Aussicht. Deswegen werden viele Maßnahmen zur Verbesserung der medizinischen Versorgungssicherheit eher pragmatisch vorangetrieben. So wird angestrebt, die Beschaffung von Medikamenten und Schutzausrüstung europaweit zu koordinieren. Auch die nationalen Gesundheitssysteme sollen stärker koordiniert und in eine grenzüberschreitende Krisenplanung eingebunden werden.5
Die EU kann sich dabei auf den bestehenden, eher technisch als strategisch verstandenen Unionsmechanismus für den Katastrophenschutz stützen.6 Hiernach teilen die Mitgliedstaaten seit Jahren untereinander und mit Drittstaaten freiwillig Schutzgüter, Rettungstechnik und Einsatzkräfte. Seit 2019 können die EU- und die Teilnehmerstaaten dabei auf vorab designierte Ressourcen der Mitgliedstaaten zurückgreifen (rescEU-Programm), müssen also nicht in jedem Katastrophenfall erneut eine Anfrage nach verfügbaren Hilfsgütern stellen. In der Corona-Krise wurde das rescEU-Verfahren erweitert, um einen Vorrat an medizinischer Ausrüstung anzulegen und zu verteilen. Beispielsweise wurden im Frühjahr rund 330 000 Schutzmasken nach Italien, Spanien und Kroatien geliefert.7 Nach Vorstellungen der Kommission soll dieses gemeinsame Beschaffungs- und Vorratswesen ausgebaut und im Mehrjährigen Finanzrahmen 2021–2027 mit gut 2 Milliarden Euro zusätzlich gefördert werden.8 Dieser mögliche nächste Schritt in Richtung EU-eigener Ausrüstung oder sogar europäischer Katastrophenschutzkräfte stößt bei einigen Mitgliedstaaten noch auf grundsätzliche Bedenken: Sie befürchten eine eventuelle ungleiche Lastenteilung und einen Verlust an Souveränität.
Umfassender wirkt die schuldenfinanzierte »Aufbau- und Resilienzfazilität« von über 670 Milliarden Euro. Dieser Fonds soll nicht nur die finanziellen Folgen der Pandemie abfedern, sondern – zumindest nach Meinung der Kommission – überdies die wirtschaftlichen Strukturen in den Mitgliedstaaten ökologischer und widerstandsfähiger gegen künftige Herausforderungen machen. Nationale Pläne, die für die Vergabe der europäischen Hilfen der Kommission vorgelegt werden müssen, können auch Investitionen in sogenannte kritische Infrastrukturen und in strategische Technologien vorsehen.9 Die EU hat bereits vor der Corona-Pandemie Reformprozesse angestoßen, die sich auf solche Investitionen auswirken können.
Der Schutz kritischer Infrastrukturen umfasst auf EU-Ebene bisher nur zwei Bereiche: Verkehr und Energie, die zudem wenig vernetzt betrachtet werden. Auf mitgliedstaatlicher Ebene dagegen sind weit mehr Sektoren ausgewiesen – in Deutschland beispielsweise neun: neben dem derzeit vordringlichen Sektor Gesundheit unter anderem Ernährung, Wasser, Transport und Verkehr, Medien und Kultur.10 Im Rahmen der für 2021 geplanten Novellierung der EU-Richtlinie zur Ermittlung und Ausweisung europäischer kritischer Infrastrukturen11 sollten nationale und europäische Konzepte deshalb besser abgestimmt werden. Parallel soll die EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit (NIS-Richtlinie) überarbeitet werden,12 sodass sie neue technische Risiken und Möglichkeiten berücksichtigt, Informationsinfrastrukturen anzugreifen.
Der Kommunikationssektor profitiert schon heute vom europäischen Mehrwert, wenn es um die Bewertung von Risiken geht.
Schon jetzt veranschaulicht die NIS-Richtlinie den europäischen Mehrwert, von dem auch andere kritische Infrastrukturen profitieren könnten:13 Im Kommunikationssektor erfolgt die Bewertung von Risiken, die für bestimmte Wirtschaftsbereiche oder Produkte bestehen (können), mit Hilfe einer eigenen EU-Agentur für Cybersicherheit (ENISA) und eines operativen Netzwerks von IT-Notfallteams auf nationaler wie europäischer Ebene (CSIRTs-Netzwerk). Die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens haben die Abhängigkeit von Kommunikationsnetzwerken und Dateninfrastrukturen verschärft. Darüber hinaus ist die Vernetzung zwischen Sektoren einmal mehr deutlich geworden.
Die Investitionsschutzpolitik wird bereits seit längerem aus Gründen der Wettbewerbssicherung ausgebaut. Sie kann einen weiteren Beitrag zur Resilienz leisten: Die neue EU-Verordnung zur Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen (EU-Screening-Verordnung) verpflichtet die EU-Mitglieder ab Oktober 2020 dazu, Investitionen aus Drittstaaten daraufhin zu prüfen, ob die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet werden könnte, etwa durch zu starke Dominanz ausländischer Unternehmen und die damit verbundene gefürchtete Abhängigkeit.14 Als besonders schutzwürdig werden nicht nur die Wirtschaftsbereiche angesehen, die üblicherweise auf nationaler Ebene als kritische Infrastrukturen designiert sind, sondern auch strategische europäische technologische Entwicklungen und Investitionen, wie das Satellitennavigationssystem Galileo.
In ähnlicher Weise wird die EU-Industriepolitik als Bestandteil einer umfassenden Resilienz verstanden. Die Corona-Krise hat zum einen der Forderung Nachdruck verliehen, europäische Unternehmen vor ausländischen Übernahmen zu schützen. Zum anderen hat sie den Wunsch nach mehr europäischer Autonomie in medizinischer Forschung und Produktion befeuert. Neben einer möglichen Rückverlagerung von Teilen der Arzneimittelproduktion nach Europa wird angestrebt, eine europäische Agentur für fortgeschrittene biomedizinische Forschung und Entwicklung (BARDA) zu gründen,15 die enger im Verbund mit der Industrie agieren könnte.
Koordinierung und Kohärenz für Versorgungssicherheit in der Rohstoff- und Handelspolitik
Mit Blick auf ein All-Gefahren-Risikomanagement ist für die kommenden Jahre wichtig, die genannten Politikfelder (Schutz kritischer Infrastrukturen, Investitionsschutz- und Industriepolitik) stärker miteinander und mit weiteren EU-Politikbereichen zu koordinieren. Exemplarisch für den Bedarf an Kohärenz stehen die Agrarpolitik als eine historisch gewachsene Politik zur Rohstoffversorgung und die europäische Handelspolitik.
Eine sichere Versorgung mit Nahrung ist in allen Ländern der Welt explizites Politikziel, gilt als Menschenrecht und ist in der EU bereits 1958 in den Römischen Verträgen definiert worden. Die frühe Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) brachte indes oft widersprüchliche Wirkungen zwischen innereuropäischer Versorgung und der Versorgung in Drittländern hervor.16 Sie gilt als Paradebeispiel einer protektionistischen Politik, die durchaus zunächst große Versorgungserfolge erzielte. Zur Umsetzung nutzte sie vor allem Typen von Subventionen, die die heimische Produktion anheizten und durch hohe Zölle den europäischen Markt gegen günstigere Importe abschotteten. Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) für mehr Marktoffenheit haben zum Abbau dieser Subventionsart und der Zollniveaus geführt, sodass die für andere Länder preisdrückenden und versorgungsriskanten Exporte europäischer Überschüsse abnahmen.
Durch die »Bedrohungskulisse« der Corona-Krise bekommen jedoch konservative agrarpolitische Positionen für die Haushaltsphase ab 2021 neuen Auftrieb: Hiernach wird die EU wieder stärker als »Versorger« aufgefasst, sowohl für die eigenen Mitgliedstaaten als auch für die Welt. Diese Sichtweise erschwert möglicherweise weitere Agrarreformen, die auf weniger Mengen- und mehr Qualitätsproduktion abzielen, ebenso wie die begonnene stärkere ökologische Ausrichtung der GAP.
Dass die Agrarpolitik mit anderen Politikfeldern übergreifend koordiniert werden muss, hat die Schließung der Binnengrenzen zu Beginn der Pandemie gezeigt. Die Folge war ein zeitweiliger Fachkräftemangel nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch ein Mangel an landwirtschaftlichen Saisonarbeitskräften. Ferner gibt es Berührungen mit den Politikfeldern Katastrophenschutz und kritische Infrastrukturen. In Deutschland wird die Ernährungsversorgung als kritische Infrastruktur nach wie vor durch eine Krisenreserve des Katastrophenschutzes sichergestellt. Anders auf EU-Ebene: Die Reserven der GAP zur Marktstabilisierung werden zusehends abgebaut. Wegen hoher Kosten stand die strategische Vorratshaltung von Lebensmitteln immer wieder in der Kritik. Dies könnte sich durch die Corona-Krise nun ändern. Andere Mitgliedsländer wenden alternative Krisenmaßnahmen an, indem sie die Privatwirtschaft verpflichten, die Versorgung für einen bestimmten Zeitraum zu garantieren.
Auch in der EU-Handelspolitik als europäisierter Politik steht zur Debatte, wie offener Handel und Versorgungssicherheit in Einklang gebracht werden können.17 Ausdruck dafür ist das übergeordnete und in sich widersprüchlich anmutende Ziel der jüngsten EU-Handelsstrategie, die »open strategic autonomy«.18 Handelspolitik und WTO-Regeln kennen diese Ambivalenz zwischen Offenheit und Abschottung, zum Beispiel werden Versorgungskrisen und der Schutz nationaler Sicherheit anerkannt als Ausnahmen vom ansonsten geltenden Leitprinzip des offenen Handels. So sind für »essentielle« oder »sensible« Produkte sogar die am stärksten handelsbegrenzend wirkenden Exportverbote möglich. Seit März 2020 wurden circa 300 neue handelsbeschränkende Maßnahmen wie Exportverbote für Medizin- und Lebensmittelprodukte bei der WTO notifiziert, die mit der Corona-Pandemie begründet wurden.19 Etwa 20 davon kamen von Seiten der EU und ihrer Mitglieder. Grundsätzlich aber unterstützt die EU offenen Handel auch weiterhin: Beispielsweise verfolgt sie eine Präzisierung der bislang schwachen WTO-Kriterien für Exportbeschränkungen und nutzt seit Pandemiebeginn handelsfördernde Maßnahmen wie eine erleichterte Zolldokumentation.
Gesamtstrategie für vorausschauende Resilienz
Europäische Resilienz bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Stärkung der nationalen bzw. innereuropäischen Versorgung einerseits und weltweiter Offenheit und Solidarität andererseits. Dabei gilt es, viele verschiedene Gefahren und Risiken für die Zukunft im Blick zu haben, auch jenseits der zurzeit vordringlichen Pandemie. Allerdings werden bei einem All-Gefahren-Ansatz sehr unterschiedliche Sektoren und Infrastrukturen angesprochen, die Kompetenzen in den beteiligten Politikbereichen sind unterschiedlich zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten verteilt. Zugleich muss Resilienz als dezentrale Verantwortung aller Behörden und der gesamten Gesellschaft verstanden werden, wie sich im Umgang mit der Corona-Pandemie wiederholt gezeigt hat. Daher kann es keine allgemeingültige europäische Strategie für die Risikovorsorge geben.
Der aktuelle Vorschlag der Kommission ist dennoch sehr zu begrüßen: Er sieht vor, im Rahmen der strategischen Vorausschau unterschiedliche Krisen und bestehende Resilienz kontinuierlich und systematisch zu beobachten sowie Politikfelder zu vernetzen.20 Auch die Idee, quantitative Indikatoren für Resilienz (»Resilienz-Dashboards«) zu definieren, dient der Frühwarnung.
Vor allem kann die EU bessere Antworten auf die zweite und die dritte der eingangs genannten Herausforderungen finden: Für die Kohärenz zwischen Krisenmaßnahmen sollten neue Investitionen und industriepolitische Instrumente der EU abgestimmt werden mit dem neuen Rechtsrahmen für europäische kritische Infrastrukturen. Am Beispiel der EU‑Agrar- und -Handelspolitik sollte demonstriert werden, wie die Balance zwischen offenem Handel und Versorgungsschutz gelingen kann und dass der Krisenreflex der Versorgungssicherheit nicht mit Protektion gleichzusetzen ist.
Ergänzend sollte die Diskussion über gesamteuropäische Krisenmechanismen fortgeführt werden. So könnte etwa die sogenannte Solidaritätsklausel aus Artikel 222 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) wirksamer genutzt werden. Gemäß dieser Klausel hat die EU im Falle einer Naturkatastrophe, einer vom Menschen verursachten Katastrophe oder eines Terroranschlags »alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel« zu mobilisieren, um den betroffenen Mitgliedstaat zu unterstützen. Praktisch erschöpft sich dies bisher in einem offenen Koordinationsverfahren (Integrated Political Crisis Response Arrangements).21 Die jüngste Reform des EU-Katastrophenschutzmechanismus wird zwar einige neue finanzielle Mittel erschließen, kann aber den Anspruch auf verlässliche und umfassende Hilfe nicht allein erfüllen. Die Solidaritätsklausel sieht vor, dass sich der Europäische Rat regelmäßig mit europaweiten Bedrohungen befasst. Dies zumindest könnte in Zukunft besser eingelöst werden. Die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie sollten als Anstoß dafür dienen, dass die Staats- und Regierungschefs ihre Prioritäten überdenken und dass Reformprozesse eingeleitet werden, die für mehr vorausschauende Resilienz sorgen.
Eine Pandemie, die mit massiven wirtschaftlichen Einschränkungen einhergeht, hat zwangsläufig großen Einfluss auf die Klima- und Energiepolitik. Dies gilt nicht nur mit Blick auf die zentralen Stoffströme, etwa Energieverbrauch und Emissionen. Es gilt in mindestens gleicher Weise auch für die politischen Kapazitäten und ökonomischen Voraussetzungen einer gesteuerten Transformation. Als erstaunlich resilient hat sich dabei bislang der European Green Deal erwiesen, eines der Flaggschiff-Projekte der Kommission von der Leyen. Zwar gab es seit Beginn der Pandemie von Seiten der Visegrád-Staaten und einzelner Branchenverbände Versuche, den Ehrgeiz der EU mit Verweis auf die sozioökonomische Krisenlage zu bremsen. Doch mit der – von Frankreich und Deutschland gestützten – Entscheidung der Kommission, dem Wiederaufbauprogramm »Next Generation EU« eine erkennbar grüne Note zu geben, hat sich das in der europäischen Umweltpolitik seit langem etablierte Paradigma einer ökologischen Modernisierung nicht nur als krisenfest erwiesen; das Narrativ vom Grünen Wachstum etabliert sich nun zunehmend auch im Mainstream.
Allerdings ist noch keineswegs ausgemacht, dass das zentrale Ziel des Green Deal – das Erreichen von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 – für die EU tatsächlich auf Dauer handlungsleitend bleibt. Das Versprechen, dass sich das klimawissenschaftlich Notwendige mit dem wirtschaftspolitisch Gewünschten vereinbaren lässt, muss in der Wahrnehmung der Regierungen, Parlamente, Unternehmen, Medien und der Bevölkerung auch sichtbar vermittelt werden, um in den kommenden Jahren tragfähig zu bleiben. Dass es der Kommission in der Pandemie gelungen ist, in erheblichem Umfang zusätzliche Mittel zu mobilisieren und diese Ausgaben in den Kontext einer grünen Transformationsagenda zu stellen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine große Herausforderung bleibt, die nachhaltige Transformation europäischer Volkswirtschaften unter (Post-)Krisenbedingungen auch tatsächlich umzusetzen.
Ökonomische und technologische Herausforderungen
Im Zentrum des Green Deal steht der Umbau des Energiesystems, das für mehr als 75 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Die Auswirkungen der Pandemie lassen sich in diesem Bereich bislang nur schwer abschätzen. Temporäre Einschnitte bei Energieverbrauch und Emissionen sind nicht gleichzusetzen mit den notwendigen Strukturbrüchen und dem grundlegenden Umbau, die Voraussetzung sind für eine Dekarbonisierung des Energiesystems. Meist wirken kurzfristige Überbrückungshilfen strukturkonservativ, weil sie primär auf die Erhaltung von Unternehmen und Branchenstrukturen (z.B. im Luftverkehr) setzen, nicht auf deren Transformation.
Politische Rhetorik und langfristige Zielsetzungen sind dem Status quo inzwischen weit enteilt. Zwar hat Europa einen Boom bei erneuerbaren Energieträgern erlebt. Da dieser bislang aber im Wesentlichen auf den Stromsektor beschränkt bleibt, liegt der Erneuerbaren-Anteil am gesamten Energieverbrauch (inkl. Verkehr, Industrie und Gebäude) erst bei knapp 20 Prozent. Auch der Blick auf den zentralen Indikator für den Green Deal ist eher ernüchternd: Von 1990 bis 2019 – also auf knapp der halben Wegstrecke bis 2050 – sind die Emissionen der EU-27 erst um 24 Prozent gesunken. In den kommenden dreißig Jahren soll nun also die dreifache Reduktionsleistung erbracht werden, wobei sich noch nicht genau abschätzen lässt, in welchem Ausmaß die Emissionen 2020 pandemiebedingt sinken werden und wie stark der Nachholeffekt in den Folgejahren ausfallen wird.
Neben dem weiteren Ausbau der Erneuerbaren werden nun verstärkt der Umbau langlebiger Infrastrukturen, vor allem die Modernisierung des Gebäudebestands sowie der Strom- und Verkehrsnetze, und der Aufbau einer klimafreundlichen Versorgung mit Wasserstoff ins Zentrum der Transformation der Energieversorgung rücken.
Die Pandemie wird auf die Bereitschaft privater Investoren, Infrastrukturen zu modernisieren und in neue Anlagen zu investieren, eher dämpfend wirken, so dass vielfach mit massiven Staatshilfen gegengesteuert werden muss. Bei der energetischen Sanierung des Gebäudebestands besteht ebenso großer Nachholbedarf wie bei der Modernisierung der Stromnetze. Dies gilt zum einen für den grenzüberschreitenden Aus- und Umbau der Netze, auch bei geopolitisch wichtigen Projekten wie der geplanten, bis 2025 zu vollziehenden Einbindung des Baltikums und der Ukraine in das kontinentaleuropäische Stromsystem. Zum anderen betrifft es die Digitalisierung, die auch wegen der erforderlichen Integration volatiler Wind- und Solarenergie in die Stromversorgung immer dringlicher wird. Benötigt wird ein intelligentes Management, das nicht nur das Stromnetz stabilisiert und Angebot und Nachfrage effizienter managt, sondern auch die Sektorenkopplung erleichtert, das heißt die Vernetzung bislang getrennter Teilsysteme. Dazu zählt etwa der weitgehend zu elektrifizierende Individualverkehr. Hier sind schon die Erfahrungen der Vorkrisenzeit ernüchternd. So gibt es beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge große Rückstände. Die negativen Folgen machen sich bei der nur schleppend voranschreitenden Dekarbonisierung des Individualverkehrs ebenso bemerkbar wie bei der mangelhaften Resilienz des Systems gegenüber Cyberangriffen. Der Einsatz smarter Messgeräte in der EU gleicht einem Flickenteppich, nicht nur in Bezug auf die Sicherheitsstandards und die Messleistungen, sondern auch auf den Roll-out.
Während es bei Gebäudebestand und Stromnetzen eher darum gehen wird, Versäumnisse der Vergangenheit wettzumachen, liegt für Deutschland und Europa in der nun anstehenden Dekarbonisierung energieintensiver Industriezweige und des Luft- und Schwerlastverkehrs die Chance, eine neue energie-, technologie- und industriepolitische Erfolgsstory zu schreiben. Nicht zuletzt deshalb ist der Aufbau einer klimafreundlichen Wasserstoffwirtschaft – obwohl ursprünglich nicht im Green-Deal-Konzept enthalten – inzwischen zu einem Schlüsselprojekt geworden. Zwar zählen Deutschland und die EU in technologischer Hinsicht zu den globalen Vorreitern bei der Herstellung von Wasserstoff mittels Elektrolyse, doch im Hinblick auf den industriellen Einsatz von »grünem« Wasserstoff auf der Basis erneuerbaren Stroms stellen sich immer noch grundlegende Fragen: Ist die Anwendung wirtschaftlich? In welchem Umfang und wie schnell kann die Technik eingesetzt werden? Die Kosten für die Herstellung von grünem Wasserstoff lagen 2018 mehr als doppelt so hoch wie für den bislang dominierenden »grauen« Wasserstoff auf fossiler Basis, während sich »blauer« Wasserstoff (auf Basis von Erdgas mit CO2-Abscheidung und Speicherung) kostenmäßig dazwischen bewegt. In Deutschland wird in der kommenden Dekade allerdings ein großer Teil des Erneuerbaren-Ausbaus zunächst dafür benötigt, wegfallende Atom- und Kohlestromkapazitäten zu ersetzen. Da bislang zugleich fast 60 Prozent des Primärenergiebedarfs der EU-27 durch Einfuhren gedeckt werden, werden Wasserstoffimporte zukünftig eine große Rolle spielen, allerdings nicht notwendigerweise aus jenen Ländern, die gegenwärtig das Gros der Öl- und Gaslieferungen bereitstellen.
Politische und regulatorische Herausforderungen
Das inzwischen von allen Mitgliedstaaten akzeptierte Ziel, EU-weit Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu erreichen, lässt sich nur realisieren, wenn auch das geltende Reduktionsziel für 2030 deutlich verschärft wird. Es wurde 2014 im Konsens der Staats- und Regierungschefs auf 40 Prozent (im Vergleich zum Basisjahr 1990) festgelegt und soll nun nach dem Willen der Kommission auf mindestens 55 Prozent angehoben werden – eine mehr als deutliche Steigerung für einen nur noch kurzen Zeitraum. Sobald sich der Europäische Rat auf ein höher gestecktes Gesamtziel festgelegt hat und die Verhandlungen über das EU-Klimagesetz abgeschlossen sind, müssen auch die bestehenden klimapolitischen Rechtsakte angepasst werden. Dies betrifft nicht nur die Gewichtung zwischen den drei zentralen Säulen – dem europäisierten Emissionshandel, der mitgliedstaatlichen Lastenteilung für die Sektoren jenseits des Emissionshandels und der Verordnung über Landnutzung und Forstwirtschaft –, es erfordert auch die Festlegung neuer Ziele für den Anteil erneuerbarer Energieträger, für die Steigerung der Energieeffizienz und vermutlich verschärfte CO2-Grenzwerte für PKWs und LKWs. Daneben wird das stark erhöhte Dekarbonisierungstempo auch neue regulatorische Lösungen notwendig machen, etwa zum Einbezug von Emissionssenken. Die entsprechenden Verhandlungen zwischen Rat und Parlament werden erst 2022 abgeschlossen.
Während die Auseinandersetzungen um den Stellenwert der Green-Deal-Agenda in der ersten Phase vor allem diskursiv ausgetragen und in der zweiten Phase mit zusätzlichen Mittelzuweisungen aus dem Wiederaufbauprogramm »Next Generation EU« abgefedert wurden, folgt nun eine Phase der Verteilungskämpfe um die bis 2030 deutlich reduzierten Emissionsberechtigungen. Diese werden sich – für die breitere Öffentlichkeit deutlich erkennbar – vor allem als Konflikte zwischen Gruppen von Mitgliedstaaten und zwischen Branchen materialisieren. Es wird dabei nicht nur innerhalb Europas, sondern auch in der internationalen Wahrnehmung des Vorreiters EU schnell deutlich werden, dass das Paradigma der ökologischen Modernisierung in der konkreten Praxis nach wie vor auf große Vorbehalte stößt. Zwar handelt es sich beim Green Deal um eine zunehmend populäre Chiffre, aber es fällt den zentralen Akteuren keineswegs leicht, sich auch wirklich auf einen Deal zu einigen.
Damit das Narrativ vom Grünen Wachstum glaubwürdig bleibt, könnte ein CO2-Grenzausgleich nötig werden.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich der Europäische Rat noch unter deutscher Präsidentschaft auf ein Emissionsminderungsziel von 55 Prozent einigen wird. Gleichwohl dürfte es nicht gelingen, mit dem bisherigen Muster zu brechen, dass die klimapolitischen Nachzügler in Mittel- und Südosteuropa Zielverschärfungen nur dann akzeptieren, wenn sie von einem Großteil der zusätzlichen Anstrengungen ausgenommen werden. Dies wird nicht zuletzt zu Reibungen mit den Frugal Four (Dänemark, Niederlande, Österreich, Schweden) führen, die seit langem auf ein höheres Maß an Konvergenz in der EU-Klimapolitik drängen. Diese Konflikte werden sich zumindest teilweise durch ein verändertes Policy-Design einhegen lassen. Dazu zählt etwa die Einbeziehung forstwirtschaftlicher Senken in die EU-Zielkalkulation, eine mögliche Wiederzulassung von Emissionsgutschriften aus Klimaschutzprojekten in Drittstaaten oder eine Abschwächung der Bedeutung nationaler Reduktionsziele durch Verschiebung des Verkehrs- und des Gebäudesektors in den Emissionshandel. Mit der letztgenannten Maßnahme könnte die Höhe der Strafzahlungen begrenzt werden, die den West- und Nordeuropäern bei Verfehlung vergleichsweise hoher Vorgaben drohen.
Unabhängig von internen Verteilungskonflikten wird sich die EU mit einem zunehmenden Regulierungsbedarf konfrontiert sehen, der sich bei dem Bemühen ergeben wird, die Dekarbonisierung des Energiesystems zügig zu steuern. Auch die Zahl der geoökonomischen Konflikte wird nicht sinken. Im Mittelpunkt dürfte dabei stehen, den Abstand zwischen den europäischen Produktionskosten und jenen der wichtigsten Handelspartner zu begrenzen. Zwar wird der Ausbau der Kapazitäten für die Produktion und den Transport von Wasserstoff großzügig aus öffentlichen Mitteln gefördert. Doch dürfte es bei angespannten Post-Krisen-Budgets nicht möglich sein, in großem Maßstab finanzielle Hilfen bereitzustellen, um Differenzkosten in der Produktion – etwa zwischen »grünem« und konventionellem Stahl – zu überbrücken. Sollten sich andere Industrie- und Schwellenländer nicht in naher Zukunft auf einen deutlich ehrgeizigeren Klimaschutzpfad begeben, wird die EU deshalb entscheiden müssen, ob sie bereit ist, durch den Einsatz eines CO2-Grenzausgleichsmechanismus (etwa einer CO2-Steuer auf Importe) ihren klimapolitischen Ehrgeiz auch in handelspolitischen Konflikten unter Beweis zu stellen. Falls nicht, wird das Narrativ vom Grünen Wachstum an Glaubwürdigkeit einbüßen – entweder weil industrielle Wertschöpfung in andere Weltregionen abwandert oder weil die EU sich gezwungen sieht, ihre Transformationsbestrebungen erkennbar zurückzuschrauben.
Notwendige Fortschritte
Die angesichts des fortschreitenden Klimawandels gebotene Transformation der europäischen Volkswirtschaften sähe sich auch ohne die Pandemie vielfältigen Herausforderungen gegenüber. Ein radikales Umsteuern in relativ kurzer Zeit kollidiert mit einer Fülle technischer, wirtschaftlicher und politisch-regulatorischer Pfadabhängigkeiten. Zwar hat sich das Paradigma der ökologischen Modernisierung, das dem European Green Deal zugrunde liegt, während der eskalierenden Corona-Krise behauptet. Aber es ist nicht ausgemacht, dass die Überzeugung, vorsorgendes Handeln zahle sich langfristig aus, dauerhaft handlungsleitend bleibt. Je einschneidender die ökonomischen Folgen der Pandemie ausfallen, desto geringer dürfte die Bereitschaft der Mitgliedstaaten sein, forcierte Strukturbrüche zu organisieren, die kurzfristig negative Auswirkungen auf Arbeitsmärkte und Sozialsysteme haben könnten.
Die EU hat sich in den vergangenen dreißig Jahren das Image eines klimapolitischen Vorreiters erarbeitet, gemessen am neuen Langfristziel Klimaneutralität aber erst ein Viertel des Wegs zurückgelegt. Es wird nun darauf ankommen, auch unter herausfordernden Rahmenbedingungen zu zeigen, dass dieser Weg sowohl umwelt- als auch wirtschaftspolitisch erfolgreich ist. In den kommenden Jahren sollte die EU ihr Augenmerk deshalb vor allem auf Fortschritte in drei Feldern legen:
Klimapolitisch muss es der EU gelingen, sich intern auf ein ehrgeiziges Ziel für 2030 zu einigen, das ihr nicht nur international Anerkennung einbringt, sondern zugleich ermöglicht, die anschließenden Legislativverhandlungen zügig und ohne große politische Verwerfungen unter den Mitgliedstaaten abzuschließen. Das verschafft den betroffenen Branchen ein Mindestmaß an Planungssicherheit bis 2030.
Industriepolitisch muss die EU insbesondere den Einstieg in eine klimafreundliche Wasserstoffökonomie entschieden vorantreiben, konkret durch das Poolen von Kompetenzen und Ressourcen. Hierin liegt nicht nur eine große Chance für die Dekarbonisierung der europäischen Industrie und des Luft- und Güterverkehrs. Damit einhergehen könnten eine sichtbare globale Technologieführerschaft und die Möglichkeit, international frühzeitig Regulierungsstandards zu setzen.
Außenwirtschaftspolitisch schließlich muss es der EU gelingen, ihren Vorreiterstatus abzusichern, indem sie bei den Produktionskosten die Kluft zu anderen Industrie- und Schwellenländern nicht zu groß werden lässt. Dabei wird sie zum einen Wege finden müssen, ihre Öl- und Gaslieferanten in die neue Energiewelt mitzunehmen, etwa als Produzenten für klimafreundlichen Wasserstoff. Zum anderen dürfte es notwendig werden, die eigenen Klimaschutzambitionen mit dem dosierten Einsatz handelspolitischer Instrumente zu untermauern.
Muriel Asseburg / Wolfram Lacher / Guido Steinberg
Regionale Unordnung in Europas südlicher Nachbarschaft. Konfliktakteure verfolgen Interessen unbeirrt
Die Covid-19-Pandemie hatte in den drei internationalisierten Bürgerkriegen im Nahen/Mittleren Osten und in Nordafrika (Jemen, Libyen, Syrien) in erster Linie zur Folge, dass sich die ohnehin schon katastrophale humanitäre Situation weiter verschlechterte. Lokale, regionale und internationale Akteure haben die Pandemie nicht als Anlass gesehen, zu gemeinsamem Handeln zu finden. Dabei haben die Konfliktdynamiken eine effektive Reaktion auf Covid-19 noch erschwert. Sekundäre Auswirkungen der Pandemie zwangen einige Akteure zwar dazu, ihre operativen Prioritäten anzupassen. Ihre langfristigen Interessen hat dies aber nicht verändert. Daher ist die Pandemie in keinem der drei Fälle zu einer relevanten Determinante des Konfliktgeschehens geworden, und sie hat auch keine Wende in den Konfliktdynamiken herbeigeführt. Dies ist auch für die Zukunft nicht zu erwarten. Denn lokale, regionale und internationale Akteure verfolgen ihre zentralen Interessen unbeirrt weiter. Dabei konzentrieren sich die geostrategischen und geoökonomischen Auseinandersetzungen stärker als zuvor auf den Mittelmeerraum, und damit auf Europas direkte Nachbarschaft. Das größere Maß an Aufmerksamkeit, die das von Deutschland und seinen Partnern in der EU erfordern würde, wird den Entwicklungen bislang allerdings nicht zuteil.
Krisenmanagement und humanitäre Auswirkungen der Pandemie
Die im Frühjahr 2020 weit verbreitete Befürchtung, die Covid-19-Pandemie würde die drei größten Konfliktherde im Nahen/Mittleren Osten und in Nordafrika besonders hart treffen, schien sich zunächst nicht zu bestätigen. Zwar waren die offiziellen Infektionszahlen zunächst relativ niedrig, was unter anderem auf fehlende Testmöglichkeiten und Vertuschung durch die Regierungen zurückzuführen ist. Seit spätestens Sommer 2020 steigt die Zahl der Infizierten zumindest in Syrien und Libyen aber stark an.
Dabei sind alle drei Länder denkbar schlecht für die Bewältigung der Pandemie gerüstet: Die Gesundheitsinfrastruktur hat unter dem Staatszerfall und den bewaffneten Auseinandersetzungen der letzten Jahre massiv gelitten; Krankenhäuser und Erstversorgungseinrichtungen sind großenteils zerstört oder geplündert; medizinisches Personal ist vielfach geflohen; es mangelt an Ausrüstung (vor allem an Testequipment und Beatmungsgeräten) und Medikamenten. Ausländisches medizinisches und humanitäres Personal hat keinen Zugang zu vielen Regionen. Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge und Insassen von Haftanstalten und Gefangenenlagern sind aufgrund katastrophaler hygienischer Bedingungen und der Unmöglichkeit, sich in den dort herrschenden beengten Verhältnissen physisch Abstand zu halten, besonders hohen Risiken ausgesetzt.
Maßnahmen, die in den Ländern selbst oder in Nachbarländern ergriffen wurden, um die Pandemie einzudämmen, verschlechterten die ohnehin schon prekäre humanitäre Situation vor allem im Jemen und in Syrien weiter. Insbesondere nahm die Arbeitslosigkeit zu, Einkommensmöglichkeiten und Rücküberweisungen verringerten sich; die Lebensmittelpreise stiegen (vor allem in Syrien) enorm an, und den Menschen vor Ort fiel es zusehends schwerer, sich selbst zu versorgen. Das Corona-Krisenmanagement verschärfte infolgedessen die sich ohnehin zuspitzende Wirtschafts- und Währungskrise, etwa in Syrien. Im Juni 2020 warnten die UN vor einer Hungersnot in Syrien; im Jemen hat schon vor Jahren eine Hungerkrise eingesetzt.
Pandemiebewältigung im Konflikt
UN-Generalsekretär António Guterres forderte im März 2020 einen globalen Waffenstillstand, um die Eindämmung der Pandemie und humanitäre Hilfe zu erleichtern. Dieser Forderung kamen – auch nach deren Bekräftigung durch Sicherheitsratsresolution 2532 (Juli 2020) – die Konfliktparteien in den drei internationalisierten Bürgerkriegen im Nahen/Mittleren Osten und in Nordafrika nicht nach. In Libyen eskalierten die Kampfhandlungen ab März sogar massiv. Eine Ausnahme bildete eine einseitig von den kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräften (Syrian Democratic Forces, SDF) verkündete Feuerpause im Nordosten Syriens, die allerdings nur die Waffenruhe bestätigte, die mit dem türkisch-russischen Abkommen vom Oktober 2019 für das nordöstliche Grenzgebiet beschlossen worden war. Eine weitere Ausnahme war eine sechswöchige Feuerpause Saudi-Arabiens im Jemen, die jedoch schon im Mai endete, woraufhin die Kampfhandlungen erneut aufflammten.
Eine effektive Eindämmung der Pandemie und die Gewährung humanitärer Hilfe wurden in allen drei Fällen erschwert oder konterkariert: durch fortgesetzte Kampfhandlungen, die Fragmentierung der territorialen Kontrolle, Zugangsbeschränkungen für humanitäre Akteure und deren Weigerung, mit lokalen De‑facto-Autoritäten zusammenzuarbeiten. Die Konfliktparteien unterliefen Grenzschließungen und Reiseverbote, indem sie fortwährend Kämpfer verlegten. Auch änderte keiner der entscheidenden externen Akteure seinen Kurs, um die Möglichkeit zu eröffnen, den aus der Pandemie resultierenden humanitären Bedürfnissen wirksam zu entsprechen. Aufgrund russischer (und chinesischer) Vetos wurde etwa der Zugang nach Syrien für grenzüberschreitende Hilfsleistungen der UN immer weiter eingeschränkt (so dass zuletzt Sicherheitsratsresolution 2533 vom Juli 2020 nur noch einen internationalen Grenzübergang für solche Lieferungen vorsah).
Indirekte Auswirkungen der Pandemie
Primäre und sekundäre Effekte der Pandemie zwangen regionale und internationale Konfliktakteure in unterschiedlichem Ausmaß, ihre Prioritäten und Vorgehensweisen vor Ort anzupassen. Dabei hängt der Anpassungsdruck in hohem Grade davon ab, wie stark die Akteure in ihrer eigenen Heimat von der Pandemie betroffen waren bzw. sind (und sich in der Folge gezwungen sahen, Personal nach Hause zu beordern, damit es dort im Kampf gegen die Pandemie hilft), in welchem Ausmaß ihr Einsatz am Konfliktschauplatz von der Pandemie berührt wird (Militärberater und Bodentruppen mussten Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, während Luftwaffen kaum Einschränkungen hatten, ebenso wenig wie Akteure, die vor allem auf Anschläge setzten) und wie sehr ihre Ressourcen durch die sekundären Effekte der Pandemie beschnitten werden (etwa durch das jähe Fallen des Öl- und Gaspreises oder den Einbruch der Wirtschaft infolge von Lockdown-Maßnahmen).
Vor allem der Iran, das im Nahen Osten von der Pandemie am stärksten betroffene Land, sah sich gezwungen, seine Präsenz und Aktivitäten in Syrien einzuschränken. Nicht nur mussten Armee und Revolutionsgarden bei der Eindämmung der Pandemie zuhause helfen. Auch Kontingente der wichtigsten Verbündeten, die libanesische Hisbollah und die irakischen Milizen, wurden in ihre Heimatländer zurückbeordert, um sich an der Bekämpfung des Virusausbruchs zu beteiligen. Im Iran verschärften sich außerdem die wirtschaftlichen Schwierigkeiten als Folge von Lockdown-Maßnahmen und weil der Ölpreis erheblich zurückging, was die Auswirkungen der gegen den Iran verhängten US-Sanktionen noch verstärkte. Dadurch wurden die finanziellen Ressourcen angegriffen, die dem Land zur Verfügung stehen, um die eigene Präsenz aufrechtzuerhalten und um Milizen und lokale Stammesvertreter zu unterstützen, etwa in Deir ez-Zor.
Im Jemen erhöhte der Ölpreisverfall infolge der Corona-Krise den Druck auf Riad, den teuren Krieg zu beenden. Allerdings hatte schon das Ausscheiden der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aus dem Krieg im Sommer 2019 die Saudis in Schwierigkeiten gebracht. Ohne die Schützenhilfe seines wichtigsten Verbündeten war an einen Sieg im Kampf gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen nicht mehr zu denken. Infolgedessen verkündete Riad noch im März 2020 eine einseitige Waffenruhe, die sechs Wochen lang weitgehend hielt. Doch im Mai und Juni brachen erneut Kämpfe aus. Dafür waren vor allem die Huthis verantwortlich, die sich nun in einer so starken Position wähnten, dass sie nicht mehr daran interessiert schienen, den Konflikt in Verhandlungen mit den Saudis beizulegen.
In der Summe hatten diese Anpassungen kaum Auswirkungen auf die vorherrschenden Konfliktdynamiken und führten in keinem der Schauplätze eine Wende herbei. Dies liegt in allererster Linie daran, dass die Konfliktakteure ihre Interessen unbeirrt verfolgen. Besonders deutlich ist das in Libyen, wo die Türkei ihre Intervention trotz Pandemie stark ausgedehnt hat, womit sie Russland, Ägypten und die VAE provozierte, die Gegenseite weiter aufzurüsten. Der Ölpreisverfall könnte die Finanzierung dieser Interventionen allenfalls mittelfristig in Frage stellen.
Zum Teil versuchen regionale Konfliktakteure auch, die wahrgenommene Schwäche anderer oder deren Fokussierung auf die Pandemie auszunutzen, um ihre Interessen umso zielstrebiger durchzusetzen. Israel etwa intensivierte seine Luftschläge in Syrien (und den Nachbarländern) seit dem Frühjahr 2020 noch, um den Druck auf den Iran und seine nichtstaatlichen Verbündeten in einer Zeit zu erhöhen, die für die Islamische Republik ausgesprochen schwierig ist. Der »Islamische Staat« (IS) sah die Situation in Syrien als Gelegenheit, erneut auf sich aufmerksam zu machen. Die Folgen waren ein Anstieg von Anschlägen, Revolten und (versuchte) Gefängnisausbrüche aus den Haftanstalten der SDF.
Unsicherheitskomplex im Nahen/Mittleren Osten und in Nordafrika
Das Zusammenwirken der Dynamiken an den drei Schauplätzen gibt wenig Anlass, eine dauerhafte Stabilisierung der direkten Nachbarschaft Europas zu erwarten. Die Türkei und Russland werden als begrenzt kooperative Kontrahenten in zunehmendem Maße zu dominanten Akteuren nicht nur im östlichen, sondern auch im südlichen Mittelmeerraum. Bei ihrem Konfliktmanagement setzen sie auf bilateralen Interessenausgleich statt auf Konfliktregelung, und sie stufen ihre Eigeninteressen deutlich höher ein als die der lokalen Akteure – von den Zivilbevölkerungen ganz zu schweigen. Die Rückkoppelungen zwischen den Konflikten in Libyen und Syrien mehren sich, nicht zuletzt weil sowohl Russland als auch die Türkei in Syrien Personal für den Kampf in Libyen rekrutieren. Damit steigt auch das Risiko, dass Fehlkalkulationen an einem Schauplatz Waffenstillstände und Konfliktmanagement in dem anderen unterminieren. Der Hegemonialkonflikt zwischen dem Iran und den arabischen Golfstaaten, der die Auseinandersetzungen im Jemen überwölbt, ist in Syrien zwar in den Hintergrund getreten, aber noch immer nicht beigelegt. Bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Israel und den USA auf der einen und dem Iran und Iran-geführten Milizen auf der anderen Seiten bergen erhebliches Potential, Auseinandersetzungen in Syrien, im Irak und im Libanon eskalieren zu lassen. Insbesondere in Libyen verbinden sich die nahöstlichen Spannungen zwischen den VAE und Saudi-Arabien einerseits und der Türkei sowie Katar andererseits zunehmend mit jenen zwischen den Mittelmeeranrainern Ägypten, Israel, Griechenland, Zypern und Frankreich auf der einen und der Türkei auf der anderen Seite. Diese Konfliktlinien spiegeln sich auch in der Einigung Israels und der VAE auf eine Normalisierung ihrer Beziehungen wider, die von den USA vermittelt wurde.
Europa droht nachhaltig an Einfluss auf Konflikte in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zu verlieren.
Im Nahen/Mittleren Osten und in Nordafrika hat sich in den letzten zehn Jahren ein zusehends vielschichtiger und volatiler »Unsicherheitskomplex« herausgebildet. Geprägt ist er durch die Folgewirkungen des »Arabischen Frühlings« – Staatszerfall, komplexe, internationalisierte Bürgerkriege, neu konfigurierte Hegemonialkonflikte und Wettstreite über die Vorherrschaft von Ordnungsvorstellungen, unter anderem den Einfluss des politischen Islam. Hinzu kommen, vor dem Hintergrund von Gasfunden im östlichen Mittelmeer, eine sich verschärfende geostrategische Konkurrenz um Energieressourcen sowie Handels- und Transportwege im Mittelmeerraum. Dies schlägt sich unter anderem in einer verstärkten ökonomischen und militärischen Präsenz externer Akteure, in Achsenbildung und provokanten militärischen, diplomatischen und ökonomischen Manövern mit hohem Eskalationspotential nieder – und das in einer Region, in der es keine etablierten Konfliktregelungsmechanismen gibt.
Herausforderungen und Handlungsoptionen für deutsche und europäische Politik
Trotz Pandemie hält der Trend zur Internationalisierung und Verflechtung der Bürgerkriege im Nahen/ Mittleren Osten und in Nordafrika an. Diese Entwicklungen laufen deutschen und europäischen Interessen zuwider, denn sie erlauben es Akteuren wie Russland, der Türkei und den VAE, ihre Militärpräsenz an den regionalen Brennpunkten zu verfestigen. Damit droht Europa ein nachhaltiger Verlust an Einfluss auf Konflikte in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Gleichzeitig ist Europa von den Auswirkungen dieser Konflikte teils stärker betroffen als die intervenierenden Staaten.
Die in dieser Hinsicht bemerkenswerteste Auswirkung der Pandemie dürfte sein, dass die Europäer mit wirtschaftlichem und gesundheitspolitischem Krisenmanagement beschäftigt und daher noch weniger in der Lage sind, den neuen Anforderungen in ihrer Nachbarschaft gerecht zu werden. Stattdessen haben sich einzelne EU-Mitgliedstaaten insbesondere in Libyen mit den gegnerischen Lagern assoziiert und sind auf diese Weise selbst zu Konfliktparteien geworden. Dies aber macht es der EU unmöglich, eine Vermittlerrolle zu spielen.
Um in der geopolitischen Konkurrenz in der Nachbarschaft glaubwürdig als stabilisierender Akteur auftreten zu können, sollten sich die Europäer intensiver als bisher darum bemühen, die Konflikte einzelner Mitgliedstaaten mit den Regionalmächten zu entschärfen. Dafür bedarf es insbesondere der Vermittlung im Streit um die Exklusiven Wirtschaftszonen im östlichen Mittelmeer. Einen größeren Handlungsspielraum im Umgang mit schwierigen Regionalmächten könnten sich die Europäer zudem verschaffen, indem sie ernsthaft versuchen, Waffenlieferungen an Konfliktparteien zu unterbinden – auch wenn diese lediglich verdeckt in Konflikten intervenieren.
Unmittelbar besteht die Notwendigkeit, die Ausbreitung der Pandemie in den regionalen Konfliktherden so wirksam wie möglich einzudämmen. In diesem Sinne sollten sich die Europäer dafür einsetzen, den Zugang zu humanitärer Hilfe und gesundheitlicher Unterstützung in allen Gebieten der Krisenstaaten auszuweiten. Europa sollte zudem die Zusammenarbeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und anderer internationaler Organisationen mit De-facto-Behörden fördern, nicht zuletzt um die Lage in Haftanstalten und Vertriebenenlagern zu verbessern.
Markus Kaim
Covid-19 und das Krisenmanagement Deutschlands
Die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich seit der Wiedervereinigung am internationalen Krisenmanagement und hat dabei einen spezifischen Ansatz entwickelt. Sie akzeptiert einerseits die Notwendigkeit, sich im gesamten Spektrum militärischer Operationen zu engagieren, hat aber andererseits eine klare Präferenz für ziviles Krisenmanagement. Einsätze im Rahmen der Vereinten Nationen und der Nato sind eher selten (UN, z. B. Mission MINUSMA in Mali) oder quantitativ rückläufig (Nato, z. B. Mission Resolute Support in Afghanistan). Es ist vor allem die Europäische Union mit ihrem Profil als zivil-militärischer Akteur, die den bevorzugten Rahmen für deutsche Beiträge bildet.
Krisen und Krisenmanagement
Angesichts einer großen Begriffsvielfalt kommt man bei der Beschäftigung mit dem Thema nicht umhin, anzugeben, was man unter »Krisen« bzw. »Krisenmanagement« versteht. Hier werden Krisen vor allem als Ereignisse begriffen, die in den Augen internationaler Akteure entweder eine Bedrohung der bestehenden regionalen oder globalen Ordnung und/oder eigener Sicherheitsinteressen darstellen, deren Ausgang offen ist und die daher aktives Eingreifen erforderlich macht. Das unmittelbare Reagieren auf die Gefährdung und die damit verbundene Entscheidungsfindung bilden den Kern des Krisenmanagements. Die internationalen Akteure, die sich für die Lösung bzw. Regelung einer Krise engagieren, verfolgen nicht zwingend das Ziel, die Krise vollständig beizulegen. Oft streben sie lediglich eine Stabilisierung der Lage bzw. Einhegung des Konflikts oder eine Entscheidung an, die ihren eigenen ordnungs- oder sicherheitspolitischen Interessen entgegenkommt.1
Fragt man nach der direkten oder indirekten Wirkung der Covid-Pandemie auf das deutsche Krisenmanagement, so müssten sich eventuelle Effekte an folgenden Kriterien ablesen lassen können:
-
Perception: Nimmt die Bundesregierung existierende Konflikte wegen der Corona-Krise anders (z. B. bezüglich des Konfliktgegenstands, der Konfliktakteure oder der Konfliktaustragung) wahr oder betrachtet sie deren Regelung plötzlich als vorrangig?
-
Policy: Agiert die Bundesregierung seit März 2020 aktiver im Krisenmanagement als zuvor oder hat sie sich zurückgezogen? Hat sie sich seitdem anderen oder weiteren Krisen mit dem erklärten Ziel zugewandt, zum internationalen Krisenmanagement beizutragen? Und verfolgt sie in den existierenden Krisen womöglich andere Lösungsansätze, die durch Covid-19 ermöglicht oder erleichtert worden sind?
-
Possibilities: Gibt es erkennbare Auswirkungen auf die institutionellen und/oder operativen sowie materiellen Fähigkeiten Deutschlands, im Verbund mit anderen Staaten Krisenmanagement zu betreiben? Hier ist vor allem an internationale Organisationen zu denken, die Deutschland für das Krisenmanagement nutzt (EU, Nato, UN).
Nur geringe Wirkung von Covid-19
Ungeachtet der Tatsache, dass die mannigfaltigen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie noch gar nicht recht erfasst werden können, fällt doch ins Auge, dass beim ersten Parameter, der Wahrnehmung und Priorisierung von Krisen, bislang kaum Veränderungen erkennbar sind: Für die Mehrzahl der Krisen, deren Regelung für Deutschland zu Beginn des Jahres 2020 Vorrang genossen hat, zum Beispiel Libyen, Afghanistan, Mali, Ukraine, gilt dies immer noch. So bemüht sich die Bundesregierung weiterhin um ein Nachfolgetreffen der Berliner Libyen-Konferenz vom Januar 2020 und stellt nach wie vor ihre Mittlerdienste bei der Aushandlung eines afghanischen Friedensabkommens zur Verfügung. Der Bundestag hat am 29. Mai 2020 erneut den deutschen Beitrag zu den beiden Missionen in Mali (EUTM Mali sowie MINUSMA) mandatiert, und die Außenminister des »Normandie-Formats« haben am 30. April 2020 ihre Gespräche über einen umfassenden Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien in der Ostukraine fortgesetzt.
Deutschland und die EU haben sich seit März 2020 politisch stark nach innen gewendet.
Damit ist zugleich auch das zweite Kriterium bereits angesprochen: Berlin bemüht sich weitgehend, unter schwierigeren Bedingungen in der Substanz fortzuführen, was zuvor schon nicht leicht war oder schnellen Erfolg verhieß, zum Beispiel die Vermittlung im Libyen-Konflikt. Hier unterstützt die Bundesregierung auch weiterhin die UN-Sonderbeauftragte Stephanie Williams, versucht nach wie vor, Druck auf die externen Akteure auszuüben, die mit politischer Unterstützung oder Waffenlieferungen den Konflikt in dem nordafrikanischen Land befeuern, und beteiligt sich an der Operation EUNAVFOR MED IRINI, mit der die EU das Waffenembargo durchsetzen will.2 Neue Initiativen im bereits laufenden Krisenmanagement (in der Form oder in der Sache) sind nicht erkennbar, waren aber auch trotz der exponierten Rolle Deutschlands als EU‑Ratsvorsitz und nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats nicht zu erwarten. Covid-19 hat die Pfadabhängigkeiten des deutschen Krisenmanagements vor dem Hintergrund völlig anderer politischer Prioritäten wenig erschüttert. Zwar sehen manche Beobachter in einer veränderten Konfliktdynamik, die Folge der Pandemie ist, neue Anknüpfungspunkte für das Krisenmanagement, so im Jemen. Aber derartige Bewertungen müssen bis auf Weiteres als vorläufig gelten. Denn die wenigen positiven Effekte der Pandemie auf Krisen im Sinne eines Abflauens einer militärischen Auseinandersetzung oder der Gewährung humanitärer Hilfe werden höchstwahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein.
Geringere Handlungsspielräume
Anders ist die Frage beim dritten Kriterium zu beantworten: Die Pandemie und die damit verbundenen ökonomischen Folgen haben in der deutschen Politik die Handlungsspielräume für das Krisenmanagement verengt. Während die Bundesregierung bis vor wenigen Monaten noch die nichtständige Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat und die EU-Ratspräsidentschaft als Instrumente der Wahl ansah, um eine Reihe internationaler Konflikte einzuhegen, fokussiert sie sich mit ihren Aktivitäten in internationalen Organisationen nunmehr vor allem auf die Eindämmung der nach wie vor grassierenden Pandemie, auf die Abfederung der wirtschaftlichen Folgen des Gesundheitsnotstands und die Suche nach einem wirksamen Impfstoff. Die Covid-Agenda hat die internationale Krisenagenda überlagert, und dies erst recht wieder, nachdem im Herbst 2020 die zweite Pandemiewelle hereingebrochen ist.
Genau wie Deutschland hat sich auch die Europäische Union seit März 2020 politisch stark nach innen gewendet und sich vorwiegend mit der Bewältigung der Covid-Pandemie befasst. Schlagzeilen machte nicht, wie eigentlich geplant, der EU-China-Gipfel im September, der die geopolitische Bedeutung Europas unterstreichen sollte, sondern die Sondertagung des Europäischen Rates im Juli mit ihren Beschlüssen für den Wiederaufbaufonds und zum Mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027. Auch werden der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit ihren jeweiligen Krisenmanagementinstrumenten zurzeit lediglich nachrangige Bedeutung zugemessen, was sich nicht zuletzt an der geringen Ausstattung des Europäischen Verteidigungsfonds im MFR mit 7,014 Milliarden Euro für sieben Jahre ablesen lässt. Der EU fällt es derzeit schwer, politische Impulse außerhalb des Regelbetriebs zu setzen, zum Beispiel in den Beziehungen zur Türkei, in Bezug auf die der Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 2. Oktober noch eine »positive politische EU-Türkei-Agenda« auf den Weg bringen wollte. Unter dem Strich ist somit zu konstatieren, dass die Covid-Pandemie das Krisenmanagement der EU als Rahmen für die deutsche Sicherheitspolitik geschwächt hat, und zwar weniger operativ als politisch.
Trotz der Tatsache, dass die Nato bzw. die nationalen Streitkräfte eine wichtige Rolle beim Kampf gegen die Pandemie in den Mitgliedsländern gespielt haben, drohen Verschiebungen in der internen Machtstruktur der Allianz (»politischer« Rückzug der USA; Konflikt Türkei – Griechenland/Frankreich) zurzeit die Fähigkeit des Bündnisses zu lähmen, sich gemeinsam im externen Krisenmanagement zu engagieren.3 Gleichwohl laufen die bestehenden Missionen in Afghanistan, im Kosovo und im Irak, wenn auch mit geringeren operativen Beeinträchtigungen, weitgehend gleichförmig weiter. Eine unmittelbare Wirkung der Pandemie auf die Einsätze ist lediglich dadurch erkennbar, dass für die beteiligten Kontingente Covid-Schutzmaßnahmen erlassen wurden und die Aktivitäten im Bereich der humanitären Hilfe zugenommen haben.
Gleiches gilt auch für die Vereinten Nationen, wo sich die bereits zuvor bestehenden Spannungen zwischen den Großmächten durch die Pandemie weiter verstärkt haben, wodurch es nahezu unmöglich geworden ist, dass der Sicherheitsrat die ihm zugewiesene Rolle beim Konfliktmanagement engagiert spielt. Damit war auch die Wirkung der deutschen Außenpolitik in diesem Gremium zuletzt begrenzt. Dessen Aufruf an alle Parteien in bewaffneten Konflikten, unverzüglich eine humanitäre Feuerpause von mindestens neunzig Tagen einzulegen, ist weitgehend wirkungslos geblieben.4
Offen bleiben muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Wirkung der Pandemie auf die materielle Basis des Krisenmanagements. Nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen Hauptstädten ist derzeit die Rede von bevorstehenden Haushaltskürzungen. Diese würden auch die Ressourcen des Krisenmanagements betreffen, vor allem dessen militärische Dimension in Form von Minderungen nationaler Verteidigungshaushalte.5 Ob sich diese Befürchtungen bewahrheiten, kann an dieser Stelle nicht sicher prognostiziert werden, insbesondere weil es mit der anhaltenden transatlantischen Debatte über eine faire Lastenteilung auch Faktoren gibt, die in die entgegengesetzte Richtung wirken.
Krisenmanagement – von außen nach innen
Es ist nachvollziehbar, dass die Bundesregierung ihr internationales Krisenmanagement angesichts der skizzierten Rahmenbedingungen erst einmal in den etablierten Bahnen fortgeführt hat und neue Initiativen scheut. Sie tut dies nicht zuletzt auch deshalb, weil die dafür notwendigen Partner zum Teil noch viel schwerer von der Covid-Pandemie betroffen sind und außerhalb ihrer Grenzen nur geringes Gestaltungsinteresse erkennen lassen. Eine Ausnahme bildet hier Frankreich, wo es der Regierung Macron trotz hoher Infektionszahlen nicht am Willen zu einem außenpolitisch machtbewussten Auftreten mangelt, zuletzt vor allem im östlichen Mittelmeerraum.
Wenn also auf den ersten Blick Kontinuität im Krisenmanagement zu dominieren scheint, so droht doch ohne ein aktiveres Engagement mittelfristig eine Schwächung dieses Politikfelds. Denn zum einen hat die Covid-Pandemie dessen Zielrichtung verändert: von der Eindämmung oder Regelung eines Konflikts im internationalen System hin zu einer Priorisierung der eigenen Krisenresilienz. Das heißt, Deutschland und Europa sind zuallererst darauf fokussiert, ihre Fähigkeiten zu stärken, mit der Pandemie umzugehen und deren Folgen abzufedern. Damit einher geht eine Ausdifferenzierung des Instrumentariums: von den politischen und militärischen Krisenmanagementfähigkeiten hin zu finanziellen, gesundheitspolitischen und anderen Instrumenten. Schließlich hat sich der Adressat und damit auch der innenpolitische Legitimationsbedarf verändert: Geht es beim internationalen Krisenmanagement um die Bewältigung von Konflikten anderer Akteure und um die Bereitstellung der dafür notwendigen Ressourcen, so hat die Covid-Pandemie die Blickachse zu Herausforderungen und Defiziten der eigenen Politik verschoben.
Dieser mit der Pandemie verbundene »Ausnahmezustand« sollte jedoch nicht zum Normalzustand werden. Angesichts diverser Krisen und Konflikte in der europäischen Nachbarschaft – zuletzt in Belarus, in Bergkarabach und dem östlichen Mittelmeerraum –, der geopolitischen Fliehkräfte, die auf die EU aus verschiedenen Richtungen wirken, und der Leerstellen, die andere Akteure im Krisenmanagement hinterlassen haben, bedarf es, sobald die unmittelbaren Folgen von Covid abgeklungen sind, wieder eines stärkeren deutschen Engagements in diesem Politikfeld. Angesichts der gewachsenen Bedeutung »neuer« Regionalmächte für zahlreiche Konflikte in der direkten Nachbarschaft der EU (»Krisenlandschaft Mittelmeer«, Syrien, Libyen), wird es dabei nicht mehr ausreichen, sich ausschließlich den unmittelbaren Konfliktbeteiligten zuzuwenden. In einem derart geopolitisierten Umfeld wird es dann stärker als bisher erforderlich sein, die bilateralen Beziehungen zu Staaten wie zum Beispiel Russland, der Türkei, Ägypten, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten für das Krisenmanagement nutzbar zu machen bzw. das Politikfeld in diese Beziehungen zu integrieren. Dies hätte aber auch zur Folge, dass die EU ihre bevorzugte Mediatorenrolle im Krisenmanagement aufgeben und ihre diesbezüglichen Interessen häufiger »mit Zähnen und Klauen« verteidigen müsste.
Ausblick
Barbara Lippert / Stefan Mair
Ausblick auf 2021: Das zweite Jahr der Pandemie und Chancen, die multilaterale Zusammenarbeit wiederzubeleben
Zum Jahreswechsel 2020/21 wird die Pandemie weltweit noch nicht besiegt sein. Aber auch in den USA und Europa, wo weiterhin hohe Zahlen an Infizierten und Toten zu beklagen sind, werden 2021 stärker Post-Corona-Themen in den Vordergrund treten und politische wie wissenschaftliche Aufmerksamkeit einfordern. Vorrangig wird es um die Wiederbelebung der Wirtschaft und den Umgang mit den sozialen Folgen der Pandemie gehen. Quer durch alle Politikfelder wird sich die Frage stellen, wie in Zukunft ein höheres Maß an Resilienz erreicht werden kann. Das gilt natürlich vor allem für Gesundheitssysteme und die Bereitstellung kritischer Güter, es gilt aber auch für Bildung, Pflegeeinrichtungen, Wertschöpfungsketten und öffentliche Verwaltung. Im Lichte dieser Anforderungen ist die Kompetenzverteilung zwischen europäischer, nationaler und lokaler Ebene zu prüfen.
Besonders beachtet werden sollte die gesellschaftliche Akzeptanz der Pandemiebekämpfung bzw. von Notfallmaßnahmen generell. An den restriktiven Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben sich Proteste entzündet, die auch selbsternannte Frei- und Querdenker, Esoteriker und Rechtsextreme zusammenbrachten. Zwar gehören populistische Regierungen und Parteien, die die Gefahren der Pandemie relativiert oder gar geleugnet haben, nicht zu den Krisengewinnern. Aber selbst da, wo verfassungsgemäß und verantwortungsvoll regiert wird und die Bevölkerung die Exekutive mehrheitlich unterstützt, kann die öffentliche Meinung schnell kippen. Dies droht dann, wenn die nationalen Strategien zur Bekämpfung der Pandemie 2021 nicht die erhofften Ergebnisse zeitigen, ein Ende der Einschränkungen unabsehbar wird oder der Wechsel in den Normalbetrieb zu schnell über die Härten für bestimmte Personenkreise und Branchen hinweggeht.
Überall werden deshalb 2021 die innenpolitischen und fiskalischen Entwicklungen kritisch sein. Sie werden sehr wahrscheinlich die materiellen Spielräume in vielen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik limitieren. Dem steht entgegen, dass die EU-Partner und auch die neue US-Regierung von Deutschland erwarten werden, trotz Corona solche Handlungsspielräume zu ermöglichen und finanzielle bzw. politische Ressourcen in öffentliche Güter und internationale Kooperation zu investieren. Die Kluft zwischen Gestaltungsherausforderungen und der Bereitschaft und Fähigkeit, sie zu adressieren, erfordert eine neue Diskussion über Prioritätensetzung in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und über deren Stellenwert gegenüber anderen Politikfeldern.
Corona-Folgen und Transformationsagenda der EU
In der EU sind 2020 bereits einige Weichen für die Zeit nach Corona gestellt worden, vor allem mit dem Wiederaufbaufonds »Next Generation EU« und einem deutlich größeren EU-Haushalt. Damit soll die wirtschaftliche Ausrichtung aller Mitgliedstaaten auf ein neues Wachstumsmodell, das aus den Großprojekten Green Deal und Digitalisierung besteht, finanziell unterfüttert und inhaltlich programmiert werden. Zwar stand die wirtschaftliche Transformation hin zu klimaneutraler Kreislaufwirtschaft und durchgreifender Digitalisierung schon vor Corona auf der Tagesordnung. Ohne die Pandemie wäre es aber sehr viel schwieriger oder gar unerreichbar gewesen, dass die EU entschlossen auf diesen Kurs setzt und ihn finanziell massiv fördert. Denn beide Vorhaben sind systemischer Natur und verlangen ein gewaltiges Umsteuern und Umlernen der Politik (im Sinne von Ordnungspolitik und Rahmensetzung), der Wirtschaft und der Gesellschaften. Die EU-Kommission stellt Klima- und Digitalpolitik als untrennbare Zwillingsprojekte dar, verschleiert damit allerdings absehbare Zielkonflikte. Aus diesen Modernisierungsprozessen gehen wirtschaftlich wie gesellschaftlich Gewinner und Verlierer hervor, was sich schon während der Pandemie abzuzeichnen begann und sich ihretwegen noch verschärfen dürfte.
Im Prinzip lassen sich die Strategien, die zur Bekämpfung der Seuche und für künftige Prävention empfohlen werden, in Konzepte der Resilienzstärkung und Nachhaltigkeit einbetten. Wucht und Dauer der Pandemie haben Schwächen und Verwundbarkeiten bei kritischen Infrastrukturen, bei Vorsorge wie Krisenreaktion offenbart. Corona wird insofern als Weckruf verstanden. Symptomatisch dafür ist, dass Lieferketten überprüft werden und Diversifizierung als erstrebenswert gilt, die ebenso wie Dezentralisierung ein Baustein von Resilienzstrategien ist. Zugleich haben radikalere Überlegungen Nahrung erhalten. Sie zielen darauf, Austauschbeziehungen, insbesondere den Handel, zu entflechten oder zu entkoppeln und damit auf Regression und Autarkie umzusteuern. Deutschland muss sich – als Land mit extremer wirtschaftlicher Außenorientierung und einem notorischen Handelsbilanzüberschuss – im Kreis der EU gegen diese Interpretation von Resilienz wenden. Notwendig hierfür sind aber neben guten Argumenten auch verlässliche europäische Verbündete, damit sich die Offenheit der strategischen Autonomie wahren lässt.
Darüber hinaus ist innerhalb der EU pandemiebedingt eher mit mehr Divergenz der wirtschaftlichen Entwicklung zu rechnen als mit fortschreitender Konvergenz. Ökonomisch relativ gesunde Länder, deren Verschuldungslage umfangreiche Staatshilfen zulässt – Deutschland, die skandinavischen Länder, Österreich, die Niederlande, Irland und die Staaten Ostmitteleuropas –, haben bei weitem bessere Chancen als andere, sich schnell wieder zu erholen. Das dürfte die politischen Spannungen in der EU verschärfen. Zudem wird im Bemühen, die Krise zu überwinden, wohl auch das Gleichgewicht zwischen Staat und Wirtschaft neu kalibriert werden. Absehbar ist, dass in vielen Marktwirtschaften der Staat über die Krisenbekämpfung hinaus eine stärkere Rolle für sich reklamieren wird, durch eine aktivere Industriepolitik, aber auch durch regulatorische Eingriffe in kritischen Sektoren.
Corona hat vorerst die Aufmerksamkeit von der Klimapolitik abgelenkt. Die Klimakonferenz COP26 in Glasgow wurde um ein Jahr verschoben, die Umsetzung der klimapolitischen Agenda entsprechend abgebremst. Dagegen hat die Digitalisierung in Unternehmen und vielen Bereichen der Arbeits- und Lebenswelt durch die Pandemie einen echten Schub erfahren. Dass die Natur sich im Frühjahr und Sommer 2020 wegen geringerer Wirtschaftsaktivitäten erholen konnte, hat wiederum nur ein kurzes Atemholen ermöglicht und im schlimmsten Fall für falsche Entwarnung gesorgt. Damit sich die Klimadiplomatie wiederaufnehmen und die Digitalisierung beschleunigen und regulieren lässt, bedarf es auf europäischer wie internationaler Ebene umfangreicher Abstimmungen zu Normsetzung, Monitoring und Normenkontrolle. Private und nichtstaatliche Akteure müssen konsequent in die Prozesse einbezogen werden, mit denen Politik formuliert und durchgesetzt wird. Die Erfahrungen mit der Pandemie können das Risikobewusstsein der Bevölkerung schärfen, was nicht unmittelbar greifbare, in ihrer Wirkung aber massive Bedrohungen – wie auch den Klimawandel – angeht. Stärker sensibilisiert werden die Menschen möglicherweise ebenso für Nutzen und Notwendigkeit technologischer Umwälzungen, wie sie die Digitalisierung oder neue Formen der Gesundheitsforschung darstellen.
Neustart mit den USA und transatlantische Agenda 2021
Mit dem Wechsel im Weißen Haus von Trump zu Biden verbessern sich für Deutschland und Europa die Rahmenbedingungen, um vielen dieser Herausforderungen zu begegnen. 2021 könnte das Jahr werden, in dem die transatlantische Agenda wieder ein bestimmender Faktor internationaler Politik wird. Dafür müssen die EU und ihre Mitgliedstaaten in größtmöglicher Geschlossenheit auftreten und Vereinbarungen mit Washington auf den Feldern gemeinsamen Interesses treffen. Einen ersten Schritt hierzu haben die Kommission und der Hohe Vertreter der EU mit ihrer gemeinsamen Mitteilung »A new EU‑US agenda for global change« gemacht. Die vier Kapitel des Dokuments – (1) eine gesündere Welt, (2) Umweltschutz und Wohlstand, (3) Technologie, Handel und Standards, (4) eine sicherere, wohlhabendere und demokratischere Welt – enthalten viele Vorschläge, die auch in der vorliegenden Studie ihren Niederschlag finden. Doch so attraktiv diese Agenda ist, fragt sich doch, ob die geballte Kraft der transatlantischen Partner ausreichen wird, sie umzusetzen.
Denn wie zu erwarten ist, wird die wirtschaftliche Bedeutung Chinas und damit auch sein politischer Einfluss infolge der Pandemie noch einmal spürbar zunehmen. Das heißt, dass sich die sino-amerikanische Rivalität weiter zuspitzen dürfte und die systemische Konkurrenz zwischen autoritärem Staatskapitalismus und marktwirtschaftlicher Demokratie eine zusätzliche Qualität bekommen könnte. Peking wird nicht darauf verzichten, seine Erfolge bei der Corona-Eindämmung als neuerlichen Beleg für die Überlegenheit des eigenen Systems herauszustellen. Wie sehr sich Chinas schnelle wirtschaftliche Erholung von der Pandemie wiederum auf die internationale Machtkonfiguration auswirken wird, hängt letztlich von zwei weiteren Faktoren ab: der Fähigkeit von USA und Europa, die eigenen Wirtschaftskrisen zu überwinden, und ihrem Willen, eine gemeinsame Haltung und Strategie gegenüber China zu entwickeln. Mit dem Amtsantritt der Biden-Regierung dürften sich die Aussichten für beides deutlich verbessern. Ein konstruktives bilaterales Verhältnis, das auf gemeinsamen Werten beruht, kann die europäische Position im Umgang mit China nur stärken.
Strategische Autonomie Europas, Konflikte und Krisenlandschaften
Gerade in den ersten Wochen der Pandemie haben die EU-Staaten erfahren, dass ein intakter Binnenmarkt lebenswichtig ist. Die Außenpolitik der EU beruht nicht zuletzt auf dieser Marktmacht in Kombination mit der Regulierungsmacht, also der Fähigkeit, Standards und Normen zu setzen. Corona lieferte zusätzliche Argumente für das Streben der EU nach digitaler und währungspolitischer Souveränität, auch bei medizinischer Forschung und Produktion. Aber wo dergleichen Machtpotentiale nicht im Vordergrund stehen, wie beim Krisenmanagement, ist kein Pandemie-Impuls zu erkennen und zu erwarten, eher wohl ein Rückgang des Engagements. 2021 wird die Bundesregierung noch härtere Kontroversen über die Erhöhung der Verteidigungsausgaben, über Einsatzfähigkeit und Ausstattung der Bundeswehr, Rüstungsexportpolitik, Migrationspolitik etc. führen müssen. Die Öffentlichkeit wird drängen, alle Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie überwunden werden – was in Konkurrenz zu anderen Zielen stehen wird. Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik wird es noch schwerer haben als bisher, die materiellen und immateriellen Kapazitäten aufzubauen, die für ihren Erfolg erforderlich sind. Dieses Anliegen muss deshalb in eine Politik der Selbstbehauptung und internationalen Gestaltungsfähigkeit Europas eingebettet werden. Wichtig ist dabei, die abstrakten Begriffe strategischer Autonomie und europäischer Souveränität auf konkrete Politikfelder herunterzubrechen und dort auf notwendige Fähigkeiten, praktische Konsequenzen und erreichbare Meilensteine. So ließe sich auch dem in manchen EU-Staaten aufkeimenden Wunsch nach einer relativ bequemen Juniorrolle im Schlepptau der USA entgegenwirken. Strategische Autonomie verlangt, dass die EU ihre außenpolitische Agenda selbst bestimmt und in die transatlantischen Beziehungen einbringt.
Zu Beginn der Pandemie keimte kurz Hoffnung auf, das alle vereinende Ziel der Virusbekämpfung könnte zumindest temporär einen internationalen Burgfrieden herbeiführen und Gesellschaften, die unter Gewaltkonflikten leiden, eine Atempause verschaffen. Diese Erwartung hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil: Das Jahr eins von Corona erlebte nicht nur die Fortdauer kriegerischer Auseinandersetzungen in Syrien, Jemen und Libyen, es endet auch mit einer ganzen Reihe an Brennpunkten neuer oder wiederaufgeflammter Gewalt, unter anderem in Äthiopien, Nagornyi-Karabach und Nigeria. Die Pandemie hat die Karte internationaler Konflikte nicht neu gezeichnet, sondern darauf die bekannten Bruchlinien struktureller Probleme – Hunger, Armut, widerstreitende ethnische und religiöse Identitäten – als Quellen neuer, auch gewaltförmiger Konflikte vertieft. In unmittelbarer Nachbarschaft der EU erfasst der Unsicherheitskomplex1 Naher/Mittlerer Osten und Nordafrika immer mehr das östliche Mittelmeer. Bisher nehmen die Europäer hier trotz ihres starken Interesses an einer stabilen (Neu-)Ordnung nur wenig Einfluss bzw. verzetteln sich in konkurrierenden oder gar konfligierenden nationalen Ansätzen. Der Türkei und Russland dagegen gelingt es trotz zum Teil widerstreitender Interessen immer wieder, bei der Neugestaltung der Region zusammenzuarbeiten und Kompromisse – meist zu Lasten Dritter – zu finden.
Nicht nur die Fortdauer von Gewaltkonflikten und Machtrivalitäten wird dazu beitragen, die strukturelle Instabilität in vielen Regionen zu verstärken. Hinzu kommt, dass die Voraussetzungen in den Ländern des globalen Südens, Corona erfolgreich zurückzudrängen, ungleich schlechter sind als in Nordamerika, Europa und Ostasien. Selbst wenn es in den nächsten Monaten gelingen sollte, Impfstoffe und Medikamente auf globaler Ebene fair zu verteilen, werden vor allem Länder in Afrika und Lateinamerika noch immer mit Lagerungsproblemen und mangelnder logistischer Infrastruktur konfrontiert sein. Dort wird sich eine ausreichende Immunisierung der Bevölkerung weit später sicherstellen lassen als in den Ländern des Nordens. Die wirtschaftlichen Einbrüche werden im Fall der Schwellenländer und der Länder mit unterem mittleren und mit niedrigem Einkommen bewirken, dass sich bestehende Ausdifferenzierungsprozesse beschleunigen. Folge dürfte sein, dass der Migrationsdruck abermals steigt. Für ein solches Szenario ist die EU nach wie vor nicht gerüstet, da sie strittige Fragen der Asyl- und Flüchtlingspolitik nicht geklärt hat – betreffend harmonisierte Schutz- und Aufnahmenormen, Verteilung von Migranten in der EU, Rückführungen und Schutz der Außengrenze. Insgesamt sind 2021 in vielen Ländern Afrikas, Lateinamerikas sowie Süd- und Zentralasiens fragile Übergangsprozesse zu erwarten. Die EU muss hier weiter zu Stabilisierungsversuchen beitragen und Partnerschaftsbeziehungen mit Ländern und Regionalorganisationen aufbauen.
Deutschland und die EU stehen 2021 also vor vielfältigen Herausforderungen. Sie müssen einen Durchbruch bei der globalen Bekämpfung der Pandemie erzielen, die Wirtschaft im EU-Raum wieder ankurbeln, den Großprojekten Green Deal und Digitalisierung Zugkraft verleihen, die multilaterale Kooperation und entsprechende Organisationen revitalisieren, den Prozess hin zur strategischen Autonomie Europas fortsetzen, diesen mit einem Neustart der transatlantischen Beziehungen verbinden und fragile Länder des Südens stabilisieren. Diese Auflistung macht deutlich, wie dringlich eine Debatte über Prioritäten in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ist. Wichtig ist dabei, Prioritätensetzungen, die immer auch Fragen der Lastenteilung mit sich bringen, nicht nur auf Regierungsebene und im Bundestag zu beraten, sondern sie auch mit den wichtigsten internationalen Partnern abzustimmen und gleichzeitig in den eigenen Gesellschaften, auf nationaler wie europäischer Ebene, zur Diskussion zu stellen. Die anstehende Konferenz zur Zukunft Europas, die Kommission und Europäisches Parlament initiiert haben, bietet hierfür eine ausgezeichnete Gelegenheit.
Anhang
Abkürzungen
|
ACLED |
Armed Conflict Location & Event Data Project |
|
ACT |
Access to COVID-19 Tools |
|
AEUV |
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
|
AfCFTA |
African Continental Free Trade Area |
|
Africa CDC |
Africa Centres for Disease Control and Prevention |
|
ASEAN |
Association of Southeast Asian Nations |
|
AU |
Afrikanische Union |
|
BARDA |
Biomedical Advanced Research and Development Authority |
|
BBK |
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe |
|
BIP |
Bruttoinlandsprodukt |
|
CEPI |
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations |
|
CNN |
Cable News Network |
|
CO2 |
Kohlendioxid |
|
COP |
Conference of the Parties (Vertragsstaatenkonferenz) |
|
COVAX |
COVID‑19 Vaccines Global Access |
|
CSIRT |
Computer Security Incident Response Team |
|
CSIS |
Center for Strategic and International Studies (Washington, D.C.) |
|
DIHK |
Deutscher Industrie- und Handelskammertag |
|
ECOWAS |
Economic Community of West African States |
|
EDF |
European Defence Fund (Europäischer Verteidigungsfonds) |
|
EFF |
Europäische Friedensfazilität |
|
EFTA |
European Free Trade Association (Europäische Freihandelszone) |
|
EG |
Europäische Gemeinschaft |
|
EGKS |
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl |
|
ENISA |
European Union Agency for Cybersecurity (Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit) |
|
EU |
Europäische Union |
|
EUV |
EU-Vertrag |
|
EZB |
Europäische Zentralbank (Frankfurt a. M.) |
|
EASO |
European Asylum Support Office (Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen) |
|
EFF |
Europäische Friedensfazilität |
|
EU |
Europäische Union |
|
EUNAVFOR MED |
European Union Naval Force – Mediterranean |
|
EUTM |
European Union Training Mission |
|
EZB |
Europäische Zentralbank |
|
Frontex |
European Border and Coast Guard Agency (Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache) |
|
G7 |
Gruppe der Sieben (die sieben führenden westlichen Industriestaaten) |
|
G20 |
Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer |
|
GAP |
Gemeinsame Agrarpolitik |
|
GASP |
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik |
|
Gavi |
The Vaccine Alliance (Impfallianz) |
|
GCM |
Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (Globaler Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration) |
|
GCR |
Global Compact on Refugees (Globaler Pakt für Flüchtlinge) |
|
GFMD |
Global Forum on Migration and Development (Globales Forum für Migration und Entwicklung) |
|
GSVP |
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik |
|
HLPF |
High-level Political Forum on Sustainable Development (Hochrangiges Politisches Forum für nachhaltige Entwicklung) |
|
HV |
Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik |
|
IHR |
International Health Regulations |
|
ILO |
International Labour Organization (Internationale Arbeitsorganisation) |
|
IMF |
International Monetary Fund (Internationaler Währungsfonds |
|
IOM |
International Organization for Migration (Internationale Organisation für Migration) |
|
IPCR |
Integrated Political Crisis Response |
|
IS |
»Islamischer Staat« |
|
IWF |
Internationaler Währungsfonds |
|
KDNP |
Kereszténydemokrata Néppárt (Christlich-Demokratische Volkspartei; Ungarn) |
|
KNOMAD |
Global Knowledge Partnership on Migration and Development |
|
MFR |
Mehrjähriger Finanzrahmen |
|
MINUSMA |
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali / UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali |
|
Nato |
North Atlantic Treaty Organization |
|
NGEU |
Next Generation EU |
|
NGO |
Non-Governmental Organization (Nichtregierungsorganisation) |
|
NIS |
Network and Information Security (Netz[werk]- und Informationssicherheit) |
|
OECD |
Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) |
|
P5 |
Permanent Five (die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats) |
|
PiS |
Prawo i Sprawiedliwość (Recht und Gerechtigkeit; Partei; Polen) |
|
SDF |
Syrian Democratic Forces (Syrische Demokratische Kräfte) |
|
SDGs |
Sustainable Development Goals (UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung) |
|
UHC |
Universal Health Coverage |
|
UN |
United Nations (Vereinte Nationen) |
|
UNCTAD |
United Nations Conference on Trade and Development (Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung) |
|
UNHCR |
United Nations High Commissioner for Refugees (Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen) |
|
VAE |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
WAHO |
West African Health Organization |
|
WHO |
World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation; Genf) |
|
WTO |
World Trade Organization (Welthandelsorganisation) |
Die Autorinnen und Autoren
Dr. Steffen Angenendt
Leiter der Forschungsgruppe Globale Fragen
Dr. Muriel Asseburg
Senior Fellow in der Forschungsgruppe Naher / Mittlerer Osten und Afrika
Dr. Peter Becker
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. Marianne Beisheim
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Globale Fragen
Dr. Annegret Bendiek
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe EU / Europa
Susan Bergner
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Globale Fragen
Nadine Biehler
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Globale Fragen
Dr. Raphael Bossong
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. Lars Brozus
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Amerika
Dr. Susanne Dröge
Senior Fellow in der Forschungsgruppe Globale Fragen
Dr. Oliver Geden
Senior Fellow in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. Hanns Günther Hilpert
Leiter der Forschungsgruppe Asien
Dr. habil. Markus Kaim
Senior Fellow in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik
Dr. Ronja Kempin
Senior Fellow in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. Janis Kluge
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien
Dr. Anne Koch
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Globale Fragen
Dr. Wolfram Lacher
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Naher / Mittlerer Osten und Afrika
Dr. Kai-Olaf Lang
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. Barbara Lippert
Forschungsdirektorin der SWP
Prof. Dr. Günther Maihold
Stellvertretender Direktor der SWP
Dr. Stefan Mair
Direktor der SWP
Dr. Claudia Major
Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik
Prof. Dr. Hanns Maull
Senior Distinguished Fellow, Gastwissenschaftler der Institutsleitung
Dr. Melanie Müller
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Naher / Mittlerer Osten und Afrika
Dr. Marco Overhaus
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Amerika
Prof. Dr. Volker Perthes
Senior Advisor der Institutsleitung der SWP, früherer Direktor der SWP
Dr. Stephan Roll
Leiter der Forschungsgruppe Naher / Mittlerer Osten und Afrika
Dr. Bettina Rudloff
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. Guido Steinberg
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Naher / Mittlerer Osten und Afrika
Dr. Johannes Thimm
Senior Fellow in der Forschungsgruppe Amerika
Dr. Pawel Tokarski
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. Judith Vorrath
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik
Maike Voss
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Globale Fragen
Dr. habil. Christian Wagner
Senior Fellow in der Forschungsgruppe Asien
Dr. Annette Weber
Senior Fellow in der Forschungsgruppe Naher / Mittlerer Osten und Afrika
Dr. Isabelle Werenfels
Senior Fellow in der Forschungsgruppe Naher / Mittlerer Osten und Afrika
Dr. Kirsten Westphal
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Globale Fragen
Dr. Claudia Zilla
Senior Fellow in der Forschungsgruppe Amerika
Endnoten
- 1
-
Darauf weist Fareed Zakaria in seinen sehr rasch gezogenen »Lehren« aus der Krise hin: ders., Ten Lessons for a Post-Pandemic World, New York 2020.
- 2
-
Dazu beispielhaft zwei der bekanntesten amerikanischen Kommentatoren internationaler Entwicklungen: Henry A. Kissinger, »The Corona Pandemic Will Forever Alter the World Order«, in: Wall Street Journal, 3.4.2020; Richard Haass, »The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It. Not Every Crisis Is a Turning Point«, in: Foreign Affairs, 7.4.2020, <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/ 2020-04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it>.
- 1
-
Siehe den Beitrag von Maike Voss, S. 40 ff.
- 2
-
Siehe den Beitrag von Marianne Beisheim und Susanne Dröge, S. 45 ff.
- 3
-
Siehe den Beitrag von Steffen Angenendt et al., S. 36 ff.
- 4
-
Siehe den Beitrag von Claudia Major et al., S. 24 ff.
- 5
-
Siehe den Beitrag von Janis Kluge et al., S. 28 ff.
- 1
-
Clemens Fuest, Wie wir unsere Wirtschaft retten. Der Weg aus der Corona-Krise, Berlin: Aufbau Verlag, 2020, S. 169; Gordana Mijuk, »Die echte Gefahr dieser Pandemie ist der soziale Kollaps« – Interview mit Branko Milanovic, in: Neue Zürcher Zeitung, 19.4.2020.
- 2
-
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, über eine Strategie für ein digitales Finanzwesen in der EU, COM(2020) 591 final, Brüssel, 24.9.2020, <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-591-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF>.
- 3
-
The World Bank, COVID 19: Debt Service Suspension Initiative, Washington, D.C., Juni 2020 (Brief), <https://www.world bank.org/en/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative>.
- 4
-
Susan Lund et al., Risk, Resilience, and Rebalancing in Global Value Chains, o.O.: McKinsey Global Institute, 6.8.2020, <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/ our-insights/risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains>.
- 5
-
Siehe zum Beispiel die Prognose des ifo-Instituts: Timo Wollmershäuser, ifo Konjunkturprognose Herbst 2020: Deutsche Wirtschaft weiter auf Erholungskurs, München: ifo-Institut, 18.9.2020, S. 2 (Welthandel: –7,9%, Welt-BIP: –4,3%), <https://www.ifo.de/DocDL/sd-2020-digital-11-wollmers haeuser-etal-ifo-konjunkturprognose-herbst-2020.pdf>.
- 6
-
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2020. International Production beyond the Pandemic, Genf 2020, <https://unctad.org/ en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2769>.
- 7
-
World Trade Organization, WTO Members’ Notifications on COVID-19, (letztes Update) 21.9.2020, <https://www.wto.org/ english/tratop_e/covid19_e/notifications_e.htm>.
- 8
-
Europäische Kommission, »Coronakrise: Kommission befreit Einfuhr von medizinischer Ausrüstung aus Nicht-EU-Ländern von Zöllen und Mehrwertsteuer«, Pressemitteilung, Brüssel, 3.4.2020, <https://ec.europa.eu/germany/news/ 20200403-einfuhr-medizinischer-ausruestung-aus-nicht-eu-laendern_de>.
- 9
-
World Trade Organization, Trade in Medical Goods in the Context of Tackling COVID-19, April 2020, <https://www. wto.org/english/news_e/news20_e/rese_03apr20_e.pdf>.
- 10
-
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Ideenpapier Ausweitung WTO Pharma-Abkommen, 24.4.2020, <https://www.dihk.de/resource/blob/23282/dc2c6261675dbf3ee3c47f61996ffaa7/dihk-ideenpapier-ausweitung-wto-pharma-abkommen-data.pdf>.
- 1
-
Claudia Zilla, »Politische Führung im Populismus (lateinamerikanischer Prägung)«, in: Martin Koschkar/Clara Ruvituso (Hg.), Politische Führung im Spiegel regionaler politischer Kultur, Wiesbaden: Springer VS, 2018, S. 135–155.
- 2
-
World Health Organization (WHO), Coronavirus Disease (COVID-19) Data as Received by WHO from National Authorities, as of 29 November 2020, 10 am CET, <https://www.who.int/ docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20201201_ weekly_epi_update_16.pdf?sfvrsn=a731dd9b_13&download=true>.
- 3
-
Claudia Zilla, Corona-Krise und politische Konfrontation in Brasilien. Der Präsident, die Bevölkerung und die Demokratie unter Druck, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Juni 2020 (SWP-Aktuell 53/2020).
- 4
-
Claudia Zilla/David Keseberg, »Venezuela: Menschenrechte im Ausnahmezustand«, in: Zeitschrift für Menschenrechte – Journal for Human Rights, 13 (2019) 2, S. 38–56.
- 1
-
Melissa Pavlik, A Great and Sudden Change: The Global Political Violence Landscape before and after the COVID‑19 Pandemic, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 2020, <https://acleddata.com/2020/08/04/a-great-and-sudden-change-the-global-political-violence-landscape-before-and-after-the-covid-19-pandemic/> (Zugriff am 18.8.2020). Zu gewaltsamen Ereignissen werden hier Kämpfe, Explosionen/ »remote violence« und Gewalt gegen Zivilisten gerechnet.
- 2
-
Siehe hierzu den Beitrag von Muriel Asseburg, Wolfram Lacher und Guido Steinberg, S. 73 ff.
- 3
-
Vgl. beispielsweise Laura He, »China Is Winning the Global Economic Recovery«, in: CNN Business (online), 11.10.2020, <https://edition.cnn.com/2020/10/10/economy/ china-global-economy-intl-hnk/index.html> (Zugriff am 3.11.2020).
- 4
-
So die Äußerung von US-Außenminister Mike Pompeo, zitiert nach: Christoph Hein, »Allianz gegen China. Amerika und Indien verbünden sich gegen einen gemeinsamen Konkurrenten. Beide wollen profitieren«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (online), 24.7.2020, <https://zeitung.faz.net/faz/ wirtschaft/2020-07-24/allianz-gegen-china/485727.html> (Zugriff am 24.7.2020).
- 5
-
United Nations General Assembly, Financial Situation of the United Nations. Report of the Secretary-General, A/75/387, New York, 13. Oktober 2020, <http://undocs.org/en/A/75/387> (Zugriff am 25.11.2020).
- 1
-
Adam Tooze, »The Coronavirus Is the Biggest Emerging Markets Crisis Ever«, in: Foreign Policy, 28.3.2020, <https:// foreignpolicy.com/2020/03/28/coronavirus-biggest-emerging-markets-crisis-ever/>; »Coronavirus Risks Calamity for the Emerging World«, in: Financial Times, 22.3.2020, <https:// www.ft.com/content/1056a4da-6acd-11ea-800d-da70cff6e4d3>; Constantino Hevia/Pablo Andrés Neumeyer, »A Perfect Storm: COVID-19 in Emerging Economies«, VOXEU, 21.4.2020, <https://voxeu.org/article/perfect-storm-covid-19-emerging-economies> (Zugriff jeweils am 8.10.2020).
- 2
-
Till Fähnders, »Für Trauer um die Opfer bleibt wenig Zeit«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.9.2020, <https:// www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/ corona-pandemie-in-indonesien-fuer-trauer-um-die-opfer-bleibt-wenig-zeit-16971429.html>; Ernesto Londoño/Manuela Andreoni/Letícia Casado, »Bolsonaro, Isolated and Defiant, Dismisses Coronavirus Threat to Brazil«, in: New York Times, 1.4.2020, <https://www.nytimes.com/2020/04/01/world/ americas/brazil-bolsonaro-coronavirus.html> (Zugriff jeweils am 8.10.2020).
- 3
-
Kitiphong Thaichareon, »Thai Finance Ministry Slashes 2020 GDP Outlook to 8.5% Contraction«, Reuters, 30.7.2020, <https://www.reuters.com/article/us-thailand-economy-forecast-idUSKCN24V0VG> (Zugriff am 8.10.2020).
- 4
-
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), OECD Economic Outlook September 2020, <https:// www.oecd.org/economic-outlook/> (Zugriff am 8.10.2020).
- 5
-
Brad W. Setser, »The COVID-19 Crisis in Emerging Markets Demands a Once-in-a-Century Response«, in: Foreign Affairs, 27.5.2020, <https://www.foreignaffairs.com/articles/ south-america/2020-05-27/covid-19-crisis-emerging-markets-demands-once-century-response> (Zugriff am 8.10.2020).
- 6
-
International Monetary Fund, The IMF’s Response to COVID-19, 6.10.2020, <https://www.imf.org/en/About/FAQ/imf-response-to-covid-19> (Zugriff am 8.10.2020).
- 7
-
Jonathan Wheatley, »Emerging Economies Tap Debt Markets But Risks Pile up Ahead«, in: Financial Times, 28.9.2020, <https://www.ft.com/content/8ef4792c-9ef1-4b4e-a296-73895034124f> (Zugriff am 8.10.2020).
- 8
-
Trieu Pham, »EM Sovereign Debt Issuance: Encouraging Signs But Not Yet Back to Business as Usual«, ING Economic and Financial Analysis, 26.5.2020, <https://think.ing.com/ articles/em-sovereign-debt-issuance-encouraging-signs-but-not-yet-back-to-business-as-usual> (Zugriff am 8.10.2020).
- 9
-
»Global Public Debt, Fiscal Deficits to Reach All-time High, IMF Warns«, in: The Economic Times, 10.7.2020, <https:// economictimes.indiatimes.com/news/international/business/ global-public-debt-fiscal-deficits-to-reach-all-time-high-imf-warns/articleshow/76893956.cms> (Zugriff am 8.10.2020).
- 10
-
Allerdings haben die fiskalischen Maßnahmen der chinesischen Regierung die (bescheidenen) Erfolge im gesamtwirtschaftlichen Rebalancing der letzten drei Jahre zunichtegemacht. Wegen der übermäßigen Ausrichtung der chinesischen Wirtschaft auf Investitionen, Infrastrukturentwicklung und Wohnungsbauten steht auch China mittelfristig eine Anpassungskrise ins Haus.
- 11
-
Karin Strohecker/Joe Bavier, »Angola Negotiates $6.2 Billion Debt Relief from Creditors: IMF«, Reuters, 21.9.2020, <https://www.reuters.com/article/us-angola-imf/angola-negotiates-6-2-billion-debt-relief-from-creditors-imf-idUSKCN26C2CP> (Zugriff am 8.10.2020).
- 12
-
Bank of Russia, International Reserves of the Russian Federation, Oktober 2020, <https://www.cbr.ru/eng/hd_base/mrrf/ mrrf_m/> (Zugriff am 8.10.2020).
- 1
-
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Assessing the Impact of COVID-19 on Africa’s Economic Development, Genf, Juli 2020, S. 15, <https://unctad.org/en/ PublicationsLibrary/aldcmisc2020d3_en.pdf> (Zugriff am 22.9.2020).
- 2
-
Andrew Dabalen/Pierella Paci, How Severe Will the Poverty Impacts of COVID-19 Be in Africa?, World Bank Blogs, 5.8.2020, <https://blogs.worldbank.org/africacan/how-severe-will-poverty-impacts-covid-19-be-africa> (Zugriff am 22.9.2020).
- 1
-
Internationale Organisation für Migration (IOM), »Mobility Impacts COVID-19«, <https://migration.iom.int/> (Zugriff am 12.10.2020).
- 2
-
Jonathan Woetzel/Anu Madgavkar/Khaled Rifai/Frank Mattern/Jacques Bughin/James Manyika/Tarek Elmasry/ Amadeo Di Lodovico/Ashwin Hasyagar, People on the Move: Global Migration’s Impact and Opportunity, Washington, D.C.: McKinsey Global Institute, Dezember 2016, S. vii, <https:// www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/ global-migrations-impact-and-opportunity> (Zugriff am 20.10.2020).
- 3
-
Dilip Ratha/Supriyo De/Eung Ju Kim/Sonia Plaza/Ganesh Seshan/Nadege Desiree Yameogo, COVID-19 Crisis through a Migration Lens, Washington, D.C.: KNOMAD [Global Knowledge Partnership on Migration and Development]/World Bank, April 2020 (Migration and Development Brief 32), S. viii, <https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-32-covid-19-crisis-through-migration-lens> (Zugriff am 13.10.2020).
- 4
-
IOM, »Mobility Impacts COVID-19« [wie Fn. 1].
- 5
-
Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR), »26,015 UNHCR Submissions and 11,899 Departures, January–August 2020«, <https://www.unhcr.org/ resettlement-data.html> (Zugriff am 13.10.2020).
- 6
-
UNHCR, »Mediterranean Situation«, <https://data2.unhcr. org/en/situations/mediterranean> (Zugriff am 20.10.2020).
- 7
-
Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex), »Situation at EU External Borders – Arrivals down in First Half of 2020«, 13.7.2020, <https://frontex.europa.eu/ media-centre/news-release/situation-at-eu-external-borders-arrivals-down-in-first-half-of-2020-UdNxM5> (Zugriff am 12.10.2020).
- 8
-
Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO), »Latest Asylum Trends«, <https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends> (Zugriff am 12.10.2020).
- 9
-
UNHCR, »Resettlement Data Finder«, <https://rsq.unhcr. org/en/#A5gC> (Zugriff am 12.10.2020).
- 10
-
Christoph Lakner/Daniel Gerszon Mahler/Mario Negre/ Espen Beer Prydz, How Much Does Reducing Inequality Matter for Global Poverty?, Washington, D.C.: World Bank, Juni 2020 (Global Poverty Monitoring Technical Note 13), S. 1, <http:// hdl.handle.net/10986/33902> (Zugriff am 12.10.2020).
- 11
-
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), States of Fragility 2020, Paris: OECD Publishing, 2020, S. 20, <https://doi.org/10.1787/ba7c22e7-en> (Zugriff am 12.10.2020).
- 12
-
Lakner/Mahler/Negre/Prydz, How Much Does Reducing Inequality Matter for Global Poverty? [wie Fn. 10], S. 16.
- 13
-
Zur Agenda 2030 siehe den Beitrag von Marianne Beisheim und Susanne Dröge, S. 45 ff.
- 14
-
Siehe hierzu auch die Beiträge von Susan Bergner, Melanie Müller, Annette Weber und Isabelle Werenfels, S. 32 ff, und von Claudia Major, Marco Overhaus, Johannes Thimm und Judith Vorrath, S. 24 ff.
- 15
-
IOM, World Migration Report 2020, Genf 2019, <https:// publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf> (Zugriff am 13.10.2020), S. 19.
- 16
-
Steffen Angenendt/Nadine Biehler/Anne Koch/Maike Voss, Der Globale Migrationspakt und die öffentliche Gesundheit im Kontext der Covid-19-Pandemie. Ungenutzte Potentiale zur Stärkung von Gesundheitssystemen, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, September 2020 (SWP-Aktuell 75/2020), doi: 10.18449/ 2020A75.
- 17
-
Siehe hierzu auch den Beitrag von Maike Voss, S. 40 ff.
- 18
-
Steffen Angenendt/Nadine Biehler/Raphael Bossong/ David Kipp/Anne Koch, Das neue EU-Migrations- und Asylpaket: Befreiungsschlag oder Bankrotterklärung?, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, September 2020 (SWP-Aktuell 78/ 2020), doi: 10.18449/2020A78.
- 1
-
Weltgesundheitsorganisation (WHO), »Universal Health Coverage (UHC)«, Genf, 24.1.2019, <https://www.who.int/ news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)> (eingesehen am 13.11.2020).
- 2
-
WHO, »The Access to COVID‑19 Tools (ACT) Accelerator«, Genf 2020, <https://www.who.int/initiatives/act-accelerator> (eingesehen am 13.11.2020). Ziel des ACT-Accelerators, einer internationalen Multi-Akteurs-Partnerschaft, ist es, die Forschung, Entwicklung und Produktion von Covid‑19-Diagnostika, -Therapeutika und -Impfstoffen zu beschleunigen und eine weltweit gerechte Verteilung sicherzustellen. Basis hierfür ist die gleichzeitige Stärkung von Gesundheitssystemen und der Aufbau sicherer Lieferketten.
- 3
-
WHO, »COVAX: Working for Global Equitable Access to COVID‑19 Vaccines«, Genf 2020, <https://www.who.int/ initiatives/act-accelerator/covax> (eingesehen am 13.11.2020). Die COVID‑19 Vaccines Global Access (COVAX) Facility ist die Impfstoffsäule des ACT-Accelerators und wird von der WHO und der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) koordiniert. COVAX soll die Entwicklung und Verteilung eines Impfstoffs weltweit beschleunigen, sodass bis Ende 2021 etwa 2 Milliarden Impfstoffdosen gerecht verteilt werden können. Das bedeutet, Staaten mit dementsprechenden Vereinbarungen erhalten zugelassene Impfstoffe im Rahmen von COVAX im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl; im ersten Schritt für 3 Prozent, dann für 20 Prozent ihrer Bevölkerung. 5 Prozent aller Dosen werden als humanitäres Kontingent vorgehalten. 184 Länder nehmen an COVAX teil, darunter 92 Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die durch die Vorabnahmegarantien der Impfallianz Gavi Zugang zu Covid‑19-Impfstoffen bekommen sollen (Stand 23.11.2020).
- 4
-
The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, »An Evidence-Based Quest to Protect Human Health«, Genf 2020, <https://theindependentpanel.org/> (eingesehen am 13.11.2020).
- 5
-
WHO, International Health Regulations (2005). Second Edition, Genf 2008, <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/ 43883/9789241580410_eng.pdfhttps://apps.who.int/iris/ bitstream/handle/10665/43883/9789241580410_eng.pdf> (eingesehen am 13.11.2020).
- 6
-
WHO, »COVAX« [wie Fn. 3].
- 7
-
SDG 3: Das dritte der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen umfasst Gesundheit und Wohlergehen für alle Menschen an allen Orten und in jedem Alter bis zum Jahr 2030.
- 8
-
Ständige Impfkommission/Deutscher Ethikrat/Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Positionspapier der gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Ständigen Impfkommission, des Deutschen Ethikrates und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina: Wie soll der Zugang zu einem COVID‑19-Impfstoff geregelt werden?, Berlin, 9.11.2020, <https:// www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfeh lungen/deutsch/gemeinsames-positionspapier-stiko-der-leopoldina-impfstoffpriorisierung.pdf> (eingesehen am 13.11.2020).
- 1
-
Vgl. Europäische Kommission, Ein europäischer Grüner Deal. Erster klimaneutraler Kontinent werden, <https://ec.europa.eu/ info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de>; dies., Anhänge der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Arbeitsprogramm der Kommission für 2021, COM(2020) 690 final, Brüssel, 19.10.2020, <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2021_commission_ work_programme_annexes_de.pdf> (Zugriff jeweils am 17.11.2020)
- 2
-
Siehe den Beitrag von Oliver Geden und Kirsten Westphal, S. 69 ff.
- 3
-
Siehe den Beitrag von Lars Brozus und Hanns W. Maull, S. 11 ff.
- 4
-
Vgl. Kirsten Westphal/Susanne Dröge/Oliver Geden, Die internationalen Dimensionen deutscher Wasserstoffpolitik, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Mai 2020 (SWP-Aktuell 37/2020).
- 5
-
Independent Group of Scientists, Global Sustainable Development Report 2019: The Future Is Now – Science for Achieving Sustainable Development, New York: United Nations, 2019; Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030, Bitte Wenden! Wissen(schaft) für eine nachhaltige Entwicklung Deutschlands, Berlin: wpn2030, 2019.
- 6
-
Marianne Beisheim, »Vom Schönwetterbericht zum Transformations-Rapport? Die nationale Berichterstattung zur Agenda 2030«, in: WeltTrends, 165 (Juli 2020), S. 32–37.
- 1
-
Vgl. zum Stand der Debatte den dreiteiligen Blog von Christine Zhenwei Qiang/Yan Liu/Monica Paganini/Victor Steenbergen, »Foreign Direct Investment and Global Value Chains in the Wake of COVID-19«, Washington, D.C.: World Bank, 1.5.2020, <https://blogs.worldbank.org/psd/foreign-direct-investment-and-global-value-chains-wake-covid-19>.
- 2
-
European Commission, »Speech by President von der Leyen at the European Parliament Plenary on the New MFF, Own Resources and the Recovery Plan«, Brüssel, 13.5.2020, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ speech_20_877>.
- 3
-
Siehe Mathieu Duchâtel, »Resilience, not Decoupling: Critical Supply Chains in China-Japan Relations«, Blog, Paris: Institut Montaigne, 28.8.2020, <https://www.institut montaigne.org/en/blog/resilience-not-decoupling-critical-supply-chains-china-japan-relations>.
- 4
-
Siehe Moono Mupotola, »COVID-19 Presents Unique Opportunities to Speed up Africa’s Integration Agenda and Implementation of AfCFTA«, African Development Bank Group, 27.5.2020, <https://www.afdb.org/fr/news-and-events/ interviews/covid-19-presents-unique-opportunities-speed-africas-integration-agenda-and-implementation-afcfta-35820>.
- 5
-
Siehe den Beitrag von Susan Bergner et al., S. 32 ff.
- 6
-
Assessing the Economic Impact of COVID-19 and Policy Responses in Sub-Saharan Africa, Washington, D.C.: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, April 2020 (Africa’s Pulse, Nr. 21). <https://olc.worldbank.org/ content/africas-pulse-assessing-economic-impact-covid-19-and-policy-responses-sub-saharan-africa>.
- 7
-
Simon M. Jowitt, »COVID-19 and the Global Mining Industry«, in: SEG Discovery, 122 (Juli 2020), S. 33–41.
- 8
-
Umweltbundesamt (Hg.), Urban Mining. Ressourcenschonung im Anthropozän, Dessau-Roßlau, Juli 2017, <https://www.um weltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1968/publika tionen/uba_broschuere_urbanmining_rz_screen_0.pdf>.
- 9
-
Siehe den Beitrag von Oliver Geden und Kirsten Westphal, S. 69 ff.
- 10
-
Siehe Umweltbundesamt (Hg.), Weiterentwicklung von Handlungsoptionen einer ökologischen Rohstoffpolitik, Öko Ress II, Dessau-Roßlau, Juni 2020, <https://www.umweltbundesamt. de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-06-17_texte_79-2020_oekoressii_abschlussbericht.pdf>.
- 11
-
So führen etwa Gracceva und Zeniewski folgende Kriterien ein: stability, flexibility, adequacy, resilience and robustness; vgl. Francesco Gracceva/Peter Zeniewski, »A Systemic Approach to Assessing Energy Security in a Low-carbon EU Energy System«, in: Applied Energy, 123 (15.6.2014), S. 335–348, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2013.12.018>.
- 1
-
Monnet hatte ab 1955 maßgeblichen Anteil an den Ideen, die in die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS, »Montanunion«) und der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) mündeten. Er ist ein Vordenker der Errichtung einer politischen Union, des Ausbaus zu einer Währungsunion, der Bildung eines Rats der Staats- und Regierungschefs und des Beitritts des Vereinigten Königreichs zur damaligen Europäischen Gemeinschaft (EG). Fukuyama argumentiert, dass die Demokratisierung von Herrschaft maßgeblich die Steuerungsfähigkeit politischer Ordnungen bestimmen wird, so auch die der EU, siehe Francis Fukuyama, »The Pandemic and Political Order. It Takes a State«, in: Foreign Affairs, 99 (2020) 4, S. 26–32.
- 2
-
Peter Becker, Nach dem EU-Gipfel: Historische Integrationsschritte unter Zeitdruck, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 23.7.2020 (Kurz gesagt), <https://www.swp-berlin.org/ publikation/nach-dem-eu-gipfel-historische-integrations schritte-unter-zeitdruck/> (Zugriff am 26.10.2020).
- 3
-
Europäische Kommission, »Rede der gewählten Kommissionspräsidentin von der Leyen im Europäischen Parlament anlässlich der Debatte zur Vorstellung des Kollegiums der Kommissionsmitglieder und seines Programms«, Straßburg, 27.11.2019, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ detail/de/speech_19_6408> (Zugriff am 26.10.2020).
- 4
-
Siehe Annegret Bendiek/Minna Ålander/Paul Bochtler, GASP: Von der Ergebnis- zur Symbolpolitik. Eine datengestützte Analyse, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2020 (SWP-Aktuell 86/2020), und das diese Veröffentlichung begleitende Arbeitspapier von dens., Datenerhebung zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2020 (Arbeitspapier FG EU/Europa 2/2020).
- 5
-
Europäische Kommission, »Weltweite Corona-Krisenreaktion: Aufschlüsselung der heute auf dem ›Global Goal‹-Gipfel gegebenen Zusagen«, Pressemitteilung, Brüssel, 27.6.2020, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ detail/de/qanda_20_1216> (Zugriff am 26.10.2020).
- 6
-
Europäischer Rat/Rat der Europäischen Union, »Syrien: Sanktionen gegen das Regime um ein Jahr verlängert«, Pressemitteilung, Brüssel, 28.5.2020, <https://www.consilium. europa.eu/de/press/press-releases/2020/05/28/syria-sanctions-against-the-regime-extended-by-one-year/> (Zugriff am 26.10.2020).
- 7
-
Europäisches Parlament, »Hearing with High Representative/Vice President-designate Josep Borrell«, Press Release, Brüssel, 7.10.2019, <https://www.europarl.europa.eu/news/ en/press-room/20190926IPR62260/hearing-with-high-representative-vice-president-designate-josep-borrell> (Zugriff am 26.10.2020).
- 8
-
Europäischer Rat/Rat der Europäischen Union, Bekämpfung von Desinformation. EU-Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19-Desinformation, <https://www.consilium.europa.eu/ de/policies/coronavirus/fighting-disinformation/> (Zugriff am 26.10.2020).
- 9
-
Beispielhaft hierfür: Muriel Asseburg, »Von Ideal und Wirklichkeit«, in: Internationale Politik und Gesellschaft (online), 20.4.2020, <https://www.ipg-journal.de/rubriken/aussen-und-sicherheitspolitik/artikel/von-ideal-und-wirklichkeit-4268/> (Zugriff am 26.10.2020).
- 10
-
Europäischer Rat/Rat der Europäischen Union, »Belarus: EU Imposes Sanctions for Repression and Election Falsification«, Pressemitteilung, Brüssel, 2.10.2020, <https://www. consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/10/02/ belarus-eu-imposes-sanctions-for-repression-and-election-falsification/> (Zugriff am 26.10.2020).
- 11
-
Die EU erwog bereits im Vorfeld der Konferenz in Berlin einen Militäreinsatz. Außerdem müssten die Mitgliedstaaten die Einhaltung des Waffenembargos überprüfen: »Vor Konferenz in Berlin. EU erwägt Militäreinsatz in Libyen«, Tagesschau (online), 17.1.2020, <https://www.tagesschau.de/ausland/ libyen-militaereinsatz-101.html>; »Josep Borrell beim Libyen-Gipfel. Europäer sollen Waffenstopp prüfen«, ZDF heute (online), 19.1.2020, <https://www.zdf.de/nachrichten/heute/ josep-borrell-beim-libyen-gipfel-europaeer-sollen-waffen stopp-pruefen-100.html>; Steven Erlanger, »With Libya Still at War, E.U. Agrees to Try Blocking Weapons Flow«, New York Times (online), 17.2.2020, <https://www.nytimes.com/2020/02/ 17/world/europe/libya-eu-arms-blockade.html> (Zugriff jeweils am 26.10.2020).
- 12
-
Magdalena Sapala/Nadejda Kresnichka-Nikolchova, Amended Proposal for the 2021–2027 MFF and 2021–2024 Recovery Instrument »Next Generation EU« in Figures, Brüssel: European Parliamentary Research Service, Juli 2020, <https:// www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651993> (Zugriff am 26.10.2020).
- 13
-
Europäischer Rat, Außerordentliche Tagung des Europäischen Rates (17., 18., 19., 20. und 21. Juli 2020) – Schlussfolgerungen, Brüssel, 21.7.2020, Rubrik 5 »Sicherheit und Verteidigung«, S. 51, <https://www.consilium.europa.eu/media/45136/ 210720-euco-final-conclusions-de.pdf> (Zugriff am 29.10.2020).
- 14
-
Felix Arteaga et al., »Europas Verteidigung sollte nicht Opfer des Lockdowns sein«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (online), 26.4.2020, <https://www.faz.net/aktuell/politik/ ausland/europas-verteidigung-sollte-nicht-opfer-des-lockdowns-sein-16741130.html> (Zugriff am 26.10.2020).
- 15
-
Peter Becker/Ronja Kempin, Die EU-Kommission als sicherheits- und verteidigungspolitische Akteurin. Möglichkeiten, Grenzen und Folgen der Europäisierung des Politikfelds, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Juni 2019 (SWP-Aktuell 34/2019), <https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/ aktuell/2019A34_bkr_kmp.pdf> (Zugriff am 26.10.2020).
- 16
-
Siehe dazu auch Herman-J. Blanke/Stefan Pilz: »Europa 2019 bis 2024 – Wohin trägt uns der Stier? – Sieben Thesen zu den Herausforderungen der Europäischen Union«, in: Europarecht – EuR, 55 (2020) 3, S. 270–300.
- 17
-
Annegret Bendiek/Jürgen Neyer, Smarte Resilienz. Wie Europas Werte in der Digitalisierung gestärkt werden können, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, Juli 2020, <https://www. bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/ did/smarte-resilienz> (Zugriff am 26.10.2020).
- 18
-
Auswärtiges Amt, »Strategic Compass: Developing Strategic Principles«, eu2020.de, 25.8.2020, <https:// www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/eu-defense-strategic-compass-foreign-policy/2377030#> (Zugriff am 26.10.2020).
- 19
-
In diese Richtung argumentieren ebenfalls der Hohe Vertreter Josep Borrell und Thierry Breton in ihrem gemeinsam verfassten Beitrag: Josep Borrell/Thierry Breton, »Die Ära des naiven Europas ist vorbei«, in: Welt (online), 10.6.2020, <https://www.welt.de/debatte/kommentare/ article209265051/Josep-Borell-Thierry-Breton-Die-Zeit-des-naiven-Europa-ist-vorbei.html> (Zugriff am 26.10.2020).
- 20
-
Vgl. Gabriel Felbermayr, »Was die EU für die Bürger leisten sollte«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (online), 7.8.2020, <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-die-eu-ein-groesseres-budget-braucht-16893234.html> (Zugriff am 26.10.2020).
- 1
-
European Parliamentary Research Service, Towards a More Resilient Europe Post-Coronavirus. An Initial Mapping of Structural Risks Facing the EU, Brüssel, Juli 2020, <https://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/653208/EPRS_STU(2020) 653208_EN.pdf> (Zugriff am 12.11.2020).
- 2
-
Sarah Backman/Mark Rhinard, »The European Union’s Capacities for Managing Crises«, in: Journal of Contingencies and Crisis Management, 26 (2018) 2, S. 261–271, doi: 10.1111/ 1468-5973.12190.
- 3
-
Richard E. Baldwin/Simon J. Evenett (Hg.), COVID‑19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won’t Work, London: Centre for Economic Policy Research, 2020.
- 4
-
Europäische Kommission, »Schaffung einer europäischen Gesundheitsunion: Stärkung der Krisenvorsorge und ‑reaktion für Europa«, IP/20/2041, Pressemitteilung, Brüssel, 11.11.2020.
- 5
-
Europäische Kommission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Serious Cross-Border Threats to Health and Repealing Decision No 1082/2013/EU, COM(2020) 727 final, Brüssel, 11.11.2020.
- 6
-
Vgl. Europäische Kommission, »rescEU«, <https://ec. europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en> (Zugriff am 12.11.2020).
- 7
-
Europäische Kommission, »Coronavirus: Lieferung von Masken aus der rescEU-Reserve nach Spanien, Italien und Kroatien«, IP/20/785, Pressemitteilung, Brüssel, 2.5.2020.
- 8
-
Inklusive dieser Aufstockung würden damit circa 3,4 Milliarden Euro für den Unionsmechanismus für das Krisenmanagement veranschlagt, vgl. Europäische Kommission, Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU über ein Katastrophenschutzverfahren der Union, COM(2020) 220 final, Brüssel, 2.6.2020, S. 6.
- 9
-
Vgl. Europäische Kommission, »Fragen und Antworten: Kommission stellt im Rahmen der jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum nächste Schritte für die Aufbau- und Resilienzfazilität 2021 mit einem Volumen von 672,5 Mrd. EUR vor«, QANDA/20/1659, Brüssel, 17.9.2020.
- 10
-
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), »Kritische Infrastrukturen«, <https://www.bbk. bund.de/DE/AufgabenundAusstattung/KritischeInfrastrukturen/kritischeinfrastrukturen_node.html> (Zugriff am 12.11.2020).
- 11
-
Europäische Kommission, »European Critical Infrastructure«, <https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/work-in-progress/initiatives/european-critical-infrastructure-eci_ en> (Zugriff am 13.11.2020).
- 12
-
Europäische Kommission, »The Directive on Security of Network and Information Systems (NIS Directive)«, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive> (Zugriff am 13.11.2020).
- 13
-
Dimitra Markopoulou/Vagelis Papakonstantinou/Paul de Hert, »The New EU Cybersecurity Framework: The NIS Directive, ENISA’s Role and the General Data Protection Regulation«, in: Computer Law & Security Review, 35 (2019) 6, doi: 10.1016/j.clsr.2019.06.007.
- 14
-
Europäische Union, Verordnung (EU) 2019/452 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Union, OJ L 79I, Brüssel, 21.3.2019, S. 1–14.
- 15
-
Europäische Kommission, »Präsidentin von der Leyens Rede zur Lage der Union bei der Plenartagung des Europäischen Parlaments«, SPEECH/20/1655, Brüssel, 16.9.2020, S. 3.
- 16
-
Peter Weingarten/Bettina Rudloff, »Die Gemeinsame Agrarpolitik: Entwicklungsstand und Reformbedarf«, in: Peter Becker/Barbara Lippert (Hg.), Handbuch Europäische Union, 1. Aufl., Bd. 2, Wiesbaden: Springer VS, 2020, S. 843–868.
- 17
-
Vgl. hierzu den Beitrag von Hanns Günther Hilpert, Bettina Rudloff und Paweł Tokarski, S. 15 ff.
- 18
-
Europäische Kommission, A Renewed Trade Policy for a Stronger Europe. Consultation Note, Brüssel, 16.6.2020, <https:// trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/june/tradoc_158779.pdf> (Zugriff am 11.11.2020).
- 19
-
Welthandelsorganisation (WTO), »WTO Members’ Notifications on COVID‑19«, <https://www.wto.org/english/tratop_ e/covid19_e/notifications_e.htm> (Zugriff am 11.11.2020).
- 20
-
Vgl. Europäische Kommission, »Strategische Vorausschau 2020«, <https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_de> (Zugriff am 13.11.2020).
- 21
-
Vgl. Europäischer Rat/Rat der Europäischen Union, »Die Krisenreaktion des Rates (IPCR)«, <https://www. consilium.europa.eu/de/policies/ipcr-response-to-crises/> (Zugriff am 13.11.2020).
- 1
-
Vgl. dazu die ausführliche Definition bei Sandra Destradi/ Christian von Soest, »Internationales Krisenmanagement«, in: Frank Bösch/Nicole Deitelhoff/Stefan Kroll (Hg.), Handbuch Krisenforschung, Wiesbaden 2020, S. 233–248 (234).
- 2
-
Der entsprechende Antrag der Bundesregierung wurde während der »ersten Welle« der Covid-Pandemie am 22.4.2020 gestellt (Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode, Antrag der Bundesregierung: Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführten militärischen Krisenbewältigungsoperation im Mittelmeer EUNAVFOR MED IRINI [Drucksache 19/18734], 22.4.2020, <https://dip21. bundestag.de/dip21/btd/19/187/1918734.pdf>), hat aber ursächlich nichts mit dieser zu tun, da die Beratungen in der EU bereits seit Februar liefen; vgl. dazu Markus Kaim/René Schulz, Die EU wird das VN-Waffenembargo in Libyen nicht durchsetzen können, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Februar 2020 (SWP-Aktuell 10/2020), <https://www.swp-berlin. org/publikation/die-eu-wird-das-vn-waffenembargo-in-libyen-nicht-durchsetzen-koennen/> (Zugriff, wie auch bei allen andere Internetquellen in diesem Beitrag, am 10.11.2020).
- 3
-
Vgl. zur Wirkung der Pandemie auf die Allianz die Beiträge in Thierry Tardy (Hg.), COVID-19: NATO in the Age of Pandemics, Rom: NATO Defence College, Mai 2020 (NATO Defence College Research Paper 9), <https://www.ndc.nato. int/news/news.php?icode=1440>.
- 4
-
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, Resolution 2532 (2020), 1.7.2020, <https://www.un.org/Depts/german/sr/ sr_20/sr2532.pdf>.
- 5
-
Vgl. Pierre Morcos, Toward a New »Lost Decade«? Covid-19 and Defense Spending in Europe, Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 15.10.2020 (CSIS Briefs), <https://www.csis.org/analysis/toward-new-lost-decade-covid-19-and-defense-spending-europe>.
- 1
-
Siehe hierzu im Beitrag von Muriel Asseburg, Wolfram Lacher und Guido Steinberg, S. 75 f.
Alle Rechte vorbehalten.
Abdruck oder vergleichbare Verwendung von Arbeiten der Stiftung Wissenschaft und Politik ist auch in Auszügen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung gestattet.
SWP-Studien unterliegen einem Verfahren der Begutachtung durch Fachkolleginnen und -kollegen und durch die Institutsleitung (peer review), sie werden zudem einem Lektorat unterzogen. Weitere Informationen zur Qualitätssicherung der SWP finden Sie auf der SWP-Website unter https:// www.swp-berlin.org/ueber-uns/qualitaetssicherung/.
SWP‑Studien geben die Auffassung der Autoren und Autorinnen wieder.
© Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, 2020
SWP
Stiftung Wissenschaft und Politik
Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit
Ludwigkirchplatz 3–4
10719 Berlin
Telefon +49 30 880 07-0
Fax +49 30 880 07-200
www.swp-berlin.org
swp@swp-berlin.org
ISSN 1611-6372
doi: 10.18449/2020S26