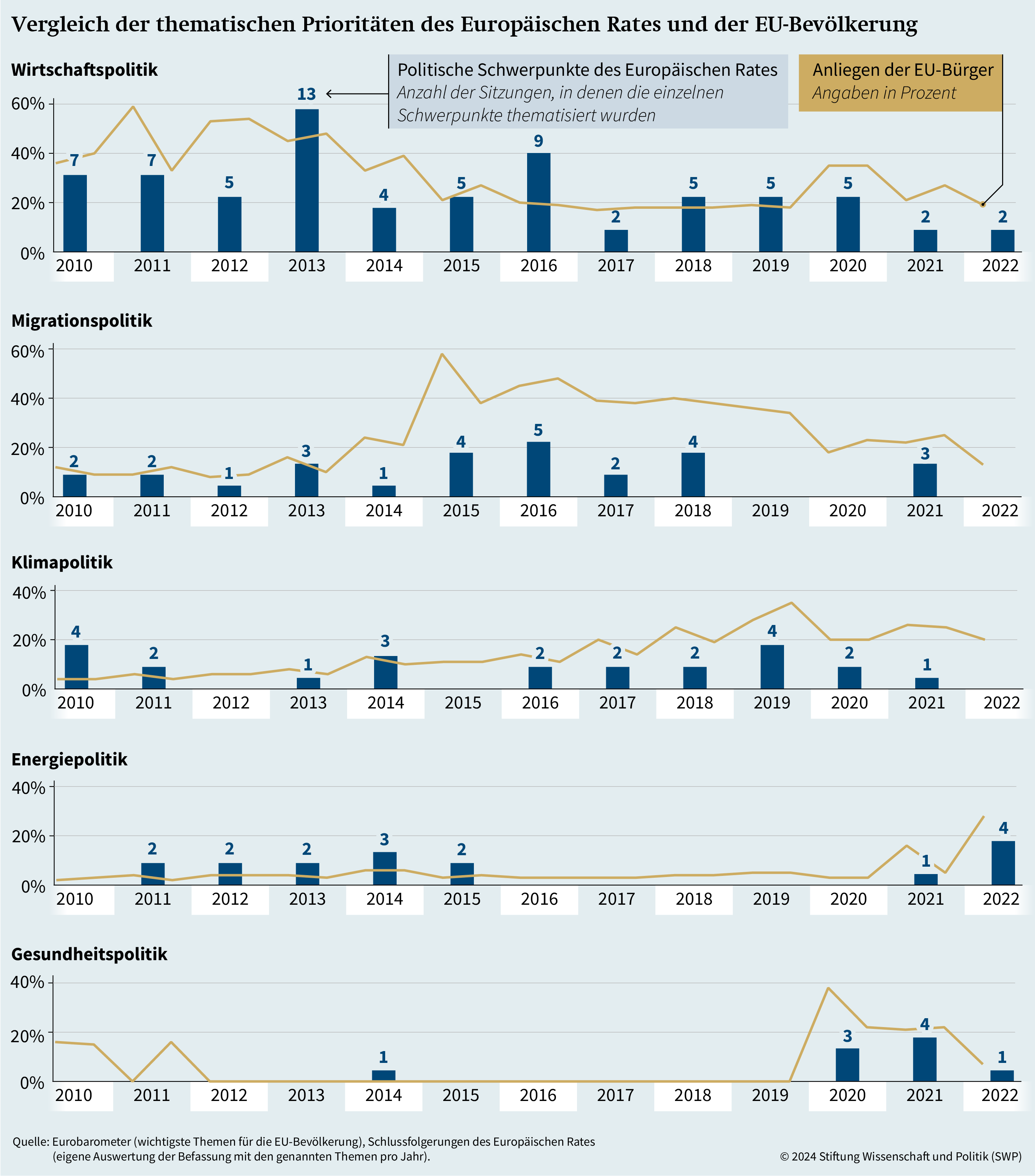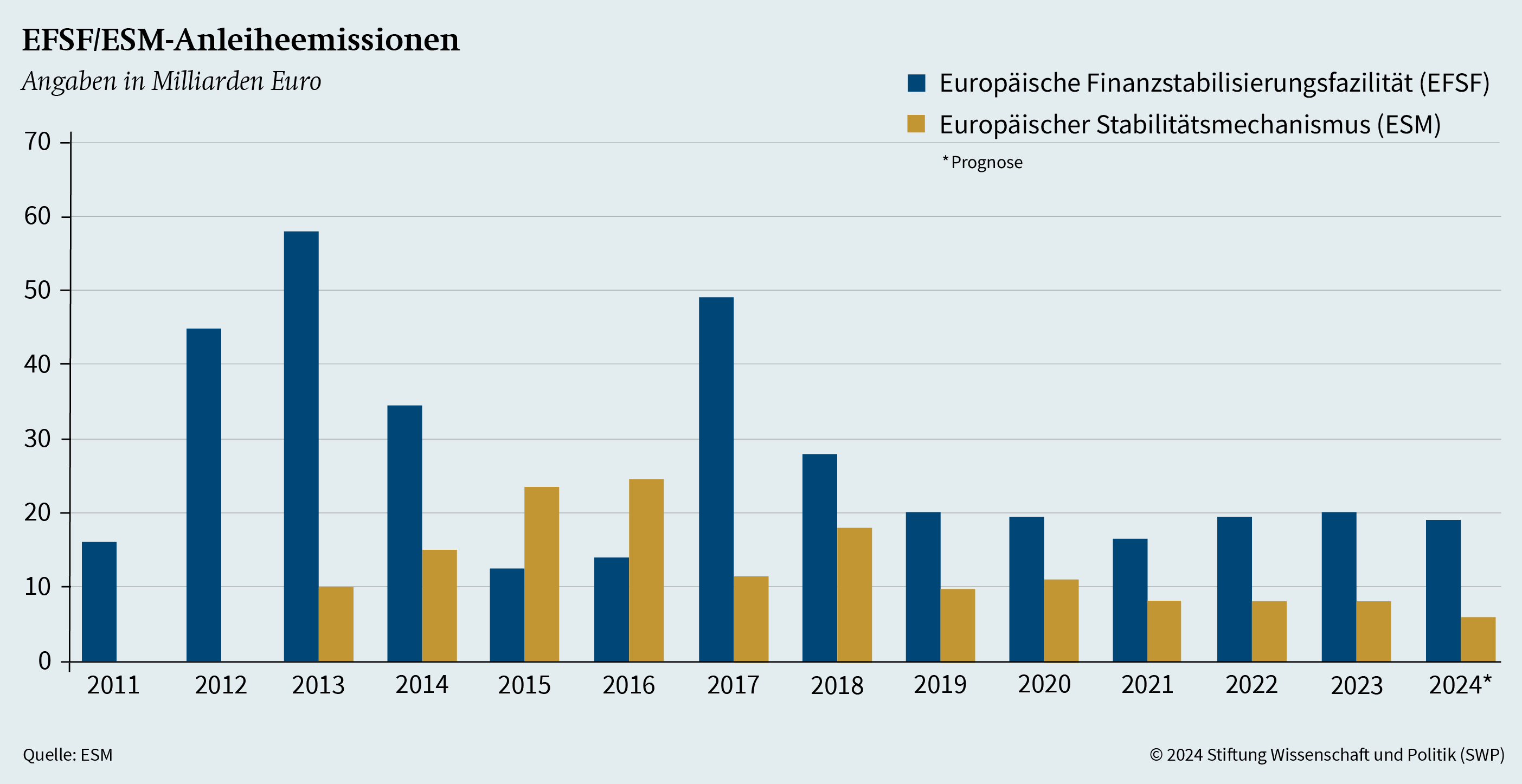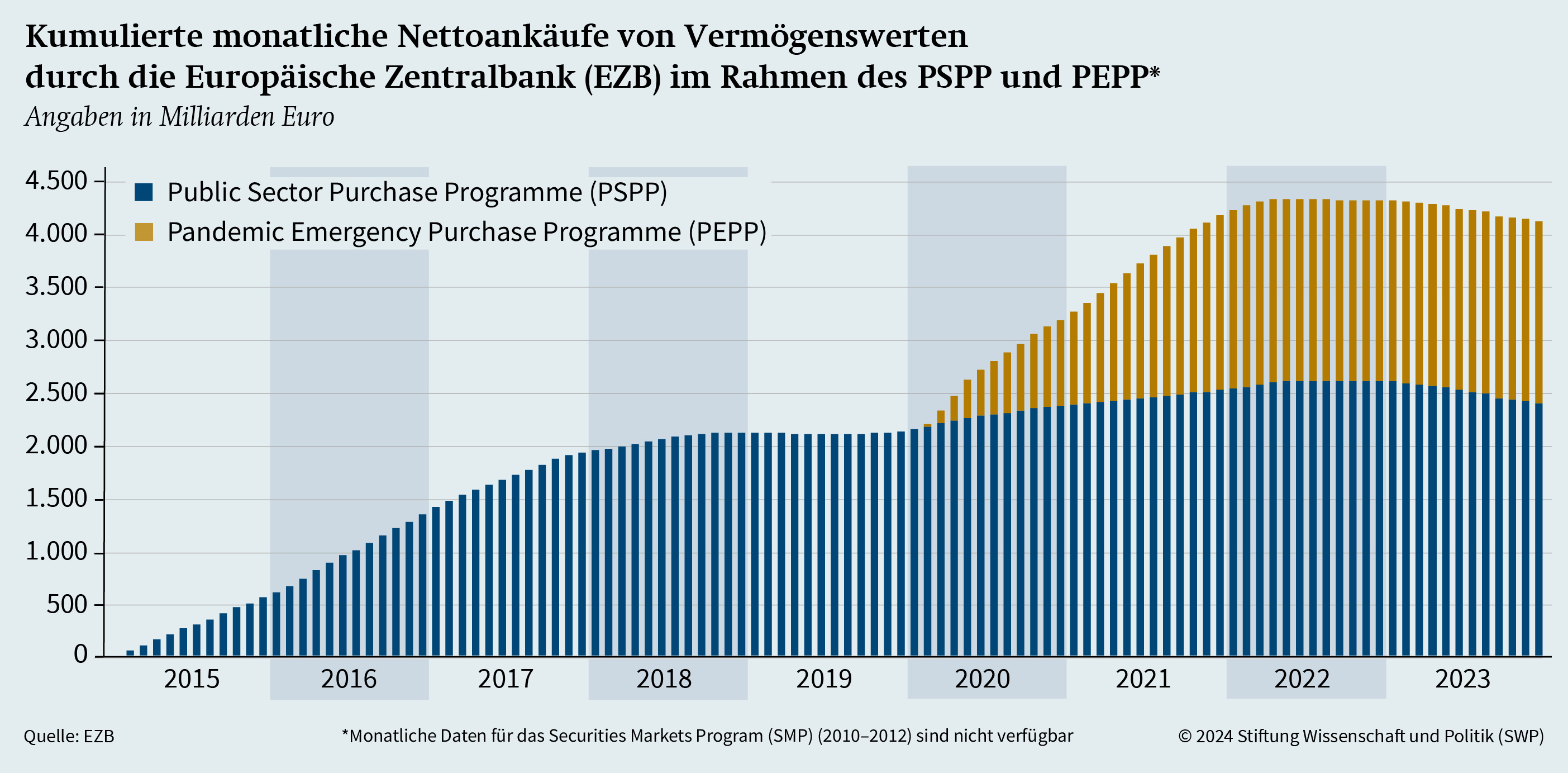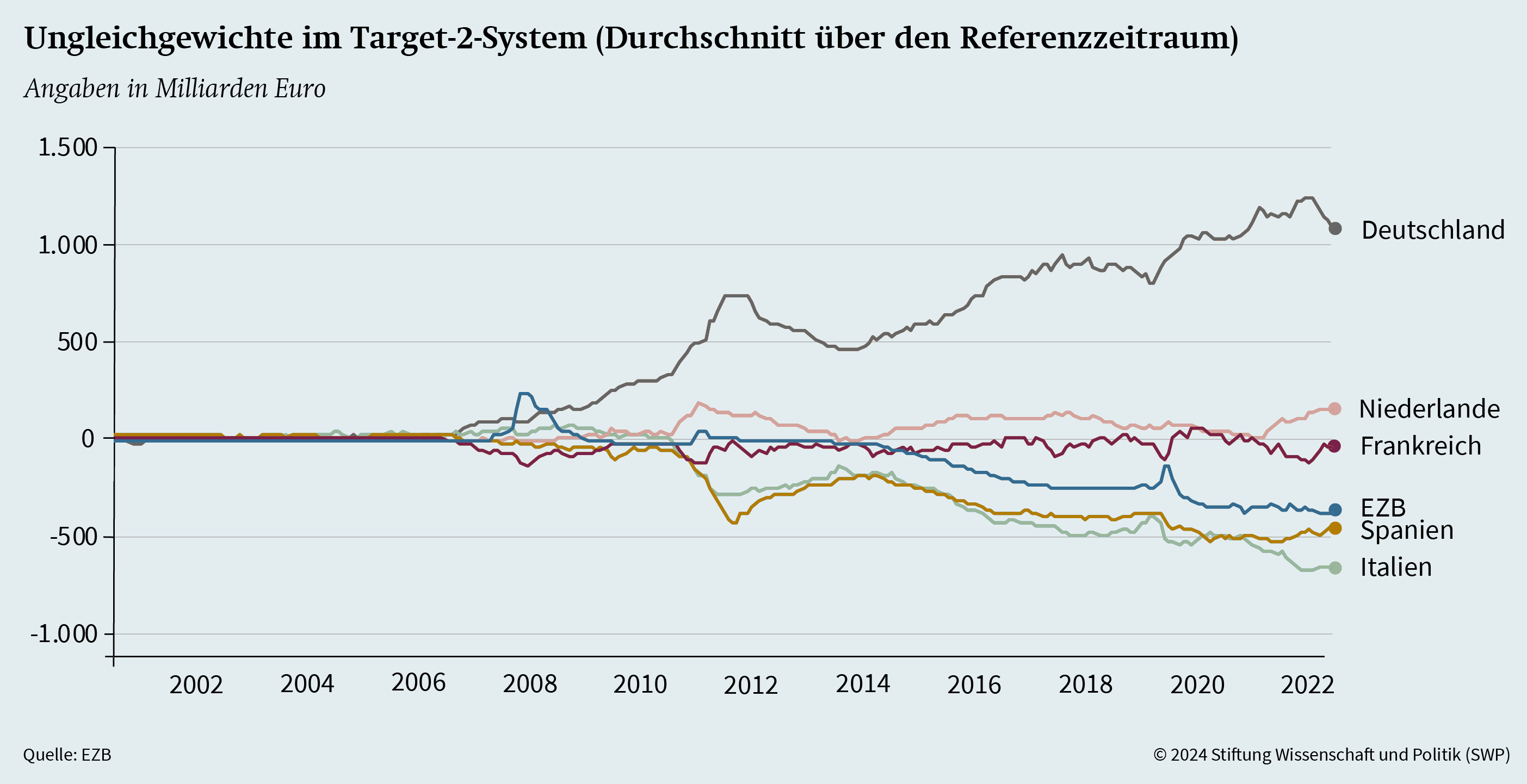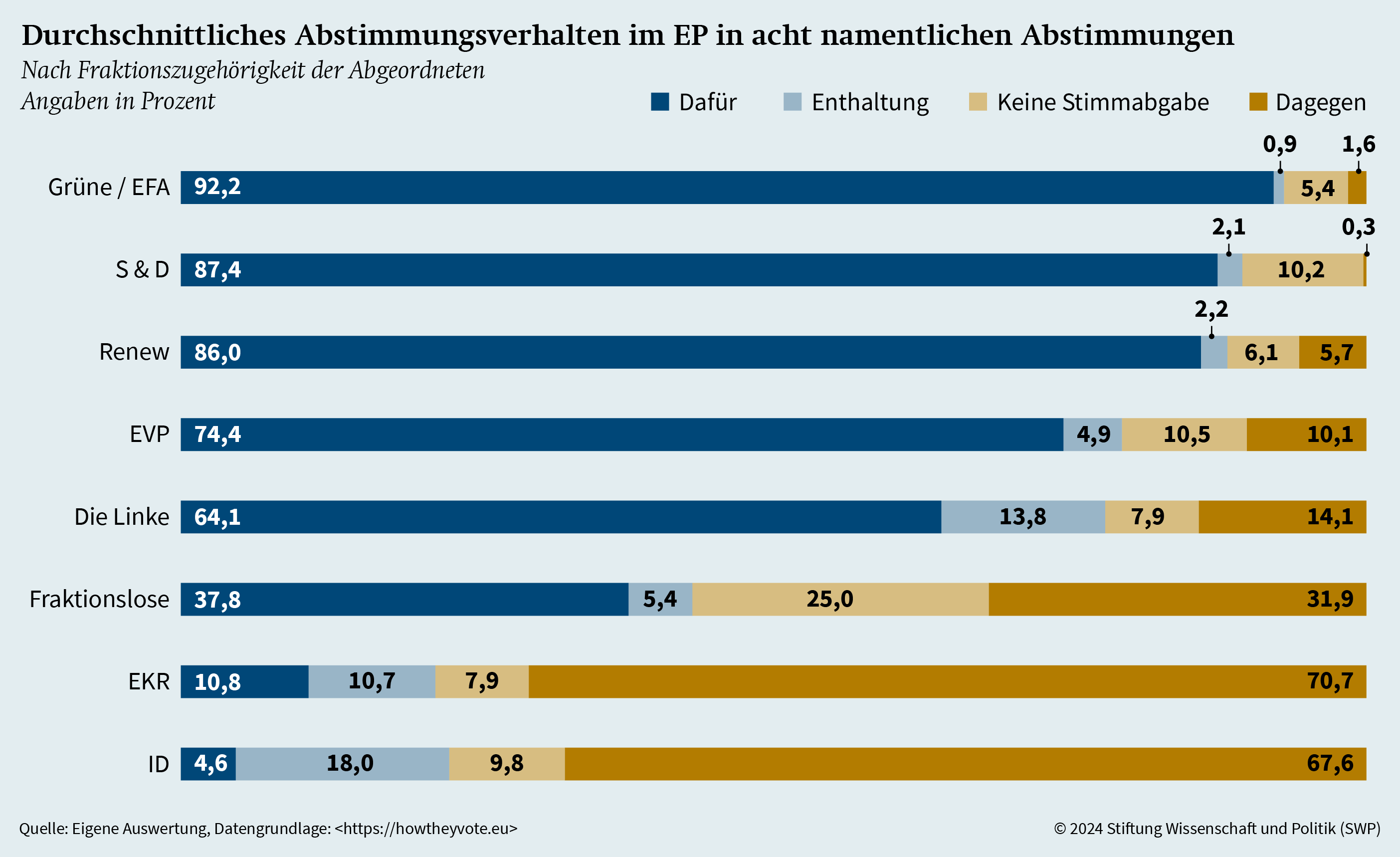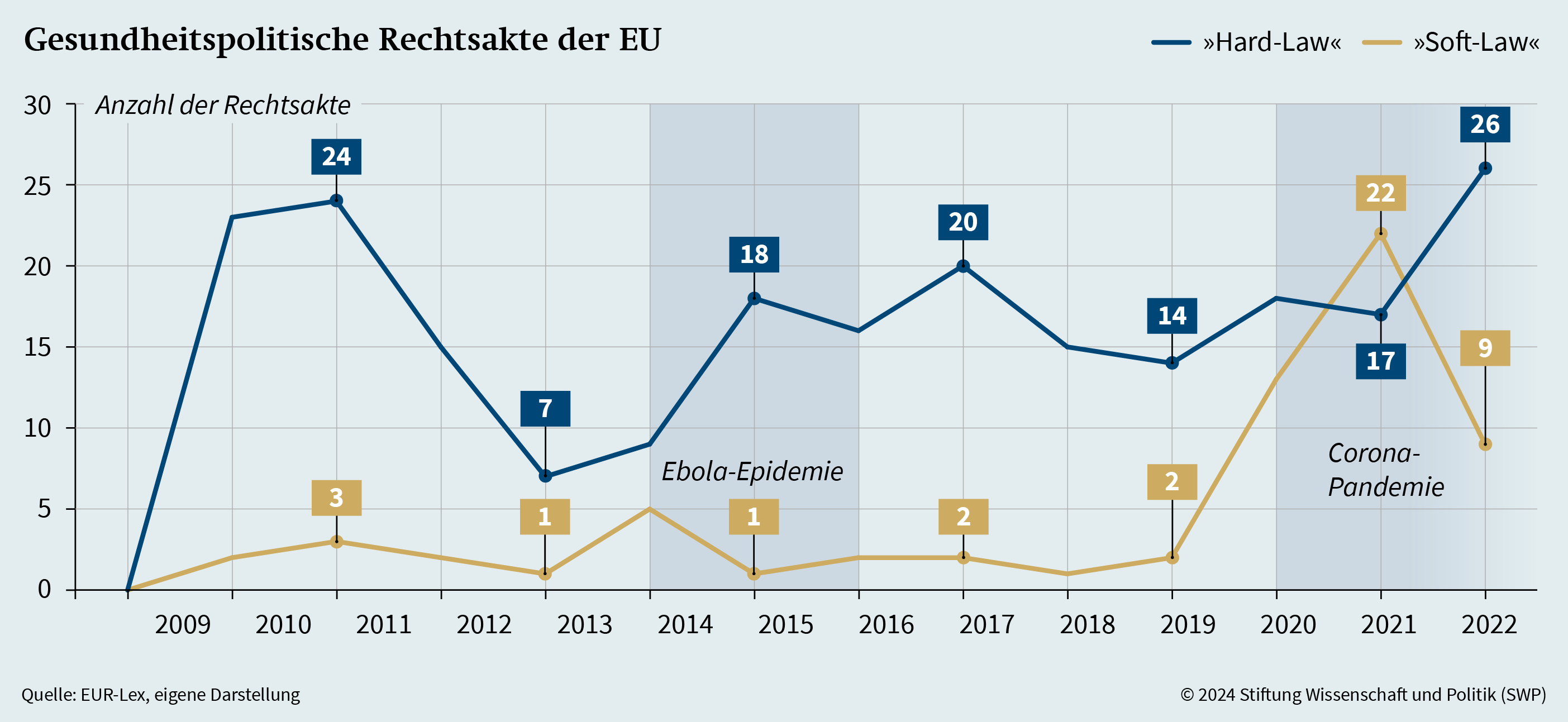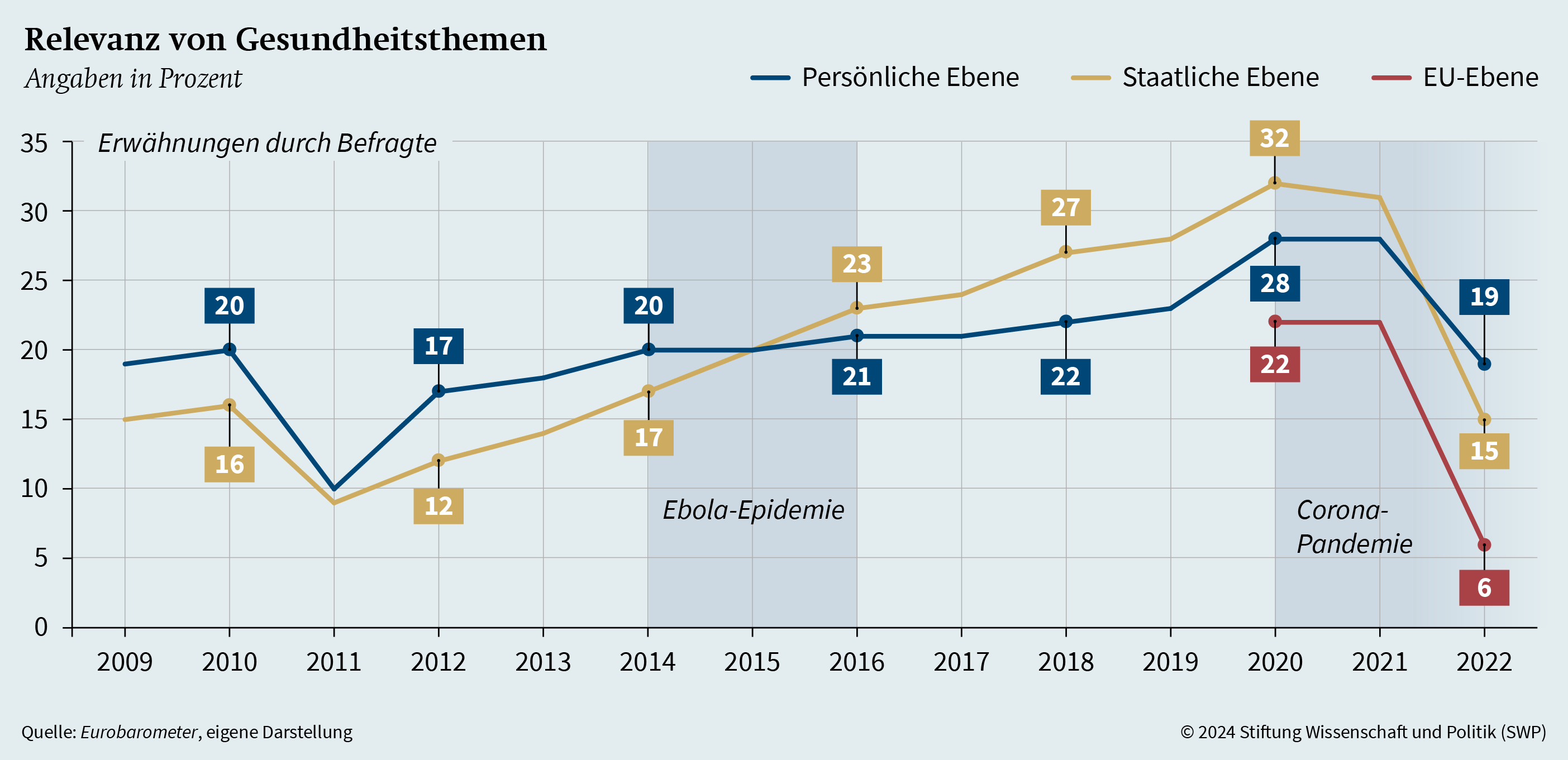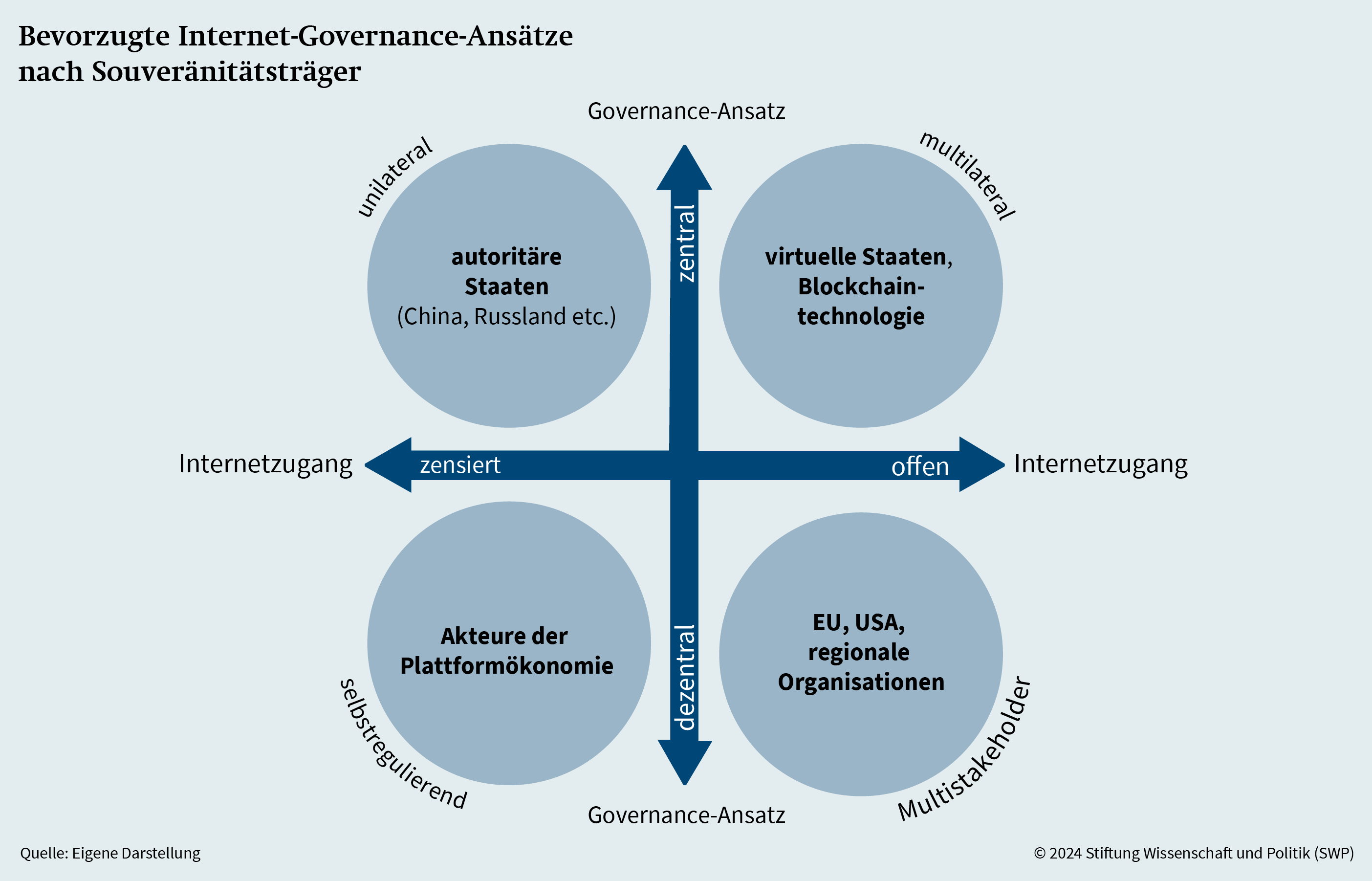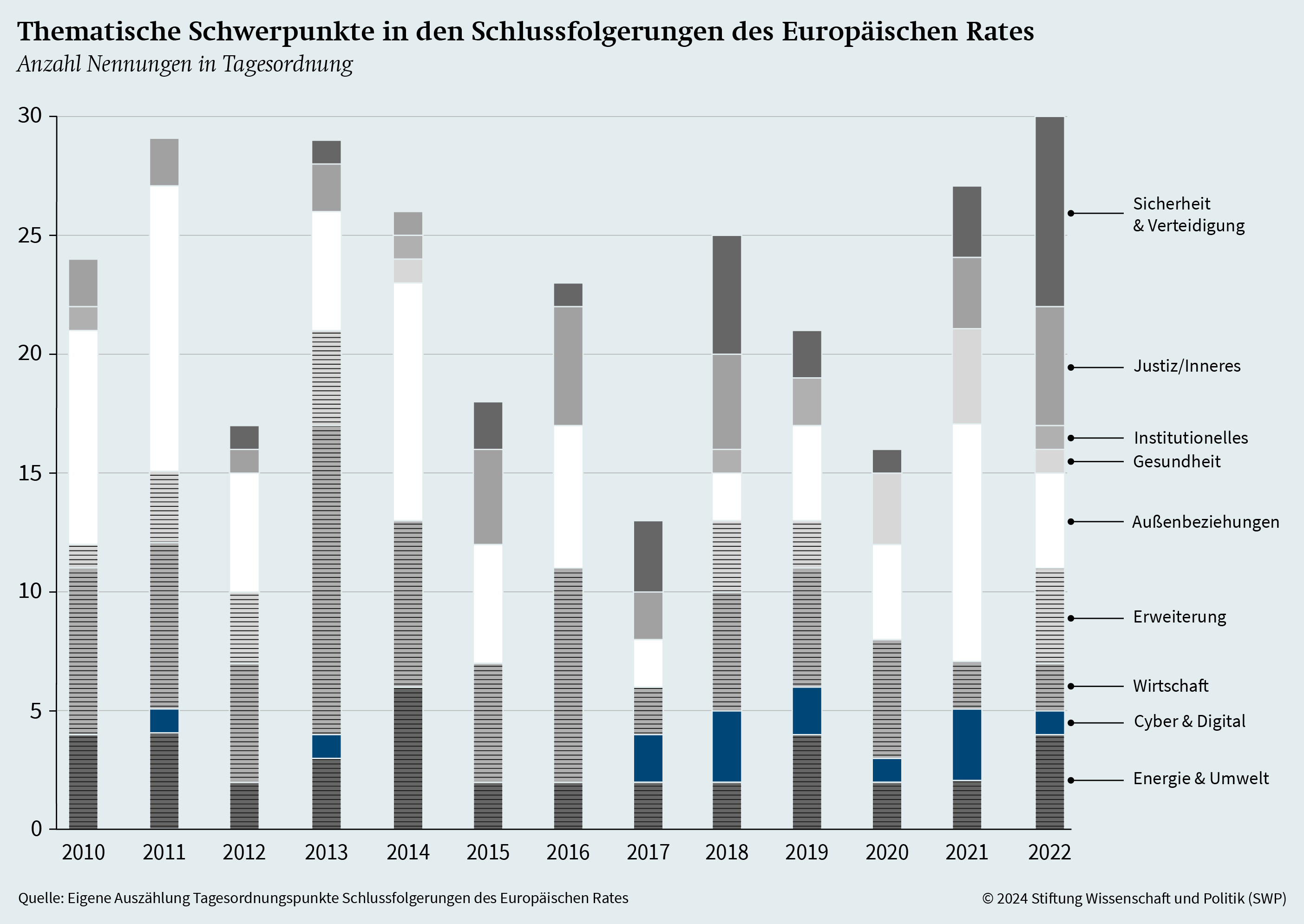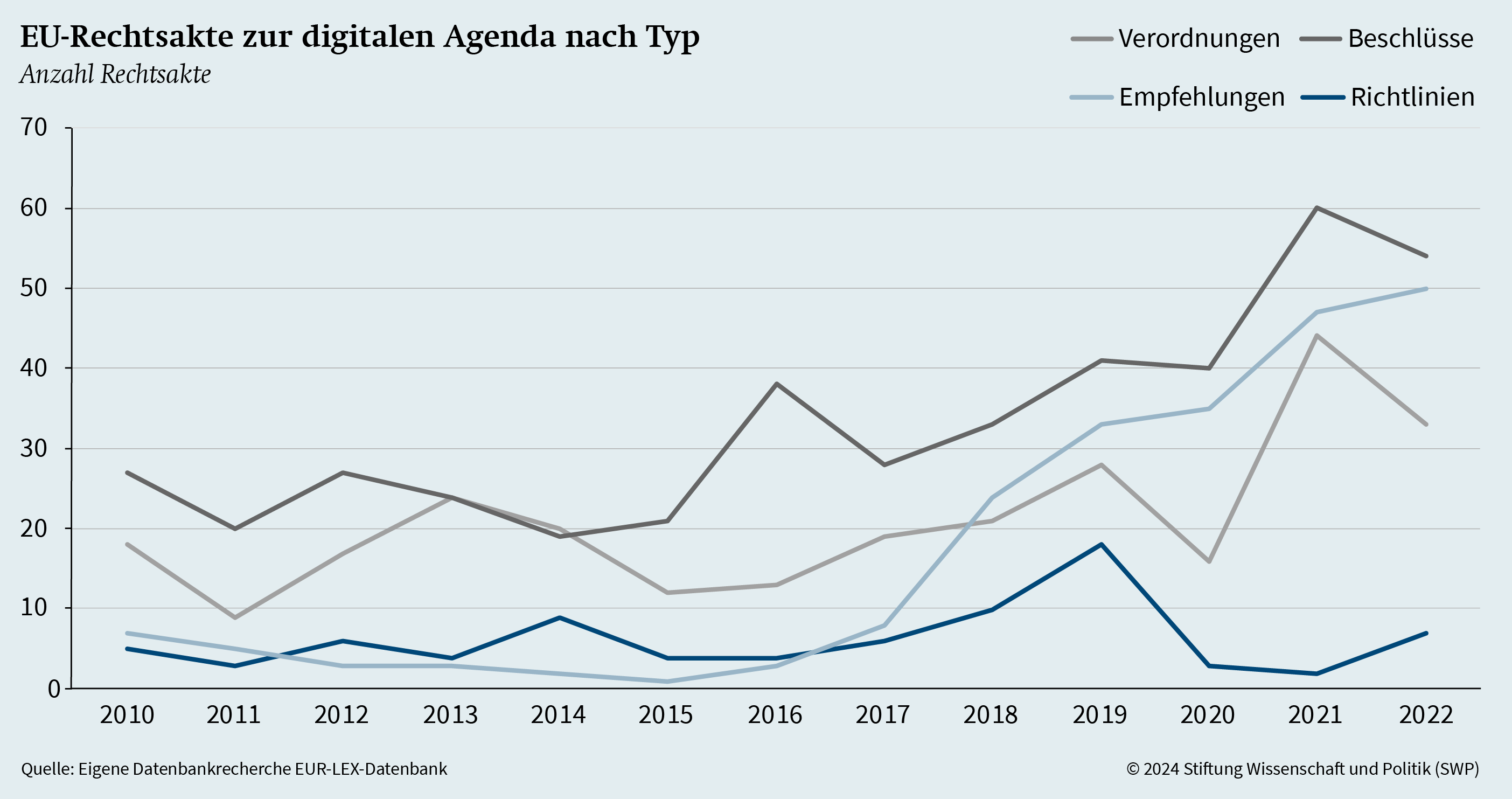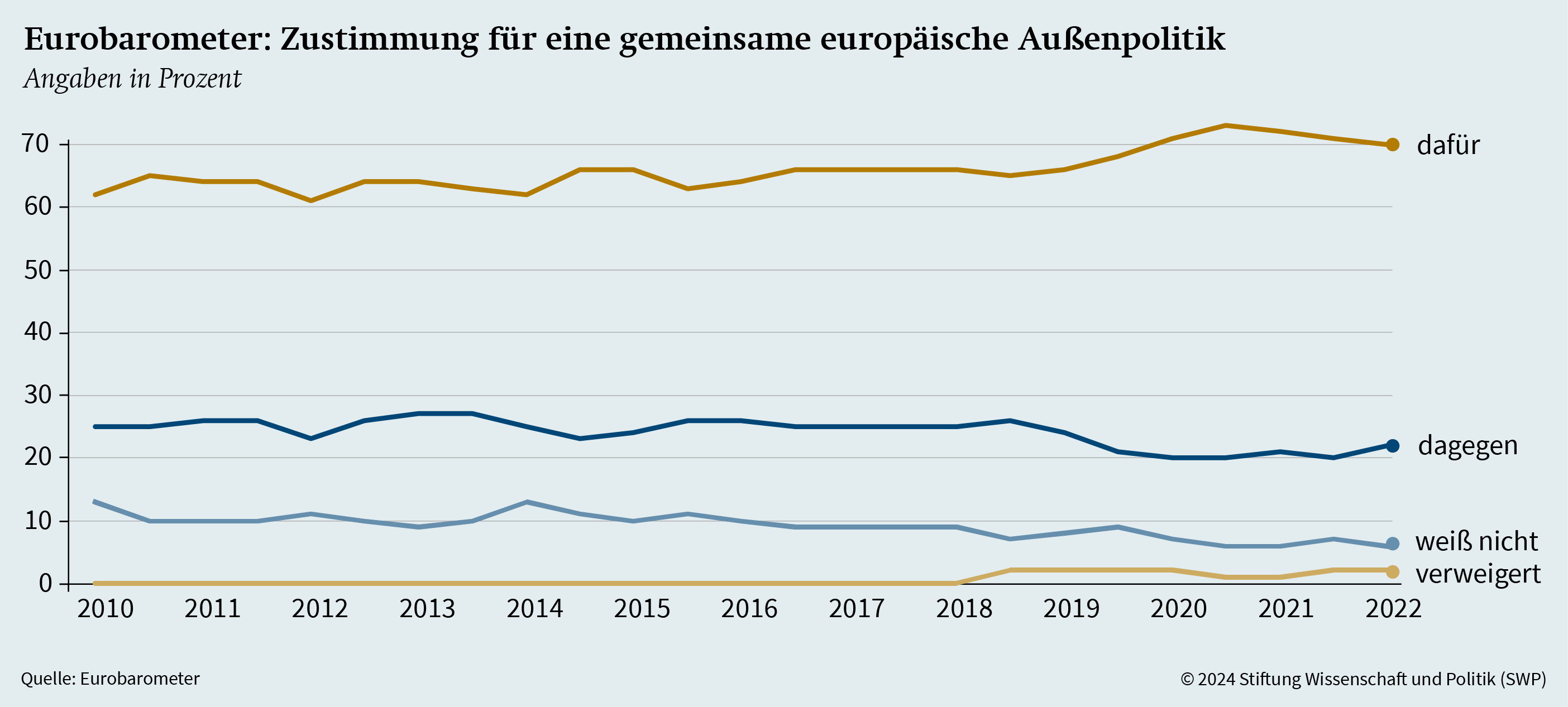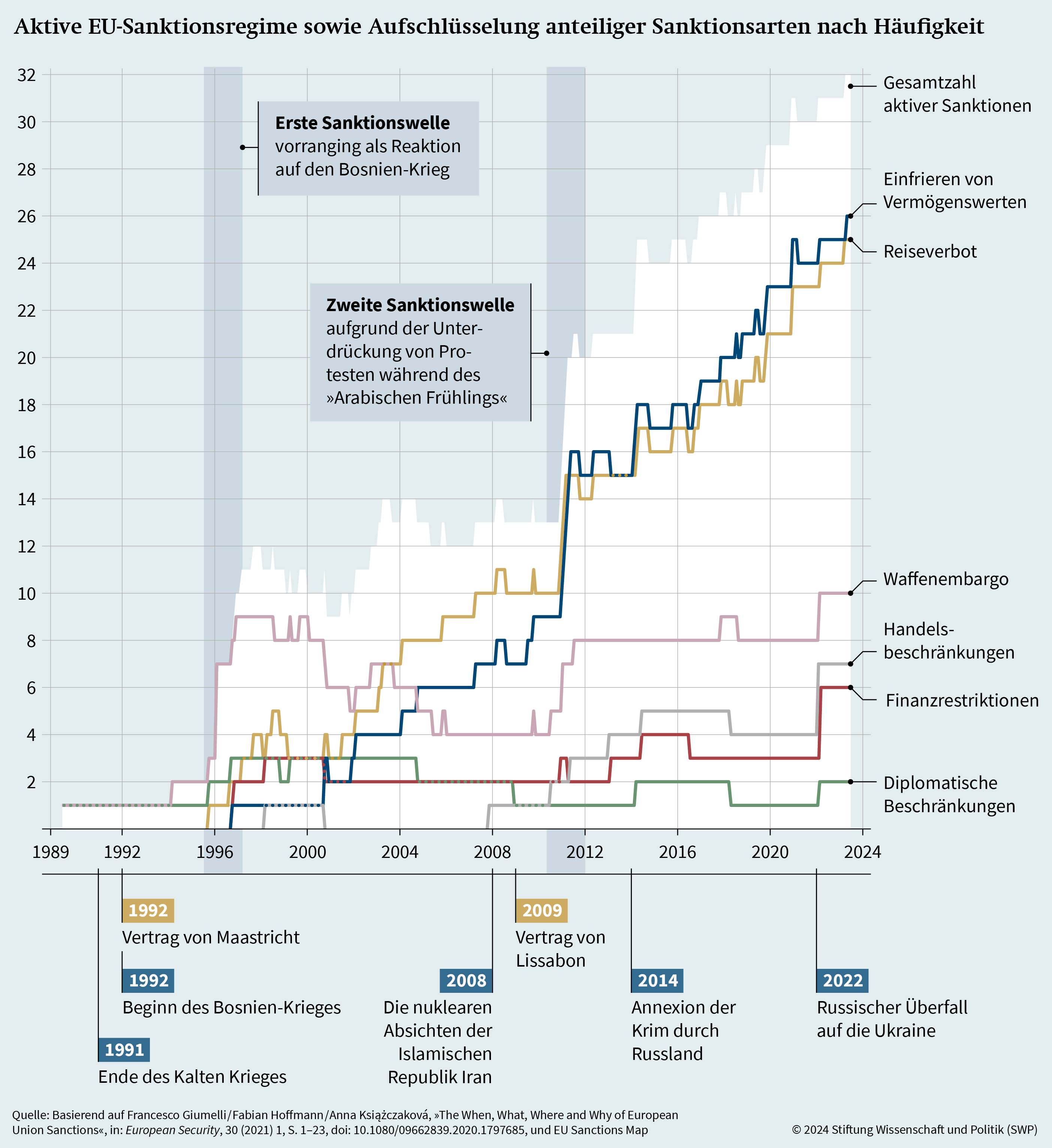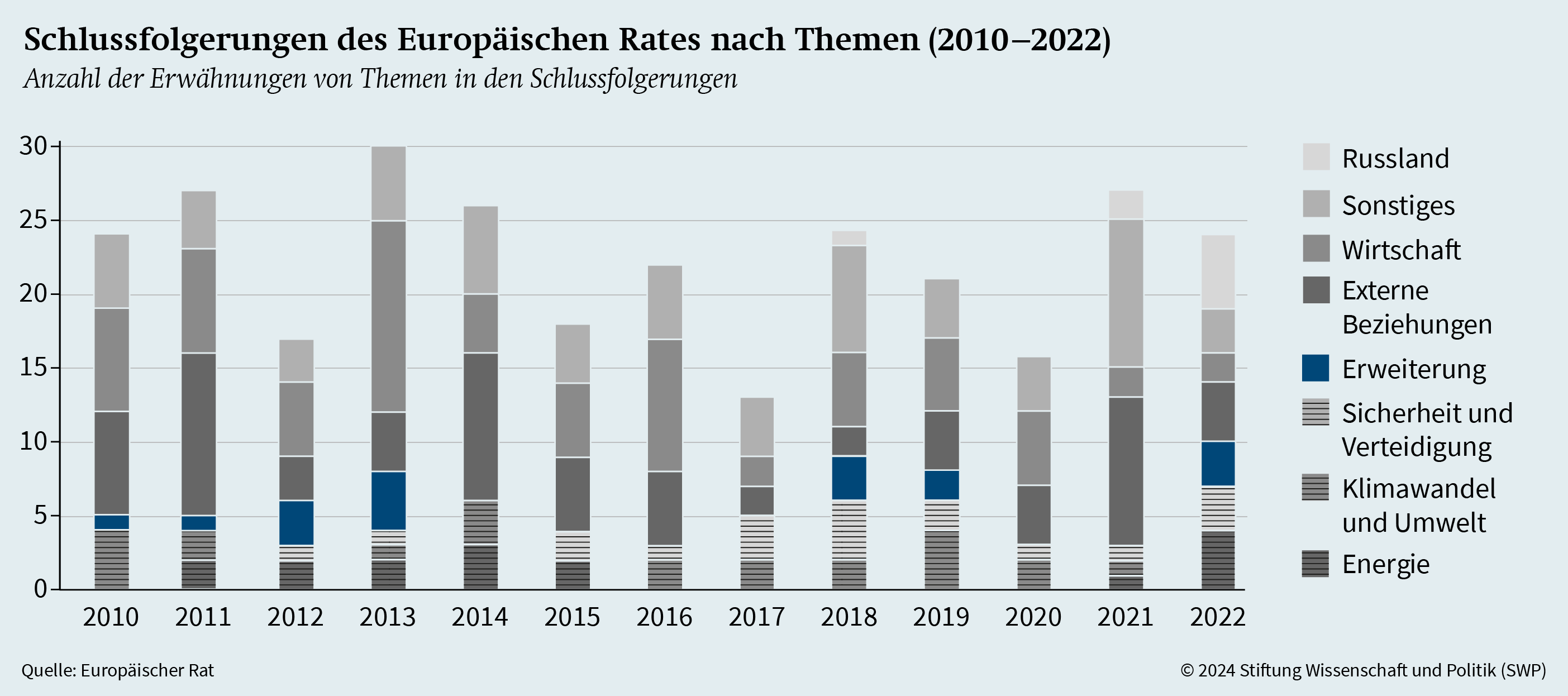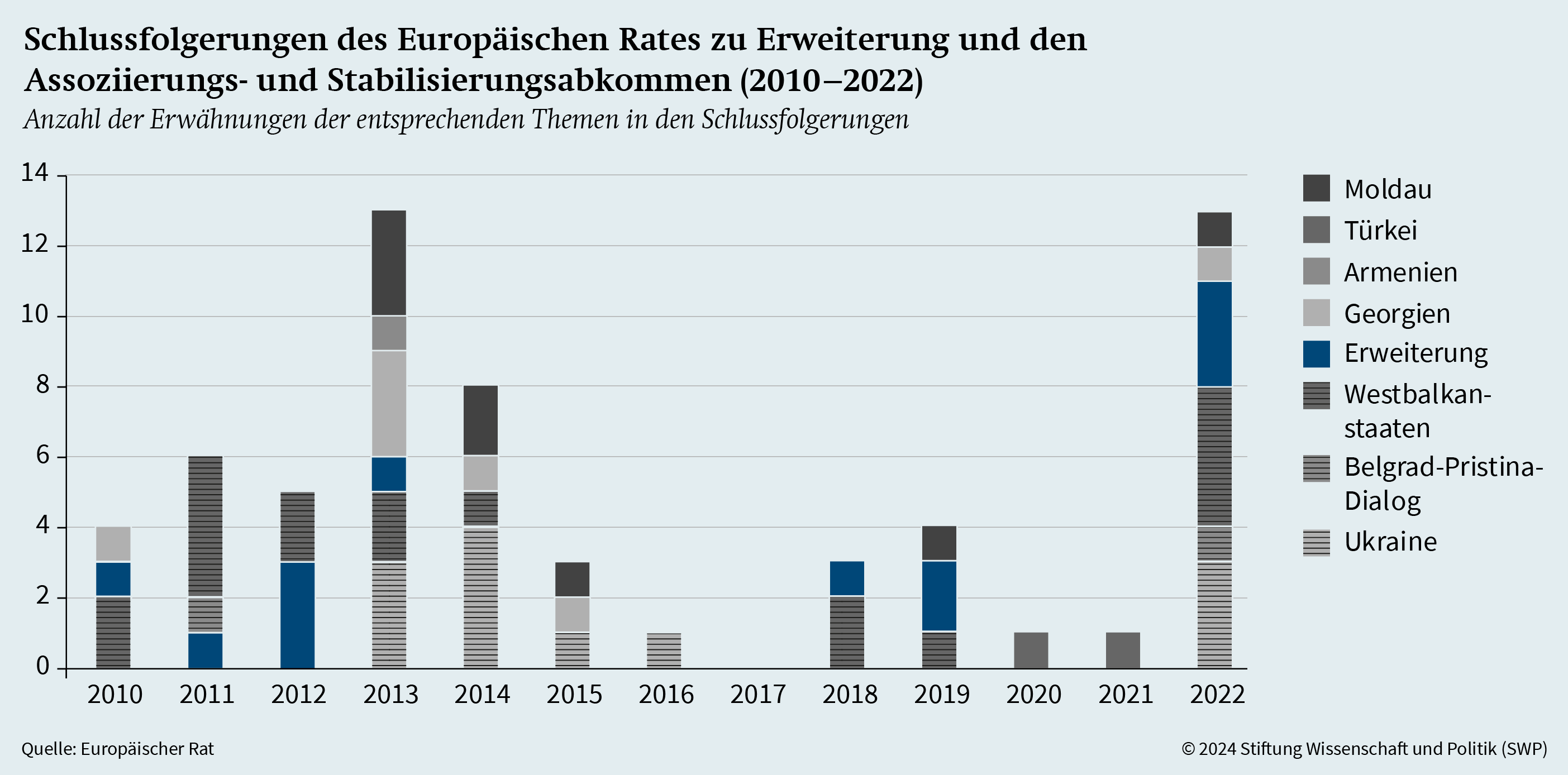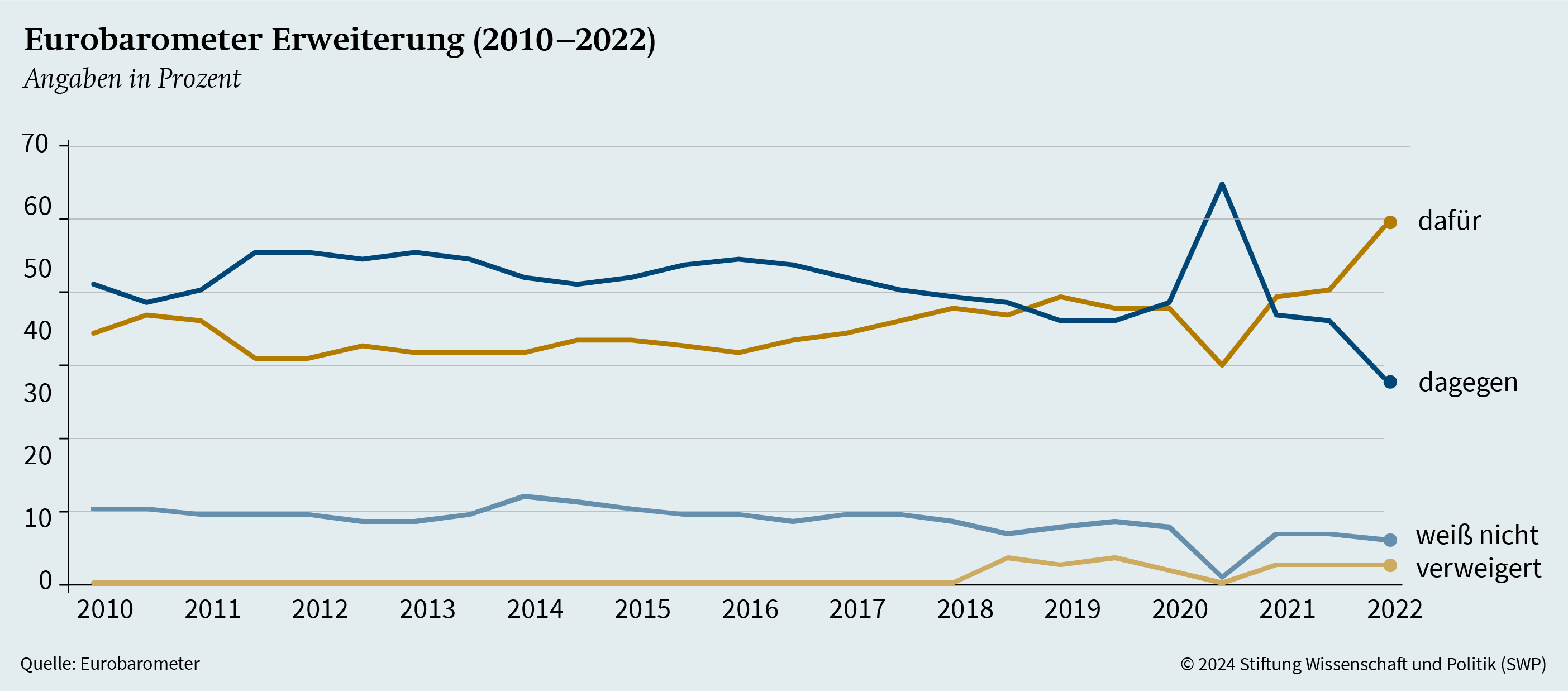Stand der Integration
Zehn zentrale politische Projekte der EU und wie sie die Union verändern
SWP-Studie 2024/S 11, 23.04.2024, 144 Seitendoi:10.18449/2024S11
Forschungsgebiete-
In den letzten 15 Jahren hat die EU in vielfachen Krisen ihre Widerstandsfähigkeit bewiesen und wichtige politische Einigungen erzielt, die teilweise über den Rahmen des Lissabon-Vertrags hinausweisen. Dabei spielten – im Sinne eines »flexiblen Krisenfunktionalismus« – exekutive Institutionen, insbesondere der Europäische Rat und die EU-Kommission, eine führende Rolle.
-
Währenddessen wurden programmatische Großprojekte der EU, vor allem in der Klima- und Cyberpolitik, gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren vorangetrieben. Dies zeigt, dass das traditionelle, eher technokratische Integrationsmodell weiterhin Bestand hat.
-
In zehn Einzelbeiträgen zu zentralen politischen Projekten der EU sowie zwei Querschnittsanalysen wird der gegenwärtige Stand der Integration ausgelotet und aufgezeigt, wie den kommenden Herausforderungen begegnet werden könnte oder müsste.
-
Die Entscheidungsfindung in der EU bleibt stark konsensorientiert. Dennoch ist die EU-Politik mit einem wachsenden Maß an Polarisation konfrontiert, insbesondere da, wo Ressourcen mobilisiert und umverteilt werden sollen oder weitreichende exekutive Entscheidungen anstehen.
-
Das derzeitige Rüstzeug der EU reicht für die anstehenden Handlungserfordernisse nicht aus. Zu den vorrangig zu lösenden Aufgaben zählen: Förderung der Rechtsstaatlichkeit, ambitionierte Reformen der Erweiterungspolitik, Stärkung von Kompetenzen und Entscheidungsverfahren sowie Ausgleich des anhaltenden Demokratiedefizits der EU.
-
Jenseits von einzelnen pragmatischen Integrationsschritten im Zuge dauerhaften Krisenmanagements gilt es deshalb, die Legitimität der EU umfassender auszubauen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung: Die Europäische Integration im Schatten der Krisen
1.1 Die EU politischer Projekte
Analysen der zentralen politischen Projekte
2 Wirtschaftspolitische Koordinierung: Von der politischen Koordinierung zu einer neuen EU-Politik
2.1 Die Aufgaben einer europäischen Wirtschaftspolitik
2.2 Wirtschaftspolitische Koordinierung in Krisenzeiten
2.3 Die Erfordernisse einer europäischen Wirtschaftspolitik
3 Stabilisierung der Staatsfinanzen: Integration der Eurozone durch Risikoteilung
3.1 Zentrale Governanceproblematik: Stabilisierung der Währungsunion
3.1.1 Finanzhilfeinstrumente: Improvisation, Verankerung und Marginalisierung
3.1.2 Interventionen des Eurosystems
3.2 Breiterer Kontext der Risikoteilung
4.1 Sollbruchstellen der europäischen Energiepolitik
4.2 Zwischen Geopolitik und Green Deal: EU-Energiepolitik seit 2014
4.4 Ausblick: Von der regulatorischen zur politischen Union?
5 Der europäische Green Deal: Ambitionssteigerung und Weiterentwicklung europäischer Klimapolitik
5.1 Zwischen externen Erwartungen, internen Konflikten und neuen Krisen
5.1.2 Neue Krisen: Corona-Pandemie und Russlands Krieg in der Ukraine
5.1.3 Hohe internationale Erwartungen
5.2 Der Stand des europäischen Green Deal
5.3 Ausblick und Handlungsempfehlung
6 Die Europäische Gesundheitsunion
6.1 Gesundheitspolitik der Europäischen Union
6.2 Konfliktfelder europäischer Gesundheitsgovernance
6.3 Stand der Gesundheitsunion
6.3.1 Gesundheitsunion vor der Covid-19-Pandemie
6.3.2 Gesundheitspolitische Rechtsakte der EU
6.3.3 Elemente der Europäischen Gesundheitsunion
6.3.4 Notwendigkeit von Vertragsänderungen?
6.4 Wege zu einer effektiven Gesundheitsunion
7.1 Der Anspruch der digitalen Souveränität und die digitale Agenda
7.3 Geopolitische Ausgangsbedingungen und zentrale Konfliktlinien
7.4 Legislative Aktivitäten im Rahmen der vier Großprojekte der digitalen Integration
7.5 Gestärkte Handlungsfähigkeit durch Etablieren einer europäischen digitalen (Sicherheits-)Kultur
7.6 Deutsche Europapolitik unter Bedingungen des Supranationalismus
8 Die Sicherheitsunion und der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
8.1 Kooperationsdynamik und Konfliktlinien
8.1.1 Inhaltliche Muster der rechtlichen Integration
8.1.2 Gegengewicht und Kontrolle durch das Europäische Parlament
8.2 Integrationsschritte und -inhalte seit 2009
8.2.1 Fokus auf Terrorismus und Grenzsicherung
8.2.2 Weitere Schritte in der strafrechtlichen Zusammenarbeit
8.2.3 Der Kernkonflikt um die Asylpolitik
9 Alte Probleme trotz neuer Instrumente in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
9.1 Grenzen europäischer Handlungsfähigkeit
9.1.1 Neue Instrumente und alte Probleme in der GASP
9.2 Eine kohärente und flexible Finanzierung der EU-Außenpolitik
9.3 Parlamentarische Kontrolle der GASP
9.4 Entscheidungsprozesse und Mehrheiten in der GASP
9.5 Neue Weichenstellungen für die europäische Außenpolitik
10 Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)
10.2 Zentrale Governanceproblematik
10.2.1 Einschränkung durch die intergouvernementale Ausrichtung
10.2.2 Einschränkung durch eine fehlende Vertiefungsoption
10.2.3 Einschränkung durch funktionale Duplizierung
10.3.2 GSVP-Missionen und -Operationen
10.4 Der russische Angriff auf die Ukraine
10.4.2 Der Strategische Kompass
10.5 Ausblick – Supranationalisierung und Differenzierung
11 Die Erweiterungspolitik der Europäischen Union: Fit für die Zukunft?
11.1 Stand der Erweiterungspolitik von 2010 bis 2022
11.2 Alte Herausforderungen und neue Anregungen für die Erweiterungspolitik
11.3 Ausblick und Handlungsempfehlung
12 Das institutionelle Gleichgewicht der EU in der Polykrise
12.2 Die doppelte Resilienz des EU-Rahmens
12.2.1 Die Petrifizierung der Verträge
12.2.2 Krisenreaktion im Rahmen der EU-Verträge
12.2.3 Differenzierung in der Umsetzung
12.3 Das Janusgesicht der EU: Exekutiv‑dominierte Krisengovernance und Gemeinschaftsmethode
12.3.1 Intergouvernemental-Exekutive Krisengovernance
12.3.2 Gemeinschaftsmethode in der Regulierung
12.4 Zwischen Fragmentierung und Drang zur Kohärenz in den Institutionen
12.4.1 Drang zum Konsens im Rat und Europäischen Rat
12.4.3 Präsidentialisierung in der Kommission
13 Mitgestaltung und Selbstbehauptung im Krisenfunktionalismus. Die Mitgliedstaaten in der Polykrise
13.1 Die Mitgliedstaaten und ihre Funktionen im Krisengeschehen
13.2 Zerklüftung und Zusammenwirken
13.3 Krisenfunktionalismus statt Spillback
13.4 Schlussfolgerungen aus deutscher Sicht
14 Schlussfolgerungen: Vom Stand zur Zukunft der europäischen Integration
14.1 Analytische Ergebnisse im Querschnitt
14.1.1 Politics: wachsende politische Responsivität und anhaltende Konsensnorm
14.1.2 Policy: unscharfe Grenzen der Integration in Bereichen der Kernstaatlichkeit
14.1.3 Polity: Exekutiv-Dominanz in den Krisen
14.2 Ausblick: Vier strukturelle Herausforderungen für die EU in der kommenden Legislaturperiode
Einleitung: Die Europäische Integration im Schatten der Krisen
Raphael Bossong / Nicolai von Ondarza
»Europa wird in Krisen geschmiedet, und es wird die Summe der zur Bewältigung dieser Krisen verabschiedeten Lösungen sein«, lautet die vielzitierte These Jean Monnets zu Krisen als Triebkräften europäischer Integration.1 An Krisen, von zum Teil existentiellem Charakter, hat es der Europäischen Union (EU) im letzten Jahrzehnt nicht gemangelt. Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Dezember 2009, der letzten großen Vertragsrevision, ist die Union sogar nahezu permanent im Krisenmodus (»Polykrise«) gewesen: Eurokrise, Migrationskrise, Rechtsstaatskrise, die Krim-Annexion und der russische Krieg gegen die Ukraine sowie die Corona-Pandemie sind nur die gravierendsten. Hinzu kommen der Aufstieg EU-skeptischer und populistischer Parteien sowohl in den Mitgliedstaaten als auch im Europäischen Parlament sowie in den Jahren 2016 bis 2020 mit Donald Trump ein US-Präsident, der die EU eher als Konkurrentin denn als Partnerin behandelte. Mit dem Brexit hat zudem erstmals ein Mitglied die Union verlassen und so – wenn auch bis dato zu hohen wirtschaftlichen und politischen Kosten – demonstriert, dass die europäische Integration reversibel ist. Im Zuge all dessen hat sich das öffentliche Bild einer Europäischen Union verfestigt, die permanent um ihr eigenes Überleben ringt, deren Mitgliedstaaten untereinander zerstritten sind und die oft in ihrer Handlungsfähigkeit den komplexen Herausforderungen nicht ausreichend gewachsen ist. Auch in der europawissenschaftlichen Debatte sind die Auswirkungen von Krisen zum zentralen Ausgangspunkt von Analysen zur Entwicklung der EU-Integration geworden. Krisen werden dabei als Höhe- oder Wendepunkte gefährlicher Entwicklungen verstanden, durch die offene Entscheidungssituationen entstehen. Diese können von den politischen Entscheidungsträger:innen sowohl zur Vertiefung der bedrohten EU als auch zu deren Desintegration genutzt werden.2
Eine andere Interpretation der EU nach ihrem Krisenjahrzehnt zeichnet hingegen das Bild einer Union, die sich dem hohen internen wie externen Druck zum Trotz als resilient erwiesen hat. Sie war demnach zwar erst angesichts der Krisen zu Integrationsschritten fähig, hat sich dabei aber grundlegend weiterentwickelt. Failing forward ist hier das Stichwort.3 Dies ist das Bild einer EU, die beim russischen Krieg gegen die Ukraine mit großer Einigkeit präzedenzlose Sanktionen gegen Russland verabschiedet, die mit ihren Mitgliedstaaten neben den USA umfassende finanzielle und militärische Hilfen für die Ukraine mobilisiert, die eine zentrale Rolle bei Beschaffung und Verteilung von Corona-Impfstoffen sowie der Finanzierung der wirtschaftlichen Erholung übernommen und die Zahl der Eurostaaten trotz Eurokrise von 16 auf mittlerweile 20 Staaten vergrößert hat.4 Doch auch und gerade über die Krisenfelder hinaus war die Europäische Union in anderen Politikbereichen zu tiefgreifender Gesetzgebung in der Lage; davon zeugen etwa der europäische Green Deal zur Ausgestaltung der Transformation in Klima- und Energiepolitik oder der Digital Services Act und der Digital Market Act zur digitalen Regulierung.
Unter dem Eindruck dieser Krisen ist die Europäische Union deutlich politisiert worden. Lange vorbei sind die Zeiten des »permissiven Konsenses« darüber, dass die »immer engere Union« und weitere europäische Vertiefung von allen Regierungen der Mitgliedstaaten zumindest im Grundsatz getragen werden. Vielmehr finden sich in allen Mitgliedstaaten (mit Ausnahme Maltas) EU-skeptische oder sogar ‑feindliche Parteien, die in immer mehr Staaten auch Regierungsverantwortung übernommen haben oder sogar an der Spitze der Regierung stehen. Das lange Zeit hohe Maß an Einigkeit in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine etwa wird durch Uneinigkeit zwischen West- und Mittel-/Osteuropa (beispielsweise über den Umgang mit Russland) oder Nord- und Südeuropa (unter anderem in der Wirtschaftspolitik) konterkariert.5 Nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel und der israelischen Reaktion darauf zeigte sich die EU außenpolitisch tief gespalten.6 Parteipolitisch manifestiert sich sowohl in den EU-Institutionen als auch innerhalb der Mitgliedstaaten ein wachsendes Maß an Fragmentierung, das zulasten der früher dominanten Parteien der Europäischen Volkspartei und der europäischen Sozialdemokraten geht.7 In der aktuellen Legislaturperiode sind im Europäischen Parlament, analog zur Regierungsbildung in vielen EU-Staaten, für Beschlüsse komplexe Mehrheiten aus mindestens drei Fraktionen notwendig. Zugenommen haben auch die interinstitutionellen Rivalitäten, zumindest in Fragen der Weiterentwicklung der EU. So war etwa die Konferenz zur Zukunft Europas 2021/22 von Machtspielen zwischen Parlament, Rat und Kommission überschattet.8 Seitdem fordert das Europäische Parlament immer lautstärker fundamentale Reformen der EU, einschließlich der Einberufung eines Konvents für Vertragsänderungen,9 während der Großteil der Mitgliedstaaten – zumindest jenseits existentiellen Krisendrucks – die Abgabe weiterer Souveränität an die EU und neue institutionelle Debatten ablehnt.10 Im Krisenfall dagegen haben die Mitgliedstaaten immer wieder neue Instrumente ohne Parlamentsbeteiligung geschaffen.11
Eben jene institutionellen Reformdebatten haben mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine neue Dynamik erhalten. So hat der Beschluss des Europäischen Rates vom Juni 2022, der Ukraine und der Republik Moldau den EU-Kandidatenstatus zu verleihen, das geostrategische Element in der Erweiterungspolitik und die Perspektive einer EU mit 35 oder mehr Mitgliedstaaten wiederbelebt. Auch wenn die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten vor 2030 unwahrscheinlich ist, vertreten zumindest Deutschland und Frankreich die Ansicht, dass vor der nächsten Erweiterung umfassende institutionelle Reformen notwendig seien, um die Handlungsfähigkeit der EU zu erhalten und zu festigen.12 Im Dezember 2023 haben die EU-Staats- und ‑Regierungschefs (in Abwesenheit von Viktor Orbán) auf dem Europäischen Rat sowohl die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine und der Republik Moldau beschlossen als auch das Ziel bekräftigt, die Erweiterung der EU und interne Reformen parallel voranzutreiben.13 In Reaktion auf den Bericht der deutsch-französischen Expertengruppe zu EU-Reform und Erweiterung14 hat dabei auch die Debatte an Fahrt aufgenommen, ob und inwieweit in einer EU mit mehr als dreißig Mitgliedstaaten auch ein höheres Maß an Differenzierung innerhalb der Union und in ihrem Umfeld geboten sei.
In der Gesamtschau zeigt sich also, dass die Europäische Union vielschichtiger ist als eine »Krisenunion«, mit deutlichen Unterschieden je nach Politikbereich. Um dieser Komplexität gerecht zu werden und Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung der EU zu geben, werden in diesem Gemeinschaftsprojekt der Forschungsgruppe EU / Europa der Stiftung Wissenschaft und Politik der Stand der Integration und die Entwicklungsperspektiven der EU analysiert. Im Vordergrund stehen dabei vier Fragestellungen: Wie hat sich die EU unter dem Einfluss der Polykrise in verschiedenen zentralen politischen Projekten entwickelt, insbesondere soweit diese Kernbereiche nationaler Souveränität betreffen? Haben die krisengetriebenen Politikentscheidungen europäisches Regieren quantitativ und qualitativ verändert, auch mit Spill-over-Effekten über das jeweilige Politikfeld hinaus? Wie haben sich das Machtgefüge und die Konfliktlinien zwischen den EU-Institutionen sowie zwischen den Mitgliedstaaten innerhalb der Politikbereiche verändert? Und welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus der Analyse für die politischen Prioritäten der EU bis 2030 ableiten?
Zur Beantwortung dieser Fragen befassen wir uns in dieser Sammelstudie mit der Entwicklung der Integration in insgesamt zehn zentralen politischen Projekten der EU sowie übergreifend mit deren Auswirkungen auf die Machtverhältnisse zwischen den Mitgliedstaaten und Institutionen der EU. Als Untersuchungszeitraum wird jeweils der Prozess seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Dezember 2009 bis heute in den Blick genommen, mit Variationen je nachdem, wann bei den jeweiligen politischen Projekten die größten Entwicklungsschübe zu beobachten waren. Damit ist die komplette Dauer der EU-Polykrise abgedeckt. Zudem unterliegen alle untersuchten Projekte der gleichen primärrechtlichen Kompetenz- und Institutionenordnung durch den Lissabonner Vertrag.
Die EU politischer Projekte
Um die Bandbreite des Standes an Integration in der EU zu erfassen, muss man sich verschiedene Politikfelder und Bereiche der EU anschauen. Denn sie wirkt heute mit ihrer Politik in fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens hinein und übernimmt dabei wichtige Aufgaben bei der Bereitstellung öffentlicher Güter, wenn auch mit breitgefächerter Kompetenzgrundlage, von ausschließlichen über geteilte bis hin zu lediglich koordinierenden Zuständigkeiten. In Krisensituationen entsteht dadurch selbst in Bereichen, in denen die Union nur begrenzte oder gar keine formellen Kompetenzen hat, in der Bevölkerung die Erwartung, dass die EU zur Lösung oder Eindämmung der Krise beiträgt.
Das beste Beispiel hierfür ist die Corona-Pandemie. Obgleich die Gesundheitspolitik nicht zu den geteilten Kompetenzen der EU gehört, sollte die Union aus Sicht der Bevölkerung durch Solidarität, Bereitstellung von Ressourcen und gemeinsame Regelungen zur Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen beitragen. Mit gemeinsamer Impfstoffbeschaffung, digitalem Impfzertifikat, Unterstützung von nationalen Kurzarbeitsprogrammen und nicht zuletzt dem Wiederaufbaufonds NextGenerationEU (NGEU) hat die EU – nach kurzer Schockstarre – im Verlauf der Pandemie eine Reihe von innovativen Instrumenten erarbeitet, mit denen sie jenseits ihrer begrenzten Kompetenzgrundlage einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen leisten konnte.15
Hinzu kommt, dass auch in anderen Politikbereichen zunehmend Politikinhalte aus unterschiedlichen vertraglich definierten Feldern – zum Teil mit unterschiedlichen Kompetenzgrundlagen – zu einem politischen Projekt verknüpft werden.
So berührt etwa der europäische Green Deal über die klassische Klimapolitik hinaus die Außenhandelspolitik (in Form des CO2-Grenzausgleichsystems), die Energiepolitik, die Agrarpolitik und mit Vorgaben zu Bauwirtschaft oder Auto- und Luftverkehr auch Aspekte der Wirtschafts- und Industriepolitik. Aus diesem Grund haben wir uns bei der Auswahl und Analyse der Themen in dieser Sammelstudie nicht ausschließlich an den vertraglich festgelegten Kompetenzbereichen orientiert, sondern auch an den politisch definierten zentralen Projekten der EU. Dabei zeigt sich, wie die tatsächlichen vertraglichen Kompetenzen in der Umsetzung der Vorhaben den jeweiligen Handlungsspielraum und die Beschlussfassung bestimmen.
Die zentralen politischen Projekte der EU lassen sich aus drei Quellen ableiten. Da ist erstens die Strategische Agenda des Europäischen Rates, mit der die Staats- und Regierungs:chefinnen der EU jeweils zu Beginn eines institutionellen Zyklus – also der Legislaturperiode des Europäischen Parlaments und der Amtszeit einer EU-Kommission – die politischen Prioritäten für die nächsten fünf Jahre festlegen. Im aktuellen institutionellen Zyklus (2019–2024) waren dies etwa der Schutz der Bürger:innen und ihrer Freiheiten, der Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit durch Entwicklung eines europäischen Zukunftsmodells, die Verwirklichung eines grünen, fairen und sozialen Europas sowie die Stärkung der EU in der Welt.16 Mit Blick auf die tatsächlichen Befassungen des Europäischen Rates (siehe Grafik 1) kommen noch die krisenbedingten Prioritäten hinzu. In den Jahren 2020 bis 2022 war dies etwa die Pandemiebekämpfung, und 2022/23 standen die Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriff und damit verbunden Sicherheit und Verteidigung sowie Energiepolitik im Vordergrund.
Als zweite Quelle institutioneller Schwerpunktsetzung sind die politischen Prioritäten der EU-Kommission von Bedeutung, sowohl pro fünfjähriger Legislaturperiode als auch in ihren jährlichen Arbeitsprogrammen. Diese sind politisch in der Regel eng an die Strategische Agenda des Europäisches Rates angelehnt, aber nicht vollständig damit identisch. So verfolgt etwa die amtierende Kommission von der Leyen sechs Prioritäten, von denen der europäische Green Deal, die Stärkung der europäischen Wirtschaft (»Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen«) und jene der EU in der Welt sich weitgehend mit der Agenda des Rates überschneiden.17 In den drei Prioritäten Digitalstrategie, Förderung der europäischen Lebensweise (einschließlich Rechtsstaatlichkeit) sowie Festigung der Demokratie in Europa gibt es leichte Abweichungen von der Prioritätensetzung des Rates.
Drittens wurden zur Identifizierung der zentralen politischen Projekte jene politischen Themen herangezogen, die den EU-Bürger:innen am wichtigsten sind.
Betrachtet man ausgewählte Hauptthemen – Wirtschaftspolitik, Klimapolitik, Energiepolitik, Außen- und Sicherheitspolitik, Migration oder Gesundheitspolitik –, so zeigt sich ein hohes Maß an Überschneidungen von Erwartungen der Bürger:innen mit der offiziellen EU-Agenda (siehe Grafik 1). Kommt es zu akuten Krisen, die insbesondere im Europäischen Rat verhandelt werden, erweisen sich die EU-Institutionen als besonders responsiv. Die »Gesundheitsunion« hat die Kommission von der Leyen in Reaktion auf die Corona-Pandemie ausgerufen, und die »Energieunion« sollte die Antwort der EU auf die Erpressbarkeit durch Nutzung fossiler Energieträger und die steigende (Energiepreis-)Inflation im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sein. Längerfristig schwelende Herausforderungen wie die Transformation der Wirtschaft werden eher über die EU-Gesetzgebung von Kommission, Ministerrat und Parlament als durch Kriseninterventionen des Europäischen Rats behandelt.
Mehr als eine Krisenunion
Zehn Themen wurden auf Basis dieser Erkenntnisse für die Analyse zum Stand der Integration ausgewählt: die Neuordnung der wirtschaftspolitischen Koordinierung, die Frage der Risikoteilung bei der Weiterentwicklung der Eurozone, die Energiepolitik, der Green Deal, die Gesundheitsunion, die Cyber- und Digitalpolitik, die Sicherheitsunion (einschließlich der Asyl- und Migrationspolitik), die Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Verteidigungspolitik und nicht zuletzt die Erweiterungspolitik.
In seinem Beitrag zur wirtschaftspolitischen Koordinierung der EU untersucht Peter Becker den Widerspruch, der in der europäischen Wirtschaftspolitik durch die nationale Souveränität der Mitgliedstaaten und die Notwendigkeit gemeinschaftlicher Handlungsmöglichkeiten entsteht. Das wirtschaftspolitische Instrumentarium der EU ist dadurch unvollständig. Die wirtschaftspolitische Reaktion der Union auf Krisen wird von den nationalen Regierungen dominiert, während in Zeiten wirtschaftspolitischer Routine die Kommission die europäische Wirtschaftspolitik bestimmt. Becker schlägt vor, die EU mit zusätzlichen wirtschaftspolitischen Werkzeugen wie einer erweiterten Zuständigkeit für steuerpolitische Fragen auszustatten, damit sie wirksame Anreize setzen kann. Das Ziel sollte lauten, mehr gemeinschaftliche öffentliche Güter durch eine europäische Wirtschaftspolitik bereitzustellen, die in höherem Maße als bisher demokratisch legitimiert ist.
Die Eurozone war der Ausgangspunkt der ersten großen EU-Krise unter dem Vertrag von Lissabon: der Eurokrise. In seinem Beitrag analysiert Paweł Tokarski den aktuellen Stand zur weiterhin kritischen Frage der Risikoteilung, die sich von dem ursprünglichen No-bailout-Ansatz über konditionalisierte Bailouts wie die Hilfspakete für Griechenland zum Whatever-it-takes-Regime entwickelt hat. Heute stützt sich die Risikoteilung auf drei Elemente: den – politisch hoch belasteten und außerhalb des EU-Systems angesiedelten – Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), die Interventionen der Europäischen Zentralband (EZB) auf dem Anleihemarkt und die Ungleichgewichte im sogenannten Target-2-System. In der Summe erfolgte die Risikoteilung dabei durch einen chaotischen, krisengetriebenen Prozess mit aktiven Interventionen der EZB und automatisch im Interbankenverkehr entstehenden Ungleichgewichten. Als Ergebnis wird das derzeitige System der Risikoteilung durch den geldpolitischen Kanal dominiert. Perspektivisch aber sollte die politische Ebene dazu eine Alternative schaffen, beispielsweise durch eine stärkere Verknüpfung mit dem ESM.
In seinem Beitrag »Krisenimprovisation oder Quantensprung?« analysiert Lasse Michael Böhm die EU-Energiepolitik im Zeichen von Ukraine-Krieg und Green Deal. Die Energiepolitik gehört zu den Bereichen, in denen die Erwartungen der Bevölkerung und die tatsächlichen Kompetenzen der EU weit auseinanderklaffen. So ist die Unionskompetenz auch nach dem Vertrag von Lissabon weitgehend auf »negative Integration« beschränkt, also darauf, Markthemmnisse und Divergenzen abzubauen, während Fragen etwa zum Energiemix in nationaler Hand bleiben. Gleichzeitig spricht sich in Eurobarometer-Umfragen eine deutliche Mehrheit der Befragten für eine Abkehr von fossiler Energie aus Russland, einen raschen Ausbau erneuerbarer Energien und eine Ausweitung der gemeinsamen europäischen Energiepolitik aus. Vor dem Hintergrund des Krieges ist es der EU im Jahr 2022 tatsächlich gelungen, nicht nur den Green Deal weiterzuverfolgen, sondern angesichts großer Geschlossenheit Maßnahmen zur Befüllung der Gasspeicher, zum gemeinsamen Gaskauf und zur Regulierung zwecks Eindämmung der Energiepreisinflation zu verabschieden. Dabei hat die EU jedoch verstärkt auf den Notstandsartikel 122 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zurückgegriffen. Für die nächste Legislaturperiode stellt sich daher die Frage, ob diese pro-aktive Herangehensweise auch jenseits der akuten Krise und angesichts nach wie vor zwischen den Mitgliedstaaten bestehender Differenzen zum Energiemix aufrechterhalten werden kann.
Eng verbunden mit der Energiepolitik ist die Analyse des Green Deal von Felix Schenuit. Der Green Deal gilt als das wichtigste Projekt der Kommission von der Leyen und das größte Legislativpaket dieses institutionellen Zyklus. Darüber hinaus greift er mit über zehn Gesetzgebungsprozessen nicht nur in die Klimapolitik, sondern in viele andere Politikbereiche ein, darunter die Agrarpolitik, die Industrie- oder die Wirtschaftspolitik. Schenuits Analyse zeigt, dass es der Kommission auf der einen Seite gelungen ist, die Kernvorhaben auch unter veränderten Umständen (Pandemie, energiepolitische Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine) durch Rat und Parlament zu bringen. Auf der anderen Seite haben die politischen Konfliktlinien sowohl zwischen den Mitgliedstaaten als auch im Parlament eher zu- als abgenommen. Mit Blick auf die Europawahlen 2024 und darüber hinaus steht daher zu erwarten, dass sich die Polarisierung und Politisierung der EU-Klimapolitik verschärfen werden.
Michael Bayerlein verfolgt demgegenüber die Frage, ob und inwiefern die Europäische Gesundheitsunion (EGU) nach der Pandemie (und somit nachlassender Politisierung) weiterentwickelt werden kann. Er betont, dass der Aufbau der EGU im Kern mit der Schaffung eines gemeinsamen Handlungsrahmens in Fragen der grenzüberschreitenden öffentlichen Gesundheit sowie der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung einhergehen muss. Trotz beschränkter Kompetenzen hat die EU bereits vor der Corona-Pandemie Rechtsakte erlassen. Diese Ansätze wurden während der Pandemie ausgebaut, ohne den Kompetenzrahmen qualitativ zu erweitern. Letzteres, schlussfolgert Bayerlein, erscheint nachrangig. Stattdessen sollte der bestehende Handlungsspielraum effizienter genutzt werden, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und die medizinische Versorgung innerhalb der EU zu verbessern. Konkrete nächste Schritte könnten die Erweiterung des Mandats für das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) um die Erhebung von Gesundheitsdaten und die Entwicklung einer Strategie zur Verbesserung der medizinischen Versorgung durch gezielte Förderung mittels EU-Fonds und im Rahmen des Europäischen Semesters umfassen.
Annegret Bendiek und Isabella Stürzer unterstreichen in ihrem Beitrag zur digitalen Agenda der EU, dass die Union zunehmend als geopolitische digitale Akteurin auftritt, was durch den transnationalen Charakter digitaler Technologien und Märkte begünstigt wird. Die Autorinnen zeigen auf, dass die EU durch europäische Gesetzgebungsinitiativen als globale Standardsetzerin in der Digitalmarktregulierung an Einfluss gewinnt, diese aber auch investitions- und innovationshemmend wirken können, wenn Rechtsunsicherheiten fortbestehen. Mit dem EU-Rechtsakt zur Cybersicherheit wurde ein wichtiger Integrationsschritt vollzogen, während das Gesetz über künstliche Intelligenz (AI Act) eine weitere Pionierleistung darstellen könnte. Trotz dieser Fortschritte ist die europaweite Digitalpolitik eher von Fragmentierung als von Integration gekennzeichnet, mit unterschiedlichen Fortschritten in Digitalisierung und Digitalwirtschaft sowie variierenden Konzepten von Infrastruktur-Resilienz in den Mitgliedstaaten. Bendiek und Stürzer schlagen vor, nicht auf eine Entkopplung von China, sondern auf die Reduktion von Risiken zu setzen, und betonen die Notwendigkeit von Kooperation anstelle von Autonomie. Sie warnen vor protektionistischen Tendenzen; die EU sei besser beraten, ihre bereits existierenden Kapazitäten auszubauen und dafür zu sorgen, dass sie als Zielmarkt attraktiver wird.
In seinem Beitrag zur Sicherheitsunion analysiert Raphael Bossong die Entwicklung der EU-Integration im Bereich von Grenzsicherheit, innerer Sicherheit und anderen nichtmilitärischen Sicherheitssektoren. Sowohl die terroristische Bedrohung als auch der starke Zustrom von Flüchtenden haben diesen Bereich, insbesondere seit 2015, ins Zentrum der EU-Prioritäten rücken lassen. Das rechtlich undefinierte Projekt der Sicherheitsunion stützt sich dabei primär auf die vertraglichen Kompetenzen im »Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechtes«. Hier zeigt die Analyse, dass sich die EU-Aktivitäten in diesem besonders sensiblen Bereich staatlicher Souveränität ebenfalls verschoben haben: von einem »negativen« Integrationsprozess, also dem Abbau grenzüberschreitender Hindernisse, zur Ambition einer »positiven« Integration mit gemeinsamen Befugnissen für EU-Agenturen und Standards. Auf der einen Seite ist es trotz hochgradiger Politisierung und harter Konflikte über Solidarität und Lastenteilung gelungen, langfristig den Ausbau europäischer Kapazitäten etwa durch EU-Agenturen, gemeinsame Daten- und Informationssysteme sowie in der Terrorismusbekämpfung voranzutreiben. Auf der anderen Seite bleiben viele strukturelle Probleme der Asyl- und Migrationspolitik ungelöst, während gleichzeitig die normativen Grundlagen der EU in Hinsicht auf die Wahrung von Grund- und Menschenrechten erschüttert wurden.
Dominik Rehbaum analysiert in seinem Beitrag die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der Europäischen Union, insbesondere im Kontext der russischen Invasion in die Ukraine. Er beleuchtet die strukturelle Entwicklung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD), die Herausforderungen durch das Vetorecht einzelner Mitgliedstaaten und die Notwendigkeit einer vertieften Integration. Rehbaum betont die Bedeutung von Mehrheitsentscheidungen und plädiert dafür, dem Europäischen Parlament eine größere Rolle einzuräumen. Er schlägt pragmatische kurzfristige Initiativen und mittelfristige Vertragsänderungen vor, um die Handlungsfähigkeit der EU zu verbessern. Die deutsche Regierung sollte sich führend an der Vorbereitung einer umfassenderen Reform der Außenpolitik beteiligen.
Markus Kaim stellt der Europäischen Union mit Blick auf die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der vergangenen Dekade ein gemischtes Zeugnis aus. Zwar gebe es eine große Anzahl an Missionen und Operationen; die GSVP verliere aber an Dynamik, die Ressourcen seien unzureichend, es mangele an politischer Unterstützung, und die notwendige Klärung des Verhältnisses zur Nato und zu den USA stehe weiterhin aus. Der Krieg in der Ukraine hat diese bekannten Schwächen der EU als internationaler Akteurin einmal mehr deutlich gemacht, jedoch auch zu einem Konsens geführt, der für ein wirksames sicherheitspolitisches Handeln unerlässlich ist. Die EU hat im Fall der Ukraine erstmalig direkt Rüstungsgüter für eine Konfliktpartei mobilisiert. Der Umfang und die Nachhaltigkeit dieser militärischen Hilfsleistungen bieten allerdings weiterhin Anlass zu Kritik. Vor diesem Hintergrund betont Kaim die Bedeutung der strategischen Autonomie und fordert, die EU-weite Zusammenarbeit der nationalen Verteidigungsindustrien auszubauen. Letztlich bleibt es für die GSVP entscheidend, ob die EU eine tatsächlich gemeinsame strategische Ausrichtung entwickeln kann.
Seit Russlands Invasion in die Ukraine im Februar 2022 wird die EU-Erweiterung als geostrategisches Mittel wieder vermehrt diskutiert. Marina Vulović beleuchtet verschiedene Vorschläge zur Reform der Erweiterungsstrategie, darunter eine schrittweise Mitgliedschaft und die Möglichkeit, Kandidatenstaaten vor einer vollen Mitgliedschaft erweiterten Zugang zum Binnenmarkt zu gewähren. Sie weist darauf hin, dass das transformative Potential der EU nicht mehr gegeben ist und dass Länder wie die Ukraine und Moldau wahrscheinlich ähnliche Probleme im Erweiterungsprozess haben werden wie die Westbalkanstaaten seit 2013. Die Autorin schlägt vor, klare Schritte für die Kandidatenländer auszuarbeiten, die den verbesserten Binnenmarktzugang bis 2030 greifbar machen, und mehr Ressourcen bereitzustellen, um deren sozioökonomische Annäherung zu beschleunigen. Vulović unterstreicht, dass Reformen im Erweiterungsprozess mit Reformen der EU selbst einhergehen müssen und dass die Integration in den Binnenmarkt nicht als Ersatz für eine volle Mitgliedschaft gesehen werden sollte, sondern als Schritt in einem Prozess, der klare Anreize bietet.
Aufbauend auf diesen Analysen werden die Entwicklungen abschließend in drei Querschnittsanalysen zusammengeführt. Nicolai von Ondarza hebt mit Blick auf die institutionellen Beziehungen hervor, dass die Union seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon massive Herausforderungen überstanden hat – ohne formelle Änderungen an den Verträgen. Diese doppelte Resilienz, also die Bewährung der EU trotz großer Krisen bei gleichzeitiger Starre des vertraglichen Integrationsstands, hat zu auseinanderstrebenden Dynamiken geführt. In der Krisengovernance dominieren die exekutiv-intergouvernementalen Institutionen, mit dem Europäischen Rat im Zentrum und einer zunehmend gestärkten Europäischen Kommission, während das Europäische Parlament fast vollständig außen vor bleibt. Dies gilt insbesondere für die in der Pandemie und im Zuge des russischen Angriffskrieges neu geschaffenen Instrumente der Union. Im Gegensatz dazu basieren die großen regulativen Vorhaben der EU, wie der Green Deal oder die digitale Agenda, auf der Gemeinschaftsmethode, mit voller Mitsprache des Europäischen Parlaments und unter verbreiteter Nutzung des effektiveren, aber im Vergleich zum formalen Gesetzgebungsverfahren intransparenteren Trilog-Verfahrens. Von Ondarza beleuchtet auch die Auswirkungen der zunehmenden Fragmentierung und (partei-)politischen Polarisierung innerhalb der Institutionen. Im Rat der EU und im Europäischen Rat hat der Wille zur Konsensfindung zugenommen, während in der EU-Kommission eine Hierarchisierung und Präsidentialisierung zu verzeichnen ist. Im Europäischen Parlament hingegen werden Verhandlungen durch die politische Fragmentierung komplizierter, was letztlich zu dessen Schwächung im interinstitutionellen Gefüge beiträgt, gerade bei den kurzfristigen Krisenentscheidungen. Von Ondarza weist abschließend darauf hin, dass die Frage der institutionellen Reform, einschließlich möglicher Vertragsänderungen, im Kontext potentieller Beitritte von Staaten wie der Ukraine oder der Republik Moldau wieder an Bedeutung gewinnen wird.
Kai-Olaf Lang erörtert in seinem Beitrag die immer vielschichtigere Rolle der Mitgliedstaaten in der EU-Governance, zwischen Ermöglichung von weitergehender Integration und Abwehr einer schleichenden Supranationalisierung. Bei sich vertiefender Integration bleiben die Mitgliedstaaten ein Faktor der Heterogenität, weswegen die politischen Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten je nach Inhalten variieren und keine konstanten Blöcke entstehen, etwa zwischen großen und kleinen oder nördlichen oder südlichen Mitgliedstaaten. Vielmehr haben die Krisen dazu geführt, dass mehrere Themenfelder politisch stark aufgeladen wurden, bei denen sich aufgrund dringender Handlungserfordernisse die Interessenkonstellationen, etwa von Nettoempfängern und Nettozahlern, neu sortierten. Ebenso schwankte je nach Krise die Präferenz der Mitgliedstaaten für europäische Solidarität und Ausbau der Kooperation. Es ergibt sich somit ein flexibler »Krisenfunktionalismus«, der von den Mitgliedstaaten sowie dem Europäischen Rat und der EU-Kommission getragen wird. Etwaige Veto- und Blockadepositionen einzelner Mitgliedstaaten konnten nicht durchgehalten werden oder jenseits des Brexits eine Rückabwicklung der Integration erzwingen. Eine konstitutionelle Vertiefung der EU, etwa durch Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen, stößt mittlerweile jedoch auf breitere Ablehnung als bei früheren Vertragsänderungen, als dies sukzessive geschah. In diesem komplizierten politischen Umfeld bleibt das deutsch-französische Verhältnis von besonderer Bedeutung, um sowohl impulsgebend als auch moderierend zu wirken.
Im Fazit resümieren Raphael Bossong und Nicolai von Ondarza, dass der Fortgang der Integration nicht allein an unmittelbaren Handlungszwängen festgemacht werden kann. Jenseits der Krisenbewältigung muss die EU strukturelle Herausforderungen angehen. Das politische System der EU sieht sich einer zunehmenden Fragmentierung gegenüber, selbst wenn bislang die Arbeitsfähigkeit gewahrt bleibt. Die in den vergangenen Jahren getroffenen Maßnahmen und Entscheidungen in vielen der untersuchten zentralen Politikfelder berühren die Kernstaatlichkeit der Mitgliedstaaten und stoßen dadurch an Grenzen; zumindest erfordern sie neue, krisenunabhängige Legitimationsgrundlagen. Vertragsrevisionen müssen also nicht nur mit Blick auf die EU-Erweiterung und die Ausweitung von Mehrheitsentscheiden, sondern auch hinsichtlich der demokratischen und rechtsstaatlichen Verfasstheit der Union in den kommenden Jahren in Angriff genommen und mit Nachdruck verfolgt werden.
Analysen der zentralen politischen Projekte
Wirtschaftspolitische Koordinierung: Von der politischen Koordinierung zu einer neuen EU-Politik
Es ist noch immer überraschend, dass die EU dreißig Jahre nach Schaffung des europäischen Binnenmarkts und zwanzig Jahre nach Einführung der gemeinsamen Währung nicht über die Kompetenz verfügt, eine eigene europäische Wirtschaftspolitik zu gestalten und umzusetzen. Im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) heißt es in den Artikeln 120 und 121 lediglich, dass die Mitgliedstaaten ihre nationalen Wirtschaftspolitiken als »eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse« betrachten und im Rat »im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb« koordinieren. Die Krisen in der Eurozone vor einem Jahrzehnt, die Corona-Pandemiekrise und nun die Energie- und Inflationskrise als Folge des Krieges in der Ukraine haben aber gezeigt, dass die EU durchaus über die Zuständigkeit für eine eigenständige und kraftvolle europäische Wirtschaftspolitik sowie über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen sollte. Die wirtschaftspolitischen Reaktionen der EU auf diese Krisen sowie die Transformationsherausforderungen des globalen Klimawandels haben bestätigt: Die EU ist zu einem Krisenmanagement zwar generell in der Lage, ihre Möglichkeiten sind jedoch begrenzt und es bedarf häufig immenser Anstrengungen mit zum Teil hohen politischen Kosten, damit sie im Krisenfall tatsächlich schnell und zielgerichtet handeln kann.
Die tiefere Ursache dieser Kompetenzlücke liegt in dem fundamentalen Widerspruch zwischen dem Festhalten der Mitgliedstaaten an ihren nationalen wirtschafts-, beschäftigungs- und sozialpolitischen Souveränitäten und der nicht zu übersehenden Notwendigkeit, in eben diesen Politiken gemeinschaftliche, europäische Handlungsmöglichkeiten zu schaffen. Hinzu kommt der Widerspruch zwischen den Erfordernissen einer einheitlichen, supranationalen Währung und der Weiterführung von nationalstaatlichen Wirtschaftspolitiken. Da die Mitglieder im europäischen Währungsraum keine eigene Geldpolitik mehr betreiben können und somit auf den Währungspuffer verzichten, ist eine gemeinsame Wirtschaftspolitik umso wichtiger.1 Es mangelt jedoch häufig an Konvergenz der mitgliedstaatlichen Volkswirtschaften und ihren entsprechenden Wirtschaftspolitiken. Die nationalen Wirtschafts- und Wachstumsmodelle sind vielfach disparat und reichen von einem auf nationale Wettbewerbsfähigkeit angelegten angebots- und exportorientierten deutschen Modell bis zu dem noch immer stark etatistischen und nachfrageorientierten französischen Ansatz. Die »varieties of capitalism«2 erschweren so eine kohärente europäische Wirtschaftspolitik sowie die weitere Harmonisierung von nationalen Dienstleistungsmärkten und Sozialsystemen als Ergebnis einer supranationalen Legislativtätigkeit.
Eine wirkliche und wirksame europäische Wirtschaftspolitik ist jedoch erforderlich, will man die Vorteile der mit dem Binnenmarkt geöffneten Märkte zur Gänze ausschöpfen, gemeinsam auf den globalisierten Märkten bestehen und die europäische Währungsunion dauerhaft und nachhaltig stabilisieren. Der Europäische Rat hat ebenso wie die Europäische Kommission die Notwendigkeit europäischer wirtschaftspolitischer Handlungsfähigkeit erkannt. Die Staats- und Regierungschefs bekräftigten in ihrer Erklärung von Rom zum sechzigsten Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge ihre Absicht, sich weiterhin für eine »wohlhabende, wettbewerbsfähige, nachhaltige und sozial verantwortungsvolle Union« einzusetzen, »die Wachstum generiert und Arbeitsplätze schafft« und »in der die Volkswirtschaften sich annähern«.3 Die Europäische Kommission unter ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen betonte in ihren politischen Leitlinien ebenfalls den Willen, die europäische soziale Marktwirtschaft voranzutreiben.4 Bereits die Vorgängerkommission unter Präsident Jean-Claude Juncker hatte sich die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Belebung der Investitionstätigkeit in Europa auf die Fahnen geschrieben, um so neue Arbeitsplätze zu schaffen.5
Wirtschaftspolitik ist immer Querschnittspolitik, die viele Politikbereiche oder spezifische wirtschaftspolitische Themen betrifft und beeinflusst. Umgekehrt wird auch sie stets von den Entwicklungen in anderen Politikfeldern geprägt. Eine strikte Abgrenzung zu anderen Politikfeldern, eine Eingrenzung ihrer Handlungsformen und ‑notwendigkeiten oder eine Spezifizierung von Instrumenten ist insofern schwer möglich. Darüber hinaus wird eine solche Abgrenzung, Konkretisierung und Spezifizierung stets auch vom jeweiligen wirtschaftspolitischen Leitbild bestimmt: Dominiert, wie insbesondere in Deutschland, eine wirtschaftsliberale und ordnungspolitische Sichtweise, gilt die Grundüberzeugung, dass der Staat sich bei seinen wirtschaftspolitischen Eingriffen auf die Festlegung von Rahmenbedingungen beschränken sollte. Steht ein etatistisches Verständnis im Vordergrund, wird dagegen ein staatliches Vorgehen propagiert, um das Marktgeschehen in Hinblick auf ein spezifisches Problem oder einen besonderen Sektor aktiv zu beeinflussen. Industriepolitische Maßnahmen zum Beispiel in Form regulativer Öffnung oder Abschottung von Märkten oder die Subventionierung einzelner Sektoren werden daher entweder skeptisch beurteilt oder gerade eingefordert. Dies bedeutet zugleich, dass die Indikatoren, mit denen die Bedeutung und der Europäisierungsgrad der Wirtschaftspolitik gemessen werden – also die Anzahl europäischer Rechtsakte oder die im EU-Budget eingestellten Gelder –, von dieser eher normativen Grundentscheidung abhängen. Wirtschaftspolitik ist jedoch stets und unvermeidlich mit Kosten und Lasten verbunden, politischen wie finanziellen, und folglich mit der Frage, wie diese Lasten oder umgekehrt auch die Vorteile wirtschaftspolitischer Maßnahmen verteilt werden.
Die Aufgaben einer europäischen Wirtschaftspolitik
In einer sozialen Marktwirtschaft, die das Ziel und das wirtschaftspolitische Leitbild6 auch der EU ist, bestehen die wichtigsten Aufgaben staatlicher Einflussnahme auf ökonomische Prozesse in der Stabilisierung zu Zeiten konjunktureller Schwankungen und im Ausgleich von Konjunkturzyklen, in der Verringerung gesellschaftlicher Wohlfahrtsunterschiede, im Einschreiten bei Formen des Marktversagens sowie in der sozialen und beschäftigungspolitischen Abfederung der Folgen wirtschaftspolitischer Maßnahmen. Die direkten oder mittelbaren Instrumente einer solchen marktorientierten Wirtschaftspolitik sind im Grundsatz finanzielle, steuerliche oder sonstige Anreize zur Aufnahme oder Aufgabe einer spezifischen wirtschaftlichen Tätigkeit, die Regulierung von Märkten durch staatliche Gesetzgebung und Vorgaben sowie die Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen für alle Marktteilnehmer. Die Europäische Union verfügt über einige dieser wirtschaftspolitischen Instrumente, jedoch nicht über alle, und sie kann keineswegs selbständig darüber entscheiden, welche Instrumente sie einsetzt, in welcher Form und welchem Umfang.
Im Zentrum der europäischen Wirtschaftspolitik steht zweifellos der europäische Binnenmarkt. Die EU ist mit ihrer Gesetzgebung in der Lage, Märkte zu öffnen oder neu zu schaffen, etwa die Telekommunikationsmärkte, oder sie auch zu schließen bzw. zu schützen wie im Falle des Agrarmarkts. Vor allem aber kann sie Märkte regulieren, also beispielsweise soziale oder umweltpolitische Mindest- oder Sicherheitsstandards vorgeben. Einen besonderen Stellenwert hat die europäische Wettbewerbspolitik. Mit ihren strikten gemeinschaftlichen Wettbewerbsregeln und dem grundsätzlichen Verbot staatlicher Subventionen garantiert die EU den freien und fairen Wettbewerb im Binnenmarkt. Hinzu kommen weitere Politiken und Instrumente wie die europäischen Struktur- und Kohäsionsfonds oder andere Förderprogramme sowie eine europäische Industriepolitik, um spezifische wirtschaftspolitische Probleme aufzugreifen oder gewünschte Entwicklungen anzustoßen und zu fördern.
Die Notwendigkeit einer europäischeren Wirtschaftspolitik ist nicht umstritten.
Die Notwendigkeit einer europäischeren Wirtschaftspolitik als solcher ist mithin in den Institutionen und Mitgliedstaaten der EU nicht umstritten. Kontrovers diskutiert werden jedoch deren Leitbilder, die Form und das Ausmaß, die Instrumente und teilweise auch die Ziele. Die nationalen Interessen divergieren, und die Mitgliedstaaten verfolgen widersprüchliche Ziele – je nach wirtschaftspolitischen Herausforderungen, dem Maß an Betroffenheit von externen ökonomischen Schocks oder Krisen und den daraus erwachsenden Dringlichkeiten wirtschaftspolitischer Maßnahmen sowie der Verteilung der Anpassungskosten. Um die zum Teil weit auseinanderliegenden nationalen Positionen einander anzunähern, schlägt die Europäische Kommission deshalb in der Regel zunächst gemeinsame wirtschaftspolitische Ziele, verbindliche Prioritäten und Leitlinien vor, die dann von den Mitgliedstaaten akzeptiert und umgesetzt werden sollen. Die Art der Implementierung sowie teilweise auch die Auswahl geeigneter wirtschaftspolitischer Maßnahmen verbleiben in der Regel in deren jeweiliger Zuständigkeit. Die EU, das heißt zumeist die Europäische Kommission, überwacht dann die Einhaltung und Umsetzung der gemeinsam vereinbarten Ziele und Vorgaben. Sie verfügt somit über die Möglichkeit einer begrenzten und mittelbaren wirtschaftspolitischen Steuerung.
Aufgabe einer europäischen Wirtschaftspolitik ist es demzufolge, unter schwierigen internationalen Rahmenbedingungen eine ausgewogene Balance zwischen den Einzelinteressen der Mitgliedstaaten und der Wirtschaftsakteure einerseits und dem europäischen Gesamtwohl sowie den gemeinsamen wirtschaftspolitischen wie gesellschaftlichen Zielen andererseits zu finden. Der EU mangelt es hierfür häufig an politischen Handlungsspielräumen zum wirksamen Einsatz ihrer Instrumente, auch das wirtschaftspolitische Instrumentarium der EU selbst ist begrenzt. Beispielsweise verfügt sie nicht über ausreichende Budgetmittel, über deren Verwendung sie autonom entscheiden kann, um effektive und nachhaltige finanzielle Anreize zu setzen. Sie kann auch keine Steuern erlassen, um die Preisbildung auf den europäischen Märkten zu beeinflussen; umfassende eigene beschäftigungs- und sozialpolitische Kompetenzen, um die Folgen ökonomischer Entscheidungen abfedern zu können, fehlen ihr. Das wirtschaftspolitische Instrumentarium der EU beschränkt sich derzeit also vornehmlich auf die politische Abstimmung und Koordinierung der mitgliedstaatlichen Wirtschaftspolitiken.
Wirtschaftspolitische Koordinierung in Krisenzeiten
Gerade in Krisenzeiten ist es das vordringliche Ziel der EU, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krisen zu lindern und die ökonomische Leistungsfähigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu sichern. Maßnahmen zur EU-Krisenbewältigung bestehen insofern stets darin, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, Beschäftigung zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit zu festigen. Gerade im europäischen Krisenjahrzehnt wurde die wachsende Notwendigkeit einer kohärenten europäischen Wirtschaftspolitik oder zumindest in der EU abgestimmter Reaktionen auf die diversen Krisen offensichtlich.
Die Krisen und ökonomischen Schocks und die Betroffenheit einzelner Mitgliedstaaten waren durchaus unterschiedlich und führten folglich auch zu divergierenden Belastungen. Während die Verschuldungskrise in der Eurozone und die Reaktionen der globalen Finanzmärkte vor mehr als einem Jahrzehnt zunächst nur einige Mitgliedstaaten in der Eurozone direkt und mit voller Wucht trafen, führte die Pandemiekrise zu Beginn des Jahrzehnts in allen Mitgliedstaaten der EU-27 zu Verwerfungen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß und zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Auch die wirtschaftspolitischen Konsequenzen der immens gestiegenen Inflationsraten, der steigenden Zinskosten sowie der latenten Klimakrise und die Notwendigkeit, die nationalen Wirtschaftsmodelle zu transformieren, betreffen alle Mitgliedstaaten. Während einige Krisen auf externe Entwicklungen zurückgeführt wurden, interpretierten zumindest manche Mitgliedstaaten andere Krisen als Folge interner (Fehl-)Entwicklungen in der EU, der Eurozone oder in einzelnen Mitgliedstaaten. Damit variierte auch die Zustimmung zu gemeinschaftlichen wirtschaftspolitischen Maßnahmen und Reformen sowie die Bereitschaft, während der Krisen politische und finanzielle Lasten zu übernehmen. Demzufolge waren die politischen Handlungsspielräume und ‑möglichkeiten für eine europäische Wirtschaftspolitik unterschiedlich groß.
Auf die Krise in der Eurozone vor rund einem Jahrzehnt reagierte die EU zunächst verhalten und mit den üblichen Instrumenten. Mit zwei Gesetzgebungspaketen, dem »six pack« und dem »two pack«, wurden die wirtschaftspolitische Koordinierung in der Eurozone ausgebaut, die Überwachung der nationalen Haushaltspolitiken verbessert und Maßnahmen zur Vermeidung makroökonomischer Ungleichgewichte eingeführt.7 Hinzu kam mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) ein neues Hilfsmittel zur Intervention im akuten Krisenfall, das heißt bei wirtschaftlichen Schocks in einem oder einigen Mitgliedstaaten der Eurozone. Damit hatte die EU bzw. die Eurozone im Verlauf der Krise wichtige neue Werkzeuge zur Stabilisierung der gemeinsamen Währung in einem erneuten Krisenfall geschaffen und die bestehenden Mechanismen für das Monitoring der nationalen Politiken geschärft.8
Das Europäische Semester entwickelte sich seit 2011 zum zentralen Instrument der europäischen Wirtschaftspolitik.
Die vielleicht wichtigste Neuerung neben dem ESM bestand in der Einrichtung des sogenannten Europäischen Semesters, eines neuen technisch-administrativen Steuerungsprozesses, der dazu dienen soll, die nationalen Wirtschaftspolitiken enger zu koordinieren und zu überwachen. Das Europäische Semester entwickelte sich nach seiner Einführung 2011 zum zentralen Instrument der europäischen Wirtschaftspolitik: ein jährlicher Handlungs- und Steuerungszyklus mit fest terminierten Abläufen aus Evaluierung, Empfehlungen und Implementierung, der alle wirtschafts-, beschäftigungs-, sozial- und inzwischen auch nachhaltigkeitspolitischen Ziele und Strategien der EU erfasst. Im Zentrum des Europäischen Semesters steht die Etablierung sogenannter länderspezifischer Empfehlungen (LSE); die Kommission erarbeitet für jeden Mitgliedstaat gesondert ein umfassendes Paket aus wirtschafts-, beschäftigungs-, fiskal- und klimapolitischen Reformvorschlägen. Diese Empfehlungen sollen möglichst detaillierte Orientierungshilfen enthalten und hinreichend präzise formuliert sein, um den Mitgliedstaaten Vorgaben zur Fortsetzung, Intensivierung oder Neuausrichtung ihrer nationalen Wirtschaftspolitiken und insbesondere für notwendige Strukturreformen zu liefern. Die Mitgliedstaaten nehmen diese Empfehlungen in ihre jährlichen nationalen Reformprogramme (NRP) auf und legen darin konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlungen fest. Die Reformempfehlungen sind keine rechtlichen Vorgaben im Sinne einer europäischen Verordnung oder einer Richtlinie, sondern bedürfen der rechtlichen Umsetzung auf nationaler Ebene. Die zunächst nur politische Verbindlichkeit der LSE-Implementierung wird jedoch zunehmend durch Kopplung an die Vergabe europäischer Fördergelder unterfüttert.9
Unter den Rahmenbedingungen der bestehenden europäischen Verträge ist das Europäische Semester bis dato das wichtigste Instrument für eine effektive wirtschaftspolitische Koordinierung der Mitgliedstaaten: durch Ausrichtung auf die gemeinsamen Ziele und Interessen, durch finanzielle Anreize aus europäischen Fonds und – gegebenenfalls – durch Sanktionen bei Nichtbeachtung der gemeinsam vereinbarten wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Die wirtschaftspolitische Reaktion auf die Verschuldungskrise in der Eurozone erschöpfte sich also gerade nicht in europäischer Rechtsetzung, sondern führte auch zur Verständigung auf gemeinsame europäische Ziele, die mit jeweils nationalen Politiken in den Mitgliedstaaten betont und umgesetzt werden sollen. Während in den europäischen Verträgen mit den Konvergenzkriterien eindeutige Indikatoren für die Fähigkeit zur Aufnahme in die Eurozone vorgegeben werden und mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt quantifizierbare Kriterien festgelegt wurden, die bei einem Verstoß Sanktionen bis hin zu Strafzahlungen nach sich ziehen, sieht die wirtschaftspolitische Koordinierung lediglich die freiwillige und von den Mitgliedstaaten weitgehend selbst zu bestimmende Annäherung an europäische Ziele vor. Die Methodik, gemeinsame Ziele zu vereinbaren, die mit messbaren Leistungsindikatoren unterlegt werden, wendet die Europäische Kommission inzwischen auch auf die gemeinsamen Anstrengungen zur Weiterentwicklung des europäischen Binnenmarktes und zur Stärkung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen und Volkswirtschaften an. Zur Messung von Wettbewerbsfähigkeit hat sie für acht Sektoren konkrete Indikatoren entwickelt, die sie jährlich erhebt und bewertet.10
In der Corona-Pandemiekrise entwickelte die EU mit NextGenerationEU (NGEU) und der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) sowie dem SURE-Programm zur befristeten Unterstützung mitgliedstaatlicher Arbeitsmarktprogramme ganz neue Instrumente der Krisenbewältigung, mit denen sie weit über die vertragsrechtlich vorgegebene Selbstbeschränkung hinausging. War die Pandemie bis Ende Februar 2020 noch eine primär gesundheitspolitische globale Krise, rückten schnell die sozioökonomischen Folgen in den Vordergrund. Durch die nationalen Grenzschließungen kam es zu Einschränkungen im Austausch von Menschen, Gütern und Dienstleistungen, was die Integrität des europäischen Binnenmarktes infrage stellte. Zugleich vertieften die unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten der Mitgliedstaaten, auf die Pandemie mit nationalen Hilfsprogrammen zu reagieren, die Wettbewerbsunterschiede im Binnenmarkt. Die Gefahr wuchs, dass die europäischen Volkswirtschaften weiter auseinanderdriften und auch die gemeinsame Währung an Wert und Stabilität verlieren würden. Frühzeitig standen Prognosen eines starken Wachstumsrückgangs und damit einhergehend drastisch steigender Arbeitslosenzahlen im Raum. Der Europäische Rat vereinbarte schließlich nach schwierigen und sehr langen Verhandlungen am 21. Juli 2020 einen Kompromiss auf einen neuen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) für die Jahre 2021 bis 2027 und ein zusätzliches, befristetes europäisches Wiederaufbaubudget unter der Überschrift »NextGenerationEU« – ein umfassendes Corona-Haushaltspaket mit dem immensen Umfang von insgesamt rund 1,8 Billionen Euro. Im Zentrum der Einigung standen die neue Fazilität ARF und die Entscheidung der EU, erstmals zu deren Finanzierung gemeinsame Kredite aufzunehmen. NGEU sollte als »außergewöhnliche Reaktion« der EU auf die Pandemie »massive öffentliche und private Investitionen auf europäischer Ebene« anstoßen, »um die Union auf den Weg zu nachhaltiger und robuster Erholung zu bringen, Arbeitsplätze zu schaffen, die durch die Corona-Pandemie verursachten unmittelbaren Schäden zu beheben und gleichzeitig die Prioritäten der Union im Hinblick auf die grüne und digitale Wende voranzubringen«.11
Diese überraschende Einigung wurde einhellig als historischer Moment bewertet; es war sogar vom »Hamilton-Moment der Europäischen Union« die Rede.12 Die rechtliche Umsetzung des politischen Kompromisses der Staats- und Regierungschefs erfolgte dann nach den üblichen Verfahren in Form der erforderlichen Verordnungen für den MFR, die Ausgabenpolitiken und ‑programme der EU sowie des neuen Eigenmittelbeschlusses zur Finanzierung des EU-Budgets. Der schwere sozioökonomische Schock der Corona-Pandemie hatte gezeigt, wie notwendig eine abgestimmte europäische Reaktion war – und die EU war anders als während der Krise in der Eurozone ein Jahrzehnt zuvor zu einer solch entschlossenen Antwort auch in der Lage. Allerdings soll dieses »neue und heikle rechtliche«13 Instrument in Zukunft nur als letzte Option für außergewöhnliche Maßnahmen bzw. Krisenreaktionen von der europäischen Politik genutzt werden können. Das Bundesverfassungsgericht legte in seinem Urteil über die Kreditaufnahme der EU die Grenzen dieser Option fest: Die EU dürfe nur ausnahmsweise Kredite als sonstige Einnahmen aufnehmen, und zwar unter den Bedingungen der Zweckbindung, der zeitlichen Befristung und nur in einer Höhe, die den Umfang der sonstigen Eigenmittel nicht übersteigen darf.14
Mit dem Green Deal15 reagierte die EU auf die andauernde Klimakrise und den daraus abgeleiteten fundamentalen Transformationsprozess der europäischen Volkswirtschaften. Die EU strebt den Übergang zu einem gerechten, klimaneutralen und digitalen Europa im nächsten Jahrzehnt an; die Nachhaltigkeit rückt ins Zentrum der europäischen wirtschaftspolitischen Koordinierung. Das Wirtschaftswachstum soll vom Ressourcenverbrauch abgekoppelt, der Übergang zu klimaneutralen Produktionsverfahren unterstützt und wettbewerbsfähige Nachhaltigkeit zum Herzstück der sozialen Marktwirtschaft Europas werden. Das vorrangige Ziel der europäischen Wirtschaftspolitik besteht nun also in einer grundsätzlichen, langfristigen und nachhaltigen Transformation der europäischen Wirtschaft. Unter diesen klimapolitischen Prämissen erfolgte eine Neuausrichtung der bestehenden wirtschaftspolitischen Koordinierungs- und Monitoring-Instrumente. Die länderspezifischen Empfehlungen zu Strukturreformen und Investitionen im Rahmen des Europäischen Semesters wurden insbesondere an die Leitlinien des nachhaltigen und grünen Wachstums angepasst. Die Förderprioritäten der europäischen Strukturfonds und der Aufbau- und Resilienzfazilität und somit ein Großteil der europäischen Fördergelder wurden auf die klimapolitischen Ziele umgelenkt. Mindestens 37 Prozent der insgesamt 723 Milliarden Euro an ARF-Mitteln (in Preisen des Jahres 2022) sollen bis Ende 2026 für Klimaschutzmaßnahmen verwendet und mindestens 30 Prozent der insgesamt rund 380 Milliarden Euro aus dem EU-Budget für die europäischen Strukturfonds für die Klimaschutzpolitik in den Regionen verausgabt werden.16
Die Neuausrichtung der europäischen Förderpolitiken und ‑instrumente zielt auf die doppelte Transformation der europäischen Wirtschaft: klimapolitisch und digital. Zusätzliche industriepolitische Maßnahmen der EU sollen in diesem Jahrzehnt dafür sorgen, dass der Industriesektor ebenfalls umweltfreundlicher, nachhaltiger und digitaler gestaltet wird, unter Wahrung der globalen Wettbewerbsfähigkeit und Beachtung sozialpolitischer Prinzipien. So will die EU eine Netto-Null-Industrie-Verordnung verabschieden, mit der sie die Entwicklung von spezifischen Technologien zur Dekarbonisierung der europäischen Volkswirtschaften fördert, beispielsweise Windkraft, Fotovoltaik, Wärmepumpen oder Batteriezellen.17 Durch industrielle Innovationen sowie den Ausbau von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen werden, so das Bestreben, die industrielle und strategische Autonomie Europas vorangetrieben und die Entwicklung von Schlüsseltechnologien unterstützt. Im Rahmen dieser IPCEI (Important Projects of Common European Interest), etwa in der Robotik und der Mikroelektronik oder der Biomedizin und bei Nanotechnologien, werden europäische Wertschöpfungsketten und »industrielle Ökosysteme« aufgebaut. Es geht bei den industriepolitischen Maßnahmen der EU also um die Unterstützung der Dekarbonisierung und der Digitalisierung der europäischen Industrieunternehmen sowie einer CO2-sparenden Kreislaufwirtschaft mit nationalen und europäischen Fördermitteln, für die zudem beihilferechtliche Förderspielräume geöffnet wurden. Für diese Schlüsseltechnologien hat die Kommission auch ihre strengen Beihilfeprüfungen angepasst.18
Die Anstrengungen und Maßnahmen der USA, mit einem wuchtigen Förderprogramm – dem Inflation Reduction Act – auf die Klimakrise zu reagieren und die Transformation der amerikanischen Volkswirtschaft zur Klimaneutralität zu beschleunigen, haben in der EU weitere Debatten über die Notwendigkeit einer europäischen Reaktion ausgelöst. Die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen und der Binnenmarktkommissar Thierry Breton plädierten zunächst für zusätzliche europäische Förderinstrumente, einen Souveränitätsfonds, mit dem weitere Fördergelder an Unternehmen für Investitionen in klimaneutrale Produktion und Innovationen ausgereicht werden sollten. In ihrer Halbzeitbewertung des MFR griff die Kommission diese Idee jedoch nicht mehr auf. Die nun vorgeschlagene »Strategic Technologies for Europe Platform« (STEP),19 Plattform für strategische Technologien für Europa, soll neue Technologien für den ökologischen und den digitalen Wandel in der EU fördern. Die Kommission begründete ihr Vorgehen damit, dass auch auf diese Weise die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und ökonomische Widerstandsfähigkeit der EU konsolidiert werden könnten. Statt einer neuen Fazilität oder eines Fonds mit einer umfangreichen zusätzlichen Finanzierung will sie die bestehenden und verfügbaren Fonds im Rahmen des EU-Haushalts für die Ziele der Plattform nutzen. Wie bei ihren früheren industriepolitischen Initiativen und durchaus in Einklang mit den beschränkten Möglichkeiten der europäischen Verträge (Artikel 173 AEUV) beschränkte sich die Kommission auf die Verbesserung der ökonomischen Rahmenbedingungen für europäische Industrieunternehmen und auf punktuelle Förderimpulse.
Die Erfordernisse einer europäischen Wirtschaftspolitik
Ob während der Verschuldungskrise in der Eurozone vor einem Jahrzehnt, ob als Antwort auf die sozioökonomischen Folgen der Corona-Pandemiekrise, ob für den europäischen Green Deal oder während des globalen Förderwettbewerbs bei der Transformation der Volkswirtschaften auf dem Weg zur Klimaneutralität – in allen Fällen griff und greift die EU zunächst auf die vorhandenen Instrumente der europäischen Wirtschaftspolitik zurück: die Regulierung im europäischen Binnenmarkt, das Wettbewerbs- und Beihilfenrecht sowie die Verwendung europäischer Fördergelder als finanzielle Impulse und Anreize. Erst wenn dieses bestehende und bekannte Instrumentarium nicht ausreichend erscheint, um das angestrebte Ziel zu erreichen oder einen ökonomischen Schock bzw. eine Krise zu bekämpfen, werden zusätzliche und neue Hilfsmittel in Betracht gezogen. As wirklich neu erwiesen sich jedoch lediglich der ESM in der Eurozonenkrise und NGEU bzw. ARF während der Pandemiekrise. Das Europäische Semester, das 2011 in Reaktion auf die Krise in der Eurozone geschaffen wurde, bleibt dagegen als Koordinierungs- und Monitoring-Instrument den begrenzten europarechtlichen Möglichkeiten zur wirtschaftspolitischen Koordinierung verhaftet.
Das Europäische Semester bildet inzwischen den eingespielten institutionellen Rahmen zur administrativen Koordinierung und Abstimmung zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen Regierungen in den Mitgliedstaaten über alle wirtschafts-, beschäftigungs-, sozial- und nachhaltigkeitspolitischen Fragen. Die Exekutiven verständigen sich auf gemeinsame europäische Ziele und vereinbaren nationale Implementierungsmaßnahmen. Diese Form der engen Absprachen und des kontinuierlichen Austauschs zwischen den Exekutiven auf der europäischen und der mitgliedstaatlichen Ebene eröffnet einerseits den politischen Akteuren auf beiden Entscheidungsebenen größere wirtschaftspolitische Spielräume und stärkt deren Autonomie. Die exekutiven wirtschaftspolitischen Entscheidungsprozesse werden unabhängiger von der jeweiligen parlamentarischen Mitwirkung und Kontrolle. Andererseits wächst die Notwendigkeit zu gegenseitiger Kooperation und Abstimmung, denn beide exekutiven Entscheidungsebenen können nur in gegenseitiger Abhängigkeit und enger Koordinierung ihre wirtschaftspolitischen Ziele umsetzen.
Die Wirtschaftspolitik der EU ist von ihrer Exekutivlastigkeit geprägt – insbesondere in Krisen.
Diese besondere Form der wirtschaftspolitischen Exekutivlastigkeit im politischen System der Europäischen Union fällt in Zeiten ökonomischer Krisen oder Herausforderungen anders aus als in Zeiten politischer Routine: Während in Krisenzeiten die nationalen Regierungen in den Mitgliedstaaten die wirtschaftspolitische Reaktion der EU auf die jeweilige Krise dominieren und entweder zur Schaffung neuer Institutionen bereit sind oder nicht, ist es in Zeiten wirtschaftspolitischer Routine die Kommission, die mithilfe ihres Initiativmonopols zu europäischer Gesetzgebung und des Europäischen Semesters die europäische Wirtschaftspolitik bestimmt. Die parlamentarische Einbindung in diese komplexen Abstimmungsprozesse der soft governance europäischer Wirtschaftspolitik ist hingegen schwach. In Krisenzeiten wird die Politik ohnehin zumeist von den Exekutiven bestimmt; in der Routine der europäischen Wirtschaftspolitik sind die Möglichkeiten parlamentarischer Begleitung und Kontrolle gering. Die Erweiterung des Europäischen Semesters um eine parlamentarische Dimension erscheint dringend geboten.
Das Europäische Semester wird durch europäische Rechtsetzung ersetzt werden müssen.
Ob es künftig gelingen wird, die EU auf eine nachhaltige und klimaschützende Form des Wirtschaftens unter den Bedingungen der Digitalisierung zu transformieren, hängt davon ab, ob die strukturellen und systemischen Begrenzungen und Hemmnisse für eine aktive, kohärente und effiziente europäische Wirtschaftspolitik abgebaut werden können. Gesucht wird also eine Lösung, um die eklatantesten Schwächen im Instrumentarium der bestehenden wirtschaftspolitischen Koordinierung zu beheben. Vor dem Hintergrund der globalen wirtschaftspolitischen Herausforderungen20 und der ökonomischen Zwänge der europäischen Währungsunion wird das Europäische Semester, also die weiche Koordinierung der nationalen Wirtschaftspolitiken, durch ein verbindlicheres Werkzeug ersetzt werden müssen, also durch europäische Rechtsetzung. Die Vereinbarung europäischer Ziele bei gleichzeitiger Offenheit für unterschiedliche mitgliedstaatliche Implementierungswege bedarf zunehmend der Ergänzung durch Festlegung gemeinschaftlicher Maßnahmen. Die Europäische Kommission scheint mit ihren Vorschlägen zur Regulierung neuer Märkte21 und zur Konkretisierung einer europäischen Industriepolitik diesen Weg der integrationspolitischen Vertiefung bereits beschritten zu haben. Die Mitgliedstaaten sind gefordert, sich bei ihren Wirtschaftspolitiken (und den benachbarten Politikbereichen wie der Beschäftigungs- und der Sozial-, der Industrie- sowie der Energie- und Klimapolitik) verstärkt auf europäische Maßnahmen zu verständigen, also mehr nationalstaatliche Souveränität an die EU abzugeben. Um nationale Beharrungskräfte zu überwinden und eine effiziente, stabile sowie nachhaltige europäische Wirtschaftspolitik zu schaffen, wird es unabdingbar sein, Zuständigkeiten weiter zu zentralisieren und politische Entscheidungen im europäischen Rahmen zu treffen. Zu diesem Zweck sollte die EU mit zusätzlichen wirtschaftspolitischen Instrumenten ausgestattet werden, zum Beispiel einer erweiterten Zuständigkeit für steuerpolitische Fragen, damit die Gemeinschaft über den Preismechanismus wirksame wirtschaftspolitische Anreize setzen kann. Ziel muss es sein, die europäische Wirtschaftspolitik an einem gemeinsamen europäischen Mehrwert zu orientieren und so in einem höheren Maße als bislang gemeinschaftliche öffentliche Güter bereitzustellen.
Die Schaffung der Währungsunion in Europa als Ergänzung zur Integration des Binnenmarktes hat den Mitgliedstaaten viele Vorteile gebracht. Dazu gehören insbesondere der Wegfall des Wechselkursrisikos, eine verbilligte Kapitalbeschaffung und für viele Länder Kostensenkungen beim Schuldendienst. Der Euro hat auch dazu beigetragen, Folgen externer Schocks auf die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten zu begrenzen, was sich insbesondere während der Corona-Pandemiekrise gezeigt hat. Zudem hat sich die Gemeinschaftswährung in der Weltwirtschaft behauptet.1 Der Euro rangiert im globalen Finanzsystem nach dem US-Dollar an zweiter Stelle.
Trotz dieser Vorteile befindet sich der Euroraum seit 2010 in verschiedenen Phasen einer Dauerkrise, die zwischen 2009 und 2015 mehrfach eskalierte und schließlich zum Zerfall der Währungsunion zu führen drohte. Die Staatsschuldenkrise hat deutlich gezeigt, dass die Gemeinschaftswährung ein zusammenhängendes System ist. Steigt das Risiko einer Destabilisierung der Staatsfinanzen in einem Land, kann diese Entwicklung schnell auf andere Länder übergreifen und den gesamten Währungsraum erfassen. Die Mitgliedstaaten und Institutionen der Eurozone sahen sich daher gezwungen, die länderspezifischen Risiken zu verringern und diese innerhalb der Währungsunion zu verteilen.
Hier soll die Frage beantwortet werden, was die Verteilung des Länderrisikos (sovereign risk) über den Prozess der monetären Integration aussagen kann, der neben dem Binnenmarkt eine Schlüsseldimension der europäischen Wirtschaftsintegration darstellt. Wie in den anderen Politikbereichen, die in dieser Studie behandelt werden, ist der Prozess der Risikoteilung im Euroraum durch eine Reihe von Herausforderungen gekennzeichnet: Sie betreffen die Handlungsfähigkeit, die Reformbereitschaft der Mitgliedstaaten und Ansatzpunkte für Reformen in der Architektur des Euroraums, die demokratische Legitimität oder die Kohärenz des Integrationsprozesses.
Zentrale Governanceproblematik: Stabilisierung der Währungsunion
Die Frage nach den Stabilisierungsbemühungen im Euroraum während der Eurokrise knüpft unmittelbar an klassische ökonomische Theorien zu den Funktionen zentraler Wirtschaftspolitik an. Neben der Allokations- und Umverteilungsfunktion wird die Stabilisierungsfunktion als Hauptaufgabe der zentralen Governance-Ebene genannt.2 Doch trotz der theoretischen Grundlagen wurde die Frage nach der Notwendigkeit einer Stabilisierungspolitik in den EU-Verträgen nicht behandelt. Interessanterweise gab es im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) die Möglichkeit einer EU-Finanzhilfe nach Artikel 143 (ehemals Artikel 119 EGV), aber nur für Länder, die nicht zur Eurozone gehörten. Außerdem besagt Artikel 125 AEUV ausdrücklich, dass weder die Mitgliedstaaten noch die EU als Ganze für die Schulden anderer Mitgliedstaaten haften. Das Fehlen eines Finanzhilfemechanismus im Euroraum, der den Druck der Finanzmärkte auf einige Mitgliedstaaten hätte mildern können, hat sich als eine große Lücke im System der wirtschaftspolitischen Steuerung der Eurozone erwiesen. So wurden Versuche unternommen, dieses Problem durch die Schaffung vorübergehender und dauerhafter Finanzhilfemechanismen zu beheben, um das Vertrauen der Finanzmärkte in die Haushaltslage der Mitgliedstaaten wiederherzustellen. Die entscheidende Rolle bei der Stabilisierung des Marktes für Staatsanleihen im Euroraum spielten jedoch nicht die schrittweise etablierten Stützungsmechanismen, sondern die Geldpolitik des Eurosystems, bestehend aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den Zentralbanken des Euroraums.
Ein wesentliches Merkmal der Stabilisierungspolitik ist, dass sie eine Risikoteilung voraussetzt.
Ein wesentliches Merkmal der Stabilisierungspolitik ist, dass sie eine Risikoteilung voraussetzt. Der Zeitraum 2009 bis 2023 lässt sich in drei Risikoteilungsregime unterteilen. Bis Mai 2010, das heißt bis zur Verabschiedung des ersten Hilfspakets für Griechenland und der Ankündigung des EZB-Programms für den Wertpapiermarkt (Securities Markets Programme, SMP),3 gab es ein No-bailout-Regime. Vom ersten Hilfspaket bis zur »Whatever-it-takes«-Rede, die der damalige EZB-Chef Mario Draghi im Juli 2012 in London hielt, wurde mit »bedingtem Bailout« operiert. Seit Draghis Londoner Rede und der Ankündigung des OMT-Programms (Outright Monetary Transactions)4 herrscht ein »Whatever-it-takes«-Regime vor. Dies gipfelte in den Programmen PSPP (Public Sector Purchase Programme)5 und PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme)6. Seit 2022 können Versuche der EZB beobachtet werden, von Interventionen auf den Schuldenmärkten Abstand zu nehmen, begleitet von einem Reformprozess und einer Diskussion über die zukünftige Rolle des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM). Die Ankündigung eines neuen Programms zum Ankauf von Vermögenswerten im Juli 2022 (Transmission Protection Instrument, TPI)7 lässt sich als Ausdruck dieser Neuorientierung werten.
Im Hinblick auf die Governanceproblematik ist es schwierig, bei den Stabilisierungsbemühungen der Eurozone von einem einheitlichen Regime zu sprechen. Sie kamen in einer Vielzahl von Formaten zustande, wobei die Eurogruppe, der Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN), der Europäische Rat sowie informelle Treffen von Politikerinnen und Politikern und/ oder Finanzministerinnen und Finanzministern der größten Mitgliedstaaten mit Vertretern europäischer und internationaler Institutionen die größte Rolle spielten.8 Auch innerhalb des Euroraums gab es zahlreiche Konfliktlinien, insbesondere zwischen den südlichen und den nördlichen Ländern. Die Länder im Süden der Eurozone befürworten ein Fortschreiten der fiskalischen Integration und damit eine weitergehende Risikoteilung.9
Im Kern der Frage der Risikoteilung stand und steht die Europäische Zentralbank, die direkten Druck auf die einzelnen Mitgliedstaaten und das Euro-Währungsgebiet insgesamt ausübte, um spezifische Stabilisierungsmaßnahmen durchzusetzen.10 Eine wichtige Rolle spielte auch die Europäische Kommission, die spezifische Lösungsvorschläge in diesem Bereich ausarbeitete, und eine informelle Gruppe, die sogenannte Troika, deren Aufgabe darin bestand, Strukturreformen im Austausch gegen finanzielle Unterstützung zu konzipieren, umzusetzen und zu bewerten – wobei das Risiko von den Mitgliedstaaten und der EZB getragen wurde.11 Geldpolitische Maßnahmen wie Anleiheankäufe auf dem Sekundärmarkt wurden zur Stabilisierung des Schuldenmarktes eingesetzt. Sie wurden ergriffen, obwohl es zuvor ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit des EZB-Engagements auf dem Schuldenmarkt mit Artikel 123 AEUV gab, die vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) und vom Bundesverfassungsgericht geklärt werden musste.12
|
Tabelle 1 Die Finanzhilfemechanismen für die Länder des Euroraums |
|||||
|
Beihilfemechanismus |
Zeitraum |
Risikoteilungsmethode |
Rechtsgrundlage |
Kreditkapazität |
|
|
Griechische Kreditfazilität |
2010–2011; |
Bilaterale Darlehen von Ländern der Eurozone, die von der Europäischen Kommission gesammelt und verwaltet wurden |
Memorandum of Understanding |
bis 80 Milliarden Euro |
|
|
Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) |
2010–2015 |
auf Basis des EU-Haushalts, der als Sicherheit (Collateral) verwendet wurde |
EU-Recht: |
bis 60 Milliarden Euro |
|
|
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) |
2010–2013 |
Garantien von EZ-Mitgliedstaaten über eine in Luxemburg eingetragene Zweckgesellschaft (SPV; Special Purpose Vehicle) |
Rahmenvereinbarung vom 7.6.2010 zwischen den Ländern des Euroraums |
bis 440 Milliarden Euro |
|
|
Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM) |
2014– |
von den EZ-Mitgliedstaaten eingezahltes Kapital, Garantien der Mitgliedstaaten |
Geänderter Artikel 136 AEUV; Vertrag zum Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), unterzeichnet am 11. Juli 2011 und in Kraft getreten am 27. Oktober 2012; |
bis 500 Milliarden Euro |
|
|
Quelle: eigene Darstellung basierend auf <http://www.esm.europa.eu/>. |
|||||
Was die Risikoteilung angeht, so konzentriert sich die folgende Analyse auf die wichtigsten Aspekte. An erster Stelle steht die finanzielle Unterstützung von Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets. Diese Art der Risikoteilung kann als entscheidend für die erste Phase der Euro-Krise angesehen werden. Zweitens werden die Bemühungen untersucht, die Renditen der von den Mitgliedstaaten ausgegebenen Staatsanleihen durch Interventionen des Eurosystems auf dem Sekundärmarkt zu kontrollieren. Im nächsten Abschnitt werden diese beiden Arten der Stabilisierung in einen breiteren Kontext gestellt, da im Euroraum auch andere Formen der Risikoteilung zu finden sind. Innerhalb der Bankenunion werden sowohl öffentliche als auch private Kanäle dafür genutzt. Eine wichtige Maßnahme der Risikoteilung war der Aufbau und das Aufrechterhalten von Ungleichgewichten im Rahmen des gegenseitigen Abrechnungssystems Target 2. Als öffentliches Element der Risikoteilung kann das Vorhandensein gemeinsamer Institutionen, Vorschriften und einer Einlagensicherung angesehen werden, während das private Element beispielsweise in den Eigenkapitalanforderungen der Banken und ihren finanziellen Beiträgen zu Abwicklungsfonds besteht.13
Finanzhilfeinstrumente: Improvisation, Verankerung und Marginalisierung
Das Tempo bei der Findung und der Vereinbarung von Lösungen für die Hilfsinstrumente des Euroraums und die Art und Weise, wie dies geschah, wurden durch eine Reihe von wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Faktoren bestimmt. Das plötzliche Auftreten der Eurokrise und ihre Dynamik erforderten ein rasches Eingreifen. Zunächst wurden befristete Hilfsinstrumente auf der Grundlage der verschiedenen, in Tabelle 1 dargestellten Hilfsmodalitäten geschaffen, darunter bilaterale Instrumente (Griechische Kreditfazilität, GLF), Gemeinschaftsinstrumente (Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus, EFSM) oder solche, die außerhalb des EU-Rechtssystems ins Leben gerufen wurden: die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und der ständige Finanzhilfemechanismus in der Eurozone ESM. Die Instrumente variierten in ihrer Konzeption und ihren finanziellen Möglichkeiten stark. Im Prinzip können nur die EFSF und der ESM als etablierte Hilfsinstrumente des Euroraums gelten, da der EFSM auf dem EU-Haushalt basierte und die GLF ein System bilateraler Darlehen war. Einzig der ESM verfügt über eigenes Kapital. Die EFSF wiederum stützt sich ausschließlich auf Garantien der Mitgliedstaaten.
Der Mechanismus für die Risikoteilung bei den oben genannten Hilfsinstrumenten war ähnlich. Auf der Grundlage von Garantien der Mitgliedstaaten (EFSF) oder Garantien und Kapital (ESM) wurden Schuldtitel auf den Finanzmärkten ausgegeben (Grafik 1). Die aufgenommenen Mittel steckte man in die Finanzhilfe. Die Berechnung des Beitrags zu den EFSF/ESM oder den Anteilen der Mitgliedstaaten erfolgte anhand der sogenannten EZB-Kapitalschlüssel. Dabei wird der Kapitalbeitrag der einzelnen Mitgliedstaaten hauptsächlich nach der Größe ihrer Volkswirtschaften und Bevölkerungen kalkuliert.14 Wie in Grafik 1 zu sehen ist, blieb das Niveau der Anleiheemissionen und der Risikoteilung durch die EFSF/ ESM gemessen am Umfang der Interventionen des Eurosystems (Grafik 2) überschaubar. Nach den Daten des ESM vom Oktober 2023 waren 417,4 Milliarden Euro der Kreditkapazität von 500 Milliarden Euro verfügbar.15
Auch aus rechtlicher Sicht war die Einrichtung des dauerhaften Finanzhilfemechanismus – des ESM – von großer Bedeutung und ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung des EU-Rechtssystems. Die am 25. März 2011 in Artikel 136 AEUV vorgenommene Änderung,16 die am 1. Mai 2013 in Kraft trat, war die erste und bisher einzige Modifizierung der EU-Verträge seit dem Vertrag von Lissabon. Das liegt daran, dass für diesen Schritt eine entsprechende Rechtsgrundlage in den Verträgen hergestellt werden musste. In rechtlicher und politischer Hinsicht ist der ESM ein zwischenstaatliches Instrument der Euroraum-Länder, nicht Teil des EU-Rechtssystems. Daher hat das Europäische Parlament keine Kontrolle darüber. Zwar gab es in der Vergangenheit Vorschläge, den ESM in das EU-Rechtssystem zu überführen (und ihn in Europäischen Währungsfonds umzubenennen),17 doch diese Idee ist zwischen den Mitgliedstaaten umstritten. Insbesondere einige der kleineren Euroraum-Staaten befürchten übermäßige finanzielle Verpflichtungen, sollte die Rolle des ESM ausgeweitet werden. Sie plädieren stattdessen dafür, den Mechanismus stärker als bisher als zwischenstaatliches Instrument zur Überwachung der mitgliedstaatlichen Haushaltspolitik zu nutzen.18 2019 einigten sich die Mitglieder der Eurogruppe auf eine Reform des ESM, welche die Hürden für eine erste Finanzhilfe senkt und es ermöglicht, den ESM als Letztsicherung (Kreditlinie für den Bedarfsfall) für den einheitlichen Abwicklungsfonds einzusetzen.
Kein Land der Eurozone nutzte das Sonderkredit-Programm des ESM während der Corona-Pandemie.
Im Zuge der Reform wurde unter anderem die Beteiligung des Privatsektors an einer möglichen Umschuldung diskutiert.19 Besondere Bestimmungen in Anleihen, die von Ländern des Euroraums ab 2022 ausgegeben wurden, erleichtern eine solche Umstrukturierung (sogenannte Single Limb Collective Action Clauses). Obwohl der überarbeitete ESM-Vertrag die Umstrukturierung von Schulden nicht als Bedingung für eine Finanzhilfe vorsieht, wurden insbesondere in Italien Bedenken geäußert, dass eine solche Forderung gestellt werden könnte, was Verluste für private inländische Investoren bedeuten würde.20 Diese befürchteten Rückwirkungen der Finanzhilfe auf die nationale Politik führten dazu, dass kein Land der Eurozone das Sonderkredit-Programm des ESM während der Corona-Pandemie im Anspruch nahm. Angesichts der begrenzten Kreditkapazität des ESM und der Sorgen wegen der Konditionalität dieser Hilfe wird dieses Instrument im Falle eines Wiederaufflammens der Staatsschuldenkrise im Euroraum nicht die Hauptrolle spielen.
Interventionen des Eurosystems
Die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Schaffung vorübergehender und ständiger Beistandsmechanismen waren insofern wichtig, als sie ein politisches Bekenntnis zum Erhalt der Währungsunion darstellten. Entscheidend für die Stabilisierung des Euroraums war jedoch das Handeln der EZB und die Schritte des Eurosystems.21 Die Europäische Zentralbank war die einzige Akteurin, die in dieser Krise rechtzeitig Unterstützungsmaßnahmen einleiten konnte, ihre Mittel waren unbegrenzt und die ergriffenen Maßnahmen aus politischer Sicht mit geringen Kosten verbunden. Mit seiner Erklärung, dass die Europäische Zentralbank »alles Notwendige« tun werde, stellte der damalige EZB-Präsident Mario Draghi im Juli 2012 das Vertrauen der Finanzmärkte in den Euroraum wieder her, ohne dass die angekündigte OMT-Fazilität aktiviert werden musste.
Die Interventionsprogramme der EZB unterschieden sich in Bezug auf die Risikoteilung.
Im Jahr 2010 hatte die EZB begonnen, im Rahmen des Programms für die Wertpapiermärkte (SMP) Staatsanleihen der Eurozonen-Länder Italien, Spanien, Irland, Griechenland und Portugal auf dem Sekundärmarkt anzukaufen.22 Im Jahr 2014 führte das Eurosystem die europäische Version der quantitativen Lockerung (Quantitative Easing, QE) ein, deren Hauptelement der Ankauf von Anleihen der Mitgliedstaaten war (PSPP, siehe Grafik 2).23 Das Pandemic Emergency Purchase Programme wiederum, das während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 aufgelegt wurde, ermöglichte es den Mitgliedstaaten, zur Stabilisierung ihrer Volkswirtschaften verstärkt auf fiskalpolitische Maßnahmen zurückzugreifen.24 Der Umfang dieser Programme (Grafik 2) überschritt den der EFSF/ESM-Hilfspakete bei weitem. Infolgedessen wuchs die Bilanzsumme des Eurosystems auf ein beträchtliches Niveau an. Trotz allmählicher Reduzierung lag sie Ende 2023 bei rund 6,9 Billionen Euro, was etwa 50 Prozent des kumulierten Bruttoinlandsprodukts des Euroraums entspricht.25 Die Interventionsprogramme der EZB unterschieden sich in Bezug auf die Risikoteilung. Im Rahmen des SMP wurden mögliche Gewinne und Verluste zwischen den Zentralbanken entsprechend ihren Anteilen (Kapitalschlüssel) aufgeteilt. Im Gegensatz dazu wurden im Rahmen des PSPP nur 20 Prozent der Ankäufe gemeinsam getätigt, wobei sich die einzelnen Zentralbanken des Eurosystems auf den Ankauf von Schuldtiteln ihrer eigenen Länder konzentrierten.26 Während für das PSPP eine Obergrenze der zu erwerbenden Anleihen eines einzelnen Emittenten von 33 Prozent galt, wurde diese für das PEPP aufgehoben.27 Im Unterschied zu anderen Programmen dürfen die Zentralbanken außerdem mehr Wertpapiere eines Landes zurückkaufen als nach dem Kapitalschlüssel vorgesehen. In der Praxis waren diese Abweichungen jedoch begrenzt.28
Die finanziellen Verluste der EZB und einzelner Banken des Eurosystems erwiesen sich im Jahr 2023 als ganz erhebliche negative Auswirkung der Stabilisierungspolitik. Sie ergaben sich aus der Differenz zwischen dem niedrigen (oder negativen) Zinssatz für gehaltene Staatsanleihen und dem Zinssatz für gehaltene Einlagen. Für 2023 meldete die EZB den ersten Verlust seit 2004 in Höhe von 1,3 Milliarden Euro, nach Auflösung von 6,6 Milliarden Euro aus der Rückstellung für finanzielle Risiken.29 Die Bundesbank hingegen musste für 2023 die Risikovorsorge in Höhe von 19,2 Milliarden Euro in voller Höhe verwenden, um Verluste auszugleichen.30 Die Aussicht auf Verluste der Zentralbanken in den folgenden Jahren bedeutet nicht nur, dass die Haushalte der Mitgliedstaaten nicht mehr gestützt werden können, sondern auch, dass die Zentralbanken möglicherweise rekapitalisiert werden müssen, was ihrem Ruf schaden und das Risiko einer Politisierung mit sich bringen würde.31
Wie bereits erwähnt, versucht die EZB derzeit, ihre Beteiligung an der Stabilisierungspolitik des Euroraums zurückzufahren. Ein solches Engagement könnte sich negativ auswirken, etwa auf das Erreichen des Inflationsziels oder durch Moral Hazard einiger Mitgliedstaaten, die sich bei nachlassender Entschlossenheit auf dem Weg der Strukturreformen darauf verlassen, dass die EZB im Falle einer Destabilisierung der öffentlichen Finanzen ohnehin Hilfe leistet. Die Absicht der EZB, von der bisherigen Praxis uneingeschränkter Intervention abzurücken, zeigt sich in den Bedingungen, die im Juli 2022 für die Aktivierung der Eurosystem-Instrumente zur künftigen Stabilisierung der Schuldenmärkte im Rahmen der TPI-Fazilität angekündigt wurden. Bei diesem Programm sind die Interventionen der Eurosystem-Banken daran gebunden, dass das betreffende Land im Rahmen des Systems der wirtschaftspolitischen Steuerung eine angemessene Wirtschaftspolitik betreibt.32 Damit wurde der Versuch unternommen, der Europäischen Kommission und dem ECOFIN-Rat im Rahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung mehr Gewicht zu verleihen.
Breiterer Kontext der Risikoteilung
Im Euroraum gibt es noch weitere Möglichkeiten der Risikoteilung. Ein Beispiel ist die Bereitstellung von Liquidität für Banken durch das Eurosystem. Ein weiteres ist die Bankenunion, zu der auch der Bankenabwicklungsfonds gehört, ein derzeit noch unvollendetes Projekt, bei dem kein einheitliches Einlagensicherungssystem vorgesehen ist.
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds (EIF) bieten ebenfalls Finanzierungs- und Risikoteilungsmechanismen für Investitionsprojekte in der Eurozone. Der Grad der Risikoteilung variiert allerdings je nach Mechanismus. Einige Instrumente beinhalten explizit Transfers von Finanzmitteln, während andere auf bedingten Darlehen oder der Bereitstellung von Liquidität beruhen.
Zu beobachten ist die Schaffung von Instrumenten zur Stützung der EU als Ganzer.
Die Entwicklung der Eurozone seit 2010 war zudem durch eine kontinuierliche Diskussion über Stabilitätsmechanismen gekennzeichnet, etwa den eines separaten Eurozonen-Haushalts. Diese Idee konnte sich aber nicht durchsetzen. Zu beobachten ist in den letzten Jahren jedoch die Schaffung von Instrumenten zur Unterstützung der EU als Ganzer, denen der EU-Haushalt als Grundlage dient. Ein Beispiel hierfür sind die beiden EU-Instrumente SURE33 und NextGenerationEU, deren Mittel durch EU-Anleihen auf den Finanzmärkten aufgebracht und von den Mitgliedstaaten über den EU-Haushalt garantiert werden. Obwohl diese für die Stabilisierung der Eurozone wichtigen Maßnahmen allen EU-Staaten zur Verfügung stehen, gehören die größten Länder zu den Hauptnutznießern dieser Hilfe. Diese Programme unterscheiden sich von den »traditionellen« Instrumenten des Euroraums, zum Beispiel dem ESM oder der EFSF, da sie sich auf die Linderung struktureller Probleme konzentrieren, anstatt den Verlust des Zugangs zum Schuldenmarkt zu kompensieren.
Das gegenseitige Abrechnungssystem des Eurosystems Target 2 – ein Zahlungssystem, das von der Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken innerhalb des Eurosystems genutzt wird – ist ebenfalls mit Risikoteilung innerhalb des Euroraums verbunden. Es ermöglicht die Echtzeitabwicklung von grenzüberschreitenden und inländischen Zahlungen im Euro-Währungsgebiet. Aus Grafik 3 geht hervor, dass die Ungleichgewichte der Forderungen seit der globalen Finanzkrise 2008 bis zum dritten Quartal 2022 langfristig zunehmen. Seit November 2022 ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Am deutlichsten sind die Ungleichgewichte mit großen negativen Salden in Italien und Spanien. Technisch gesehen handelt es sich bei den Target-2-Ungleichgewichten lediglich um die buchhalterische Erfassung der Geschäfte zwischen den Zentralbanken innerhalb des Eurosystems. Im Falle eines Auseinanderbrechens des Währungsgebiets würde sich jedoch das Problem stellen, dass diese Ungleichgewichte gegenseitig ausgeglichen werden müssten. Ungleichgewichte im Target-2-System können deswegen als Risikoteilungskanal betrachtet werden, da sie mit der Risikoteilung zwischen den Zentralbanken des Eurosystems zusammenhängen.34 Ihr Fortbestehen ist ein Hinweis auf anhaltende finanzielle Risiken im Euroraum.
Ausblick
Die Frage der Risikoteilung ist für eine Bilanz der europäischen Integration seit Lissabon auch deshalb relevant, weil sie zur ersten Änderung des AEUV seit 2010 führte. Die faktische Risikoteilung im Euroraum war ein chaotischer Prozess, bei dem höchst unterschiedliche Methoden der Integration zum Einsatz kamen. Sie wurde durch Rechtsakte bewirkt, die auf dem internationalen Privatrecht, dem Völkerrecht, EU-Rechtsakten, internen Rechtsakten der EU-Organe und Urteilen des Gerichtshofes fußen – das gilt insbesondere für jene Maßnahmen der EZB, die für die Stabilität des Euroraums von größter Bedeutung waren. Dabei wurden jedoch Zweifel an der demokratischen Legitimität der Maßnahmen laut, da diese von technokratischen Institutionen ergriffen worden seien. Die Risikoteilung erfolgte zudem auch automatisch durch den Aufbau von Ungleichgewichten im Target-2-System, deren Folgen jedoch nur im Falle eines Auseinanderbrechens oder eines Austritts eines bestimmten Staates aus der Währungsunion zum Tragen kämen.
Daneben gab es Versuche, die Risikoteilung systematisch zu regeln. Ein Beispiel dafür war die Schaffung des ESM. Der Hauptantrieb für diese Aktivitäten waren externe Schocks bzw. die Befürchtung, dass diese in Zukunft auftreten könnten. Obwohl mit dem ESM ein permanenter Rahmen für die Risikoteilung in der Eurozone geschaffen wurde, wird diese Institution aufgrund ihrer begrenzten Ressourcen und der Vorbehalte der Euro-Mitgliedstaaten gegenüber der Konditionalität der Finanzhilfen nicht ausreichen, um die Währungsunion zu stabilisieren.
Die Bedeutung der EZB für die Stabilisierung der Eurozone wird künftig kaum geringer werden.
Das derzeitige System der Risikoteilung, so das Ergebnis, wird durch den geldpolitischen Kanal dominiert. Zwar hat sich die EZB die schrittweise Reduzierung ihrer Bilanzsumme zum Ziel gesetzt, aber ohne geldpolitische Unterstützung werden die Staatsanleihen-Märkte der Eurozone höchstwahrscheinlich nicht normal funktionieren können. Außerdem war dies der politisch »billigste« Weg, die Stabilität des Euroraums zu gewährleisten. Die im März 2024 angekündigten Änderungen am geldpolitischen Handlungsrahmen der EZB bestätigen die Möglichkeit erneuter Interventionen des Eurosystems zur Stabilisierung der Finanzpolitik.35 Für die Zukunft wird man Alternativen brauchen, zum Beispiel in Form einer weitergehenden Einbindung des ESM in die Schuldenstabilisierung der Mitgliedstaaten oder mittels Schaffung eines anderen Mechanismus zur Risikoteilung auf dem Schuldenmarkt auf der Basis von Konditionalität. Da die Bedeutung der EZB bei den Stabilisierungsbemühungen der Eurozone jedoch auch künftig kaum geringer werden wird, steht eine zunehmende Politisierung der Institution zu erwarten, die unter anderem den im Jahr 2026 beginnenden Prozess der Auswahl einer Nachfolge für die derzeitige EZB-Chefin Christine Lagarde erschweren könnte. Zurückfahren ließe sich das Engagement der EZB durch eine stärkere Beteiligung des Privatsektors an der Risikoteilung – sofern die Integration der EU-Finanzmärkte im Rahmen des Projekts der Kapitalmarktunion entschlossen vorangetrieben wird.
Die Risikoteilung muss zudem mit Prozessen der Risikobeseitigung einhergehen. Hier sind zwei Ebenen von Bedeutung. Erstens gilt es auf EU-Ebene das neue System der Fiskalregeln bei gleichzeitiger Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten durchzusetzen. Zweitens muss auf der Ebene der Mitgliedstaaten, insbesondere der am stärksten verschuldeten, ein Gleichgewicht zwischen der Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen und der Notwendigkeit einer Neuausrichtung der derzeitigen Wachstumsquellen gefunden werden. Angesichts der enormen Kosten, die mit der Energiewende und dem Klimawandel auf die Mitgliedstaaten zukommen und deren Haushalte zunehmend belasten werden, wird die Beschäftigung mit der Frage, wie das finanzielle Risiko aufgeteilt werden kann und wo die Grenzen der Risikoteilung liegen, immer wichtiger.
Krisenimprovisation oder Quantensprung? EU-Energiepolitik im Zeichen von Ukraine-Krieg und Green Deal*
Russlands Krieg gegen die Ukraine hat Energiefragen zu einer zentralen Herausforderung europäischer Politik gemacht. Im zweiten Quartal 2022 war Russland mit – am Wert gemessen – 33 Prozent aller EU-Kohleimporte, 28 Prozent aller Pipeline-Gaslieferungen sowie 16 Prozent aller EU-Ölimporte noch der mit Abstand größte Energielieferant der Europäischen Union (EU).1 In vergleichsweise kurzer Zeit konnte die EU den Großteil dieser Importe beenden. Einerseits gewann sie andere Lieferanten, andererseits beschlossen die EU-Staaten flankierende Notfallregeln unter anderem zur Senkung des Gasverbrauchs, während sich zugleich Europäisches Parlament und Rat auf Basis des von der EU-Kommission vorgestellten REPowerEU-Plans auf neue Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien und im Bereich Energieeffizienz verständigten. Stellen diese Maßnahmen einen Quantensprung in der lange vernachlässigten Integration in Energiefragen dar, einen Eintritt gar in eine echte Energie-»Union«? Oder sind sie lediglich als kurzfristiges Mittel der Krisenimprovisation zu betrachten?
Aus historischer Sicht ist die Bedeutung von Energiefragen alles andere als überraschend, begründete doch die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) den europäischen Integrationsprozess. Bereits die Anfangsphase des europäischen Einigungsprozesses offenbart dabei ein Paradox, das sich als emblematisch für Europas Ringen mit Energiefragen erweisen sollte. So wurde in dem 1957 in Rom unterzeichneten Vertrag über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft kein Wort zur Energiepolitik verloren. Zugang zu Kohle und deren Verteilung waren schließlich in der EGKS geregelt, die Nutzung der Kernenergie im zeitgleich unterzeichneten Euratom-Vertrag. Energiebelange jenseits von Kohle und Kernenergie blieben damit weitgehend auf Wettbewerbsfragen und das Aufbrechen nationaler Monopole beschränkt. Nur langsam und nicht zuletzt im Zuge der aufkommenden europäischen Umwelt- und Klimapolitik erhielten Energiefragen mehr Aufmerksamkeit. Es dauerte jedoch bis zum Vertrag von Lissabon, bis die Energiepolitik mit dem neuen Artikel 194 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV) formell in die EU-Verträge Einzug hielt und der EU eine unterstützende Rolle bei einzelnen Aspekten der Energiepolitik zugeschrieben wurde. Die Energieversorgungssicherheit zählt dazu. Interessant ist hierbei, dass der sichere Zugang zu Energie ausdrücklich als Ziel erwähnt ist und die Vereinbarkeit mit Europas Klimazielen (Verknüpfung mit dem Green Deal) indirekt über Energieeffizienz und erneuerbare Energien Erwähnung findet. Die Bezahlbarkeit von Energie als soziale Komponente einer Energiepolitik findet sich jedoch in Artikel 194 AEUV nicht.
Die EU-Kompetenz in Energiefragen steht in Kontrast zu der öffentlichen Aufmerksamkeit für diesen Politikbereich.
Die sich nur langsam entfaltende EU-Kompetenz in Energiefragen steht in Kontrast zu der öffentlichen Aufmerksamkeit, die dieser Politikbereich im Angesicht von Klimawandel und Auswirkungen des Ukraine-Kriegs erfährt. So hielten 87 Prozent aller Befragten in einer im Mai/Juni 2023 durchgeführten Eurobarometer-Untersuchung es entweder für »wichtig« oder »sehr wichtig«, dass die EU sich dafür einsetzt, den Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix bis 2030 zu steigern.2 70 Prozent der Befragten signalisierten in derselben Umfrage Zustimmung zu der Aussage, dass die Reduzierung der Einfuhr von fossilen Brennstoffen die Energiesicherheit der EU erhöht und positive wirtschaftliche Effekte haben kann.3 Auch die Konferenz zur Zukunft Europas forderte in ihrem 2022 angenommenen Abschlussbericht: »Verbesserung der Energieversorgungssicherheit in der EU, Erreichen der Energieunabhängigkeit der EU bei gleichzeitiger Sicherstellung eines gerechten Übergangs und Versorgung der Unionsbürger mit ausreichender, erschwinglicher und nachhaltiger Energie«.4
Sollbruchstellen der europäischen Energiepolitik
Der Umstand, dass sich die Europäische Union trotz des großen politischen und gesellschaftlichen Interesses daran in Energiefragen so schwertut, hängt mit der ungelösten Frage der Kompetenzzuschreibung zwischen europäischer Ebene und Mitgliedstaaten zusammen. Dies zeigt sich deutlich an drei Sollbruchstellen, die in Fragen der Energiepolitik – sei es in den Verträgen, sei es in Debatten zur Finanzierung – immer wieder eine Rolle spielen. Im Spannungsfeld zwischen europäischen Zielsetzungen bei gleichzeitiger Beibehaltung nationaler Exekutivkompetenzen würde erstens eine Energieunion im engen Sinne eine gesamteuropäische Koordination erfordern, die unweigerlich in Konflikt gerät mit der nationalen Entscheidungsgewalt über Energiemix, Energieeinkauf sowie Details der Marktgestaltung. Hinzu kommt zweitens, dass auch die Sozialpolitik in mitgliedstaatlicher Kompetenz liegt, energiepolitische Entscheidungen der EU (man denke an den Green Deal oder das Strommarktdesign) aber mit dazu beitragen, dass soziale Fragen in den Vordergrund rücken und Teil energiepolitischer Überlegungen werden. Eine dritte Sollbruchstelle zeigt sich in unterschiedlichen Ansichten über Rolle und Einbeziehung privater Akteure und Marktteilnehmer.
In Artikel 194 AEUV tritt die Kernfrage der geteilten und umstrittenen Souveränität in Energiefragen wie erwähnt deutlich zutage. Zwar wird darin der EU »im Geiste der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten im Rahmen des Funktionierens des Binnenmarktes« eine Rolle bei der »Sicherstellung des Funktionierens des Energiemarktes« sowie der »Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit in der Union« zugewiesen. Zudem besitzt die EU Zuständigkeit bei der Förderung der Energieeffizienz, bei Energieeinsparungen, beim Ausbau erneuerbarer Energien und bei der Förderung grenzüberschreitender Netze. Zugleich untermauert Artikel 194 AEUV aber die Rolle der Mitgliedstaaten, die weiterhin alleine über die Nutzung von Energieressourcen, die Wahl zwischen verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur der Energieversorgung bestimmen sollen. Der einzige Energie-Vertragsartikel ist mithin Ausdruck des beschriebenen Spannungsfeldes zwischen begrenzter Zusammenarbeit auf europäischer Ebene und dem Festhalten der Mitgliedstaaten an ihrer nationalen Zuständigkeit in Energiebelangen. Entsprechend ist die europäische Energiepolitik in der Praxis auf dem Prinzip der Additionalität aufgebaut: Europäisches Handeln soll nationales Handeln keineswegs ersetzen, sondern lediglich innerhalb eines engen Rahmens ergänzen.
Die Beibehaltung der nationalen Entscheidungsgewalt über den Energiemix erschwert das Herausschälen eines europäischen Konsenses.
Die Beibehaltung der nationalen Entscheidungsgewalt über den Energiemix erschwert das Herausschälen eines europäischen Konsenses bei der Frage nach der Bedeutung des freien Marktes und der Rolle privater Wirtschaftsteilnehmer. Dazu zählt die Frage, inwiefern der europäische Energiebinnenmarkt staatlich organisiert werden oder den Regeln des offenen Marktes unterliegen soll. Zwar wurde der Energiebinnenmarkt liberalisiert, was zu einem Aufbrechen alter Monopolstrukturen führte; die im Zuge des Ukraine-Kriegs aufgeflammte Debatte über hohe Energiepreise und die Funktionsweise des Strommarktdesigns zeigt jedoch, dass Energiepolitik eben kein Politikfeld ist, das ohne gesellschaftliche Konsequenzen dem freien Spiel des Marktes überlassen werden kann. Ähnliches gilt für die künftige Rolle der Kernenergie und den Aufbau oder die Erweiterung von Terminals für Flüssigerdgas (LNG): Energiesicherheit ist nicht unabhängig von politischen Zielen zu sehen; Markt und Politik stehen in einem symbiotischen Verhältnis, das aber je nach Mitgliedstaat unterschiedlich ausgeprägt ist und in jeweils unterschiedliche Richtungen tendiert – sowohl bei der Zielsetzung als auch bei der Bereitschaft zur Mittelbereitstellung.
Wie die nach dem russischen Einfall in die Ukraine im Jahr 2022 rapide gestiegenen Energiekosten verdeutlichten, sind zudem soziale Abwägungen unverzichtbarer Bestandteil einer langfristig angelegten und auf breiten gesellschaftlichen Konsens zielenden Energiepolitik. Dies gilt keineswegs nur für die Bewältigung des Energiepreisschocks, der mit dem Wegfall von Gaslieferungen aus Russland einherging. Es ist anzunehmen, dass auch der langfristige Umbau der europäischen Wirtschaft im Rahmen des Green Deals mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zunehmend Gegenstand sozialpolitisch geprägter Debatten werden wird.
Gerade in der Sozialpolitik kommt es zu unübersehbaren Konflikten über die Zielsetzung und Methoden gesamteuropäischen Handels. Hier zeigt sich exemplarisch eines der Grundprobleme des europäischen Politikprozesses. Die Sozialpolitik ist auf Ebene der Mitgliedstaaten verortet; die EU-Verträge gestehen der europäischen Ebene höchstens eine unterstützende Rolle zu. Diese ist in ihrer Zielsetzung sowie den zugehörigen finanziellen Mitteln eng begrenzt und auf eine langfristige Perspektive der graduellen Angleichung der Lebensverhältnisse angelegt.
Zwischen Geopolitik und Green Deal: EU-Energiepolitik seit 2014
Durch die traditionelle Beschränkung auf Wettbewerbsfragen spielten geostrategische Fragen lange Zeit in der EU-Energiepolitik keine Rolle, sieht man von Ausnahmen ab wie der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Mindestvorräte an Erdöl vorzuhalten. Dies änderte sich erst 2014 mit der Wahl von Jean-Claude Juncker zum Präsidenten der Europäischen Kommission und vor dem Hintergrund der russischen Besetzung der Krim sowie russisch-ukrainischer Streitigkeiten über Gaslieferungen gen Westen. In seiner Bewerbungsrede vor dem Europäischen Parlament forderte Juncker am 15. Juli 2014 eine »resiliente« Energieunion, einschließlich einer zukunftsgerichteten Klimapolitik. Diese müsse unter anderem auf einer Diversifizierung von Energiequellen zwecks Reduzierung der Abhängigkeit von Drittstaaten sowie dem Ausbau erneuerbarer Energien beruhen.5 Im Fokus des Interesses stand die zum damaligen Zeitpunkt bereits umstrittene Ostseepipeline Nord Stream, die 2012 ihren Betrieb aufgenommen hatte und insbesondere den östlichen EU-Mitgliedstaaten ein Dorn im Auge war. Der Bau der zweiten Nord-Stream-Pipeline blieb denn auch während Junckers gesamter fünfjähriger Amtszeit ein Streitpunkt. Ironischerweise war es gerade die Kontroverse um Nord Stream, die letztlich die Annahme der EU-Verordnung zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung6 im Jahr 2017 begünstigte, mit der die Europäische Union erstmals eindeutig Schritte in Richtung einer geopolitisch orientierten Energieunion unternahm: durch die Festlegung, unter welchen Umständen und wie sich EU-Mitgliedstaaten im Falle einer Gasmangellage untereinander zu helfen haben. Dazu zählt auch die Verpflichtung, im Notfall keine Maßnahmen zu ergreifen, die in einem anderen Mitgliedstaat die Gasversorgung gefährden (Artikel 11), sondern stattdessen und als letztes Mittel in einer Solidaritätsmaßnahme Gaslieferungen auf dem eigenen Hoheitsgebiet zu drosseln, um »geschützte Kunden« wie Privathaushalte oder Krankenhäuser im Nachbarstaat zu versorgen (Artikel 13) – vorausgesetzt natürlich, die heimische Versorgung geschützter Kunden ist nicht gefährdet.
Die Gasversorgungssicherheitsverordnung wies in Richtung »positive« Integration.
Stand die EU-Energiepolitik bis dato also im Zeichen einer »negativen« Integration – dem Abbau nationaler Hürden zur Schaffung eines größeren Marktes –, wies die Gasversorgungssicherheitsverordnung in die entgegengesetzte Richtung: die Schaffung eines gemeinsamen Regelwerks im Sinne einer »positiven« Integration. Allerdings wurde das Tempo auch diesmal durch zwei Schritte vorwärts und einen zurück bestimmt. Denn der Blick ins Kleingedruckte offenbart schnell, dass die Mitgliedstaaten nicht gewillt waren, das Heft des Handelns aus der Hand zu geben. Zwar wurde die Verordnung im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren – also mit Zustimmung des Europäischen Parlaments – angenommen und war damit in allen EU-Staaten sofort gültig. Die Verantwortung für die Sicherheit der Gasversorgung liegt aber nach wie vor bei den nationalen Behörden. Der Grundkonflikt der Dualität zwischen europäischen Zielen und nationalen Kompetenzen wurde also keineswegs überwunden, sondern lediglich in ein formalisiertes Regelwerk überführt, das der supranationalen Ebene nur in geringem Maße Exekutivzuständigkeiten zugesteht.
Die neuen Energie-Ziele im Fit-for-55-Paket schaffen keine neuen Exekutivkompetenzen.
Mit dem Wechsel zur Kommission von der Leyen verschob sich das Augenmerk von der Geopolitik zunächst auf den Green Deal, das ambitionierte Klimaprogramm, das auf EU-weite Klimaneutralität bis 2050 abzielt. Obwohl dieses letztlich auf einer umfassenden Elektrifizierung beruht, spielten Energiefragen anfangs erneut nur eine untergeordnete Rolle. Im Mittelpunkt des »Fit for 55« genannten Gesetzgebungspakets zur Realisierung des Green Deal stand dagegen die Ausweitung des Emissionshandels auf den Verkehrs- und Gebäudesektor (ETS2). Zwar wurden im Rahmen des Fit-for-55-Pakets auch neue Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien, die Steigerung der Energieeffizienz sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz von Gebäuden vorgeschlagen. Diese bauen allerdings auf bestehender EU-Gesetzgebung auf und schaffen keine neuen Exekutivkompetenzen; es handelt sich also um quantitative Zielverschiebungen, die zu keiner qualitativ neuen Machtverlagerung von der nationalen auf eine supranationale Ebene führen.
Dies zeigt sich beispielhaft an der Richtlinie für den Ausbau erneuerbarer Energien.7 Eine mögliche Neufassung wurde bereits im Juli 2021 von der Europäischen Kommission vorgelegt und war im März 2023 Gegenstand einer Einigung von Europäischem Parlament und Rat. Zwar soll der Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch bis zum Jahr 2030 auf 42,5 Prozent steigen, mit der Option einer Anhebung auf 45 Prozent, wie vom Europäischen Parlament ursprünglich gefordert. Allerdings handelt es sich lediglich um ein europaweites Gesamtziel, dessen Umsetzung im Kern von mitgliedstaatlichen Anstrengungen abhängig ist.
Letztlich nur schlecht oder gar nicht auf europäischer Ebene steuerbare Ziele kennzeichnen auch die im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren in der ersten Jahreshälfte 2023 überarbeitete Energieeffizienzrichtlinie.8 So soll Europas Energieverbrauch 2030 um 11,7 Prozent gegenüber dem Referenzszenario aus dem Jahr 2020 zurückgegangen sein. Die Umsetzung bleibt aber der nationalstaatlichen Ebene überlassen und bedarf der Mithilfe privater Akteure sowie der Gesamtgesellschaft.
An dieser Grunddynamik ändert der im Rahmen des Fit-for-55-Gesetzgebungspakets auf den Weg gebrachte Klimasozialfonds ebenfalls nichts. Der mit 65 Milliarden Euro ausgestattete Fonds soll in den Jahren 2026 bis 2032 Mitgliedstaaten bei der Bewältigung der Klima- und Energietransformation helfen9 – vor allem durch Finanzierung von Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz, zur Gebäuderenovierung, zum Umstieg auf emissionsarme Mobilität und Verkehrsmittel sowie zur Unterstützung von Energiearmut betroffener Haushalte oder benachteiligter Kleinstunternehmen. Allerdings handelt es sich hier lediglich um unterstützende Maßnahmen und keineswegs um Haushaltshilfen oder gar die vollständige Übernahme von Ausgabenbereichen durch die europäische Ebene. Anders als bei der Aufbau- und Resilienzfazilität (Recovery and Resilience Facility, RRF), die sich aus NextGenerationEU speist, begibt die Europäische Union beim Klima-Sozialfonds auch keine Anleihen; es handelt sich somit nicht um ein neues Schuldeninstrument. Stattdessen werden die Mittel aus dem Verkauf von Zertifikaten im Rahmen des bestehenden EU-Emissionshandelssystems erbracht. Und selbst wenn allein die Existenz des Klima-Sozialfonds politisch darauf hinausläuft, dass der EU eine Rolle bei der Schaffung eines sozialen Ausgleichs für die gesellschaftlichen Verwerfungen zugestanden wird, die aufgrund der Energietransformation entstehen, so ist dieser Fonds gemessen an der Größe der Herausforderungen klein bemessen und kann allenfalls als Zusatzinstrument gesehen werden. Zudem wurde der Gesamtumfang von ursprünglich 72,2 Milliarden Euro (Kommissionsvorschlag) auf 65 Milliarden (Trilog-Einigung) reduziert, während der nationale Anteil von 50 Prozent (Kommissionsvorschlag) auf 25 Prozent (finaler Text) halbiert wurde.
Europas Energiepolitik im Zeichen des Ukraine-Kriegs: Vom Krisenmanagement zu vertiefter Integration?
Bemerkenswert sind die Schnelligkeit und Geschlossenheit, mit denen die europäischen Institutionen und die Europäische Union insgesamt auf den russischen Angriffskrieg reagierten. Sehr schnell verhängte die EU umfassende Sanktionen gegen Russland, darunter das Verbot der Einfuhr von Kohle sowie (mit Ausnahmen) von Öl aus Russland, und eine Preisobergrenze für russisches Rohöl. Gaslieferungen sowie Kernbrennstoffe blieben von den Sanktionen jedoch ausgenommen. Zu betonen ist dennoch der breite Konsens über die verhängten Sanktionen. Auch forderte das Europäische Parlament bereits am 1. März 2022, nur wenige Tage nach dem russischen Einmarsch vom 24. Februar 2022, mit überwältigender Mehrheit von 637 Stimmen bei nur 13 Gegenstimmen und 26 Enthaltungen neben Sanktionen unter anderem die Aufgabe der Erdgasfernleitung Nord Stream 2.
In der Versailler Erklärung werden keine quantitativen Zielvorgaben genannt.
Als wegweisendes Dokument zur Herausbildung einer europäischen Reaktion im Bereich der Energiepolitik ist die Versailler Erklärung des Europäischen Rates vom 10. und 11. März 2022 zu nennen. Wenn auch ohne rechtliche Bindewirkung, ist die Erklärung der Staats- und Regierungschefs geprägt von dem Willen, einen umfassenden strategischen Ansatz mit dem Ziel zu entwickeln, die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen schnell zu reduzieren. Es werden darin zudem Kernpunkte für die Entwicklung einer eigenständigen europäischen Energiepolitik skizziert, im Sinne europäischer Souveränität und Resilienz, die Frankreich – das zu diesem Zeitpunkt die rotierende Ratspräsidentschaft innehatte – als Ziele ausgegeben hatte. Die Palette reicht von der Diversifizierung, einschließlich der verstärkten Nutzung von Flüssigerdgas, über den schnellen Ausbau erneuerbarer Energien sowie der grenzüberschreitenden Gas- und Stromnetze bis hin zur Senkung des Energieverbrauchs. Betont wird allerdings auch die Freiheit der Mitgliedstaaten, über ihren Energiemix zu entscheiden. Anzumerken ist überdies, dass in der Versailler Erklärung keine quantitativen Zielvorgaben genannt werden. Vielmehr war sie der Startschuss für die Europäische Kommission, einen Notfallplan zu erarbeiten, den sie im April 2022 mit »REPowerEU« vorlegte.
So flexibel und rasch die Europäische Union willens und in der Lage war, sich auf die neuen Umstände einzustellen, so ist auch REPowerEU wieder durch die bereits oben skizzierten Grenzen gemeinschaftlichen Handelns gekennzeichnet. Anders als bei der Reaktion auf das Coronavirus fand sich keine Mehrheit für das Begeben neuer Anleihen an den Finanzmärkten, um »frisches« Geld in den raschen Ausbau erneuerbarer Energien zu lenken. Stattdessen beruht das REPowerEU-Programm größtenteils auf der Nutzung vorhandener Gelder aus der Aufbau- und Resilienzfazilität. Die 225 Milliarden Euro an RRF-Mitteln stehen den Mitgliedstaaten aber nur in Form von (zurückzuzahlenden) Darlehen zur Verfügung, da die ebenfalls aus dem RRF gespeisten (nicht zurückzuzahlenden) Finanzhilfen bereits vor Annahme des REPowerEU-Programms verplant waren. Zusätzliche Finanzhilfen ergeben sich nur aus Umschichtungen bestehender Mittel des EU‑Haushalts, darunter 20 Milliarden aus dem Emissionshandelssystem. Somit handelt es sich bei REPowerEU im Kern um die Möglichkeit, innerhalb des RRF Prioritäten neu zu definieren und diese in stark begrenztem Maße mit zusätzlichen, aber im EU-Haushalt bereits vorhandenen Mitteln aufzustocken. Zudem orientiert sich der Verteilschlüssel der RRF-Mittel nicht an energiepolitischen Erwägungen, sondern an der ursprünglich im Zuge der Coronahilfen beschlossenen Aufteilung.
Auch an der Kompetenzverteilung zwischen Mitgliedstaaten und europäischer Ebene ändert sich durch REPowerEU nichts. Das Programm ist vielmehr rein auf Additionalität angelegt: auf zusätzliches und unterstützendes Handeln der EU innerhalb des bestehenden kompetenzrechtlichen Rahmens. Dies zeigt sich beim Kernstück, dem Ausbau erneuerbarer Energien durch die bereits oben erwähnte Neufassung der Richtlinie für Erneuerbare Energien (EER): Die nationalen Kompetenzen werden aufrechterhalten – sprich: es fehlt ein verbindlicher Aufbaupfad –, zusätzliche zweckgebundene und zielgerichtete finanzielle Mittel oder Anreize gibt es jenseits der RRF oder der einschlägigen EU-Fördertöpfe keine, dafür müssen wirtschaftliche sowie sub-nationale Akteure einbezogen werden. So setzt die EER in Kombination mit den im Zuge des REPowerEU-Plan vorgesehenen Maßnahmen auf schnelle Genehmigungsverfahren und die Ausweisung besonderer Nutzungsflächen für erneuerbare Energien. Der Erfolg hängt damit nicht zuletzt von privaten Investitionen und der raschen Durchführung von Genehmigungsverfahren auf regionaler oder lokaler Ebene ab.
»AggregateEU« ist der erstmalige Versuch, Europas Marktmacht beim Gaseinkauf zu bündeln.
Bei Additionalität ohne Kompetenzverschiebung belässt es auch ein weiterer Vorschlag, wie sich Gaslieferungen aus Russland ersetzen ließen: »AggregateEU« ist der erstmalige Versuch, Europas Marktmacht zu bündeln und durch gemeinsame Einkäufe von Gas bei Lieferanten aus Drittländern niedrigere Preise auf dem umkämpften Weltmarkt durchzusetzen und zugleich die Liefersicherheit zu erhöhen. Basierend auf einer Ratsverordnung, und damit nicht im Mitentscheidungsverfahren angenommen, ist AggregateEU zwischenstaatlich organisiert, wenngleich die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ihre Gasspeicher zu 15 Prozent über diesen Mechanismus zu befüllen. Allerdings bedeutet dies im Umkehrschluss, dass der Großteil der in der EU getätigten Gaseinkäufe eben nicht über die gemeinschaftliche Plattform erfolgen muss. Ist in den Erwägungsgründen der entsprechenden Ratsverordnung noch die Rede davon, dass das »kollektive Gewicht der Union in vollem Umfang genutzt wird«,10 mündeten die beiden ersten gemeinsamen Koordinierungsrunden in einer Bündelung von knapp 23 Milliarden Kubikmetern Gas.11 Ein Erfolg – aber er ist zu der Tatsache ins Verhältnis zu setzen, dass die 27 EU-Staaten im Jahr 2021 insgesamt 412 Milliarden Kubikmeter Gas konsumierten (Einfuhr und Eigenproduktion).12 So zeigt sich auch hier, dass die Transformation in Richtung Energieunion nur langsam voranschreitet – und zusätzlich dadurch kompliziert wird, dass private Marktteilnehmer politisch zusammengeführt werden müssen.
Für die künftige Entwicklung der europäischen Energiepolitik beachtenswert ist in jedem Fall die intensive Nutzung zwischenstaatlicher Vertragsgrundlagen in Form von Artikel 122 AEUV.13 Diese »Notfallklausel« erlaubt die zwischenstaatliche Zusammenarbeit insbesondere im Falle von Schwierigkeiten bei der Energieversorgung, allerdings ohne Einbindung des Europäischen Parlaments. Einst kaum genutzt, entwickelte sie sich innerhalb kürzester Zeit zu einer vom Rat flexibel genutzten Rechtsgrundlage. So beschloss der Rat auf dieser Basis gleich drei politisch bedeutsame Rechtsakte: eine Verordnung zur Senkung der Gasnachfrage um 15 Prozent im Winter 2022/23 (Verordnung [EU]2022/1369), eine weitere über Notfallmaßnahmen zur Senkung der Energiepreise (Verordnung [EU]2022/1854) sowie die im Vorfeld besonders umstrittene Regelung über einen befristeten Marktkorrekturmechanismus zur Begrenzung übermäßig hoher Gaspreise (Verordnung [EU]2022/2578). Die im Frühjahr 2022 weithin beachtete Verordnung über die verpflichtende Befüllung nationaler Gasspeicher (Verordnung [EU]2022/1032) wurde dagegen im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren unter voller Mitsprache des Europäischen Parlaments angenommen. Ebenfalls im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erfolgt die Reform des EU-Strommarktes (KOM[2023]0148).
Ausblick: Von der regulatorischen zur politischen Union?
Betrachtet man die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union im Krisenjahr 2022, zeigt sich, dass die EU – ausreichende politische Geschlossenheit der Mitgliedstaaten vorausgesetzt – durchaus schnell handeln kann. Innerhalb kurzer Zeit entstand ein Konsens zur maximalen Befüllung der Gasspeicher, zum beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien und zum Zukauf von Flüssigerdgas aus Drittstaaten (wenn auch meist auf bilateraler Basis). Ob diese Maßnahmen zur kurzfristigen Krisenbewältigung allerdings eine Scharnierfunktion auf dem Weg in die vertiefte energiepolitische Integration haben werden, bleibt fraglich. Der wiederholte Rückgriff auf den zwischenstaatlichen Artikel 122 AEUV spricht zunächst dagegen und bedeutet zumindest, dass Exekutivhandeln auf europäischer Ebene nach wie vor in beträchtlichem Maße vom Willen der Mitgliedstaaten bestimmt wird. Wie lange dieser Wille vorhanden ist, hängt nur zum Teil vom weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs ab. Vielmehr steht zu erwarten, dass die »kriegsbedingten« Aspekte der Energiepolitik mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt und durch eine Debatte über Inhalt und Ziel der Klimatransition (green transition) ersetzt werden. Genau hier aber sind trotz oder gerade aufgrund der Annahme des Fit-for-55-Gesetzgebungspakets zunehmend Differenzen zu erwarten. In diesem Kontext ist überdies anzumerken, dass die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten bei der Gasversorgung nie ausgetestet wurde, da dank mildem Winter und vorhandenen Weltmarktreserven zum Jahreswechsel 2022/23 ausreichend Gas zur Verfügung stand.
Inwiefern die bereits getätigten Schritte eine Hinwendung zu einer geopolitischen Union in Energiefragen einleiten, bleibt offen.
Es bleibt deshalb offen, inwiefern die bereits getätigten Schritte eine Abkehr vom klassischen – »regulatorischen« – Politikmodell der Europäischen Union und eine mögliche Hinwendung zu einer politischen, ja vielleicht sogar geopolitischen Union in Energiefragen einleiten. Die nationalstaatliche Hoheit über den Energiemix wirkt sich dabei ausgerechnet auf das im europäischen Institutionengefüge nach wie vor entscheidende Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich aus. Vollzog die Berliner Regierungskoalition den endgültigen Ausstieg aus der Kernkraft, setzt man westlich des Rheins auf deren Ausbau, und auch in anderen EU-Staaten wie Polen oder Schweden erlebt sie eine Renaissance. Da aufgrund der jeweiligen politischen Konstellation und Historie eine deutsch-französische Annäherung in Sachen Kernkraft derzeit kaum zu erwarten ist, stellt sich die Frage, ob beide Seiten nicht an anderer Stelle zueinander finden können. Vorstellbar wäre zum Beispiel eine gemeinsame Initiative zum grenzüberschreitenden Ausbau von Strom- und Gasnetzen oder ähnlicher Infrastrukturvorhaben, die letztlich europäische öffentliche Güter und einen unzweifelhaften (gesamt-)europäischen Mehrwert darstellen. Die gezielte Einbindung der östlichen EU-Staaten könnte hier ebenfalls von Vorteil sein: nicht nur in der Sache selbst zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und als sichtbares Zeichen der gemeinsamen europäischen Solidarität, sondern auch als politischer Schlussstrich unter ein Jahrzehnt, das von energiepolitischen Spannungen zwischen Deutschland und seinen östlichen Nachbarn aufgrund der umstrittenen Nord-Stream-Pipeline geprägt war.
In politischer Hinsicht offenbart der Blick nach vorn mindestens vier Herausforderungen. Dazu zählt, erstens, die stärkere Verzahnung von energiepolitischen Zielen und Handlungsschritten auf europäischer und mitgliedstaatlicher Ebene. Die von den Mitgliedstaaten vorzulegenden Energie- und Klimapläne sind dazu ein erster Ansatz. Jenseits von Berichtspflichten und best-in-class-Vergleichen wäre eine weitergehende operative Verzahnung nationaler Ziele in strukturierter Form allerdings nur über die sektorale Gesetzgebung (beispielsweise die Erneuerbare-Energien-Richtlinie) oder gar in Anlehnung an den Rahmen für die wirtschaftspolitische Steuerung (Europäisches Semester) zu erreichen, der seinerseits im Frühjahr 2024 überarbeitet wurde.
Energieversorgung und die sozialen Folgen der Energie- und Klimawende werden bei den Europawahlen 2024 wichtig werden.
Zweitens werden die Vertiefung der Energieunion aufgrund der notwendigen Investitionen in Infrastruktur und erneuerbare Energien sowie die sozialpolitische Dimension der Energietransformation die Debatte über eine langfristige Erhöhung der auf europäischer Ebene zur Verfügung stehenden Finanzmittel weiter anheizen. Dazu zählt die Diskussion über eine Erhöhung des EU-Haushalts sowie mögliche Eigenmittel. Es ist also davon auszugehen, dass Fragen der Energieversorgung im Verbund mit einer Debatte über die sozialen Folgen der Energie- und Klimawende bei den Europawahlen 2024 starke Beachtung finden werden. Zu bedenken ist dabei, dass aus dem EU-Haushalt mittelfristig die Rückzahlung des NextGenerationEU-Fonds geleistet werden muss, während zeitgleich die Auszahlung der aus dem Fonds gespeisten RRF-Mittel ausläuft. Je geringer die finanzielle Ausstattung auf europäischer Ebene ausfällt, desto wichtiger wird es, die nationalen Ausgaben in einer Weise zu koordinieren, dass Investitionen dorthin gelenkt werden, wo sie durch einen effektiven und effizienten Ausbau erneuerbarer Energien sowie eine Senkung des Energieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes europäischen Mehrwert generieren.
Drittens befördert die zwar separate, aber mit Fragen der Energieunion eng verknüpfte Debatte über die Aus- und Weiterbildung der für die Klimawende nötigen Fachkräfte die Diskussion über eine intensivere Zusammenarbeit in Bildungsfragen auf europäischer Ebene. Diesen Umstand hat die EU-Kommission in ihrem Vorschlag zur Einrichtung von Net-Zero-Akademien im Rahmen des Net-Zero Industrial Act implizit anerkannt. Bildungs- und Sozialpolitik gehören zu den Kernkompetenzen der mitgliedstaatlichen Ebene. Dennoch ist davon auszugehen, dass eine stärkere Verzahnung von europäischer und nationaler Politikebene zu Kontroversen führen wird. Diese würden sich kaum auf die Finanzierung beschränken, sondern auch auf die Definition von Kernfähigkeiten sowie die Diffusion von Bildungsinhalten und Lernmethoden erstrecken.
Viertens und letztens zählt zu den zentralen Zukunftsfragen einer wirkmächtigen europäischen Energiepolitik der Aufbau effektiver Strukturen zur Verbesserung der europäischen Stellung auf dem Weltmarkt. Der freiwillige Gaseinkauf unter der Plattform AggregateEU ist ein wichtiger Anfang – der aber ausgebaut werden muss, soll er marktbeeinflussende Wirkung entfalten. Dazu braucht es eine möglichst große Zahl an Marktteilnehmern und entsprechend hohe Nachfragemengen. Der zuständige Vizepräsident der EU-Kommission, Maroš Šefčovič, sprach sich zudem für eine Ausweitung des Modells auf andere Rohstoffe wie Wasserstoff aus.14 Unterhalb der Ultima Ratio einer verpflichtenden Teilnahme aller Mitgliedstaaten und Marktteilnehmer böten sich dafür verschiedene Hebel an: zum Beispiel eine Debatte über höhere Mindestabnahmemengen innerhalb des europäischen Mechanismus oder die Definition von mengentechnischen Zielkorridoren für Importe aus Drittländern, um die Diversifizierung von Lieferanten voranzutreiben.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Europäische Union tiefgreifende Veränderungen vollziehen muss, wenn sie den Sprung von einer regulatory power zur global relevanten politischen Akteurin bewältigen und die Abhängigkeit von Drittstaaten langfristig verringern will. Dies setzt zwar nicht zwingend eine Änderung der EU-Verträge, aber doch ausreichend politischen Willen und Geschlossenheit seitens der Mitgliedstaaten voraus. Energiepolitik ist eine Querschnittsaufgabe, die weit über sektorale Fragen hinausgeht – und deren Bewältigung, wie sich gezeigt hat, über Erfolg und Misserfolg von Europas Strategie zur Bewältigung der Klimakrise sowie seine geopolitische Unabhängigkeit entscheiden wird.
Der europäische Green Deal: Ambitionssteigerung und Weiterentwicklung europäischer Klimapolitik
Der europäische »Green Deal« gilt als das wichtigste Projekt der Europäischen Kommission unter Ursula von der Leyen. Nach ihrer Wahl 2019 wurde er als oberste Priorität in das politische Programm der Kommission aufgenommen. Auch in der strategischen Agenda der Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat für den Zeitraum 2019 bis 2024 spielte Klimaschutz als eine von vier übergeordneten Prioritäten eine prominente Rolle.1 Die Initiative zum europäischen Green Deal wurde in einem politischen Umfeld gestartet, das durch die als »Klimawahl« bezeichneten Europawahlen 2019 geprägt war. In der Bevölkerung gewannen der Klimawandel und seine Folgen im Vorfeld dieser Wahlen deutlich an Relevanz. Laut Eurobarometer-Daten waren sie im Jahr 2019 die größte Sorge der Bürgerinnen und Bürger.2 Obwohl die Europäische Union bereits als Vorreiterin in der Klimapolitik galt, sah sie sich dem Vorwurf ausgesetzt, nicht genug zu tun, um das in Paris vereinbarte Klimaziel zu erreichen.
Neben rhetorischen Superlativen (»erster klimaneutraler Kontinent« und »Europe’s man on the moon moment«) deutet unter anderem die Umstrukturierung der Kommission darauf hin, dass sie dem Green Deal auch in der administrativen und politischen Praxis Rechnung trägt: So war bis zu seinem Ausscheiden aus der Kommission Exekutivvizepräsident Frans Timmermans für den europäischen Green Deal zuständig, womit der Generaldirektion Klimapolitik eine wichtige Rolle in der Machtarithmetik der Kommission zukam.
Seit dem Vertrag von Lissabon ist der Klimaschutz explizit im Primärrecht verankert, insbesondere durch Artikel 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Dadurch wurde die europäische Integration der Klimapolitik weiter vorangetrieben. Zentrale Gesetzgebungspakete in der Klimapolitik waren das »Klima- und Energiepaket 2020«3 und der »Klima- und energiepolitischen Rahmen bis 2030«.4 Auf dieser legislativen Grundlage baut der europäische Green Deal auf und zielt dabei nicht nur auf die Festschreibung ehrgeiziger Ambitionen im Bereich des Klimaschutzes, sondern auch darauf, entsprechende Politikinstrumente zu konsolidieren und weiterzuentwickeln. Als besonderes Merkmal des umfangreichen Gesamtprojekts ist hervorzuheben, dass im Green Deal darüber hinaus proaktiv die Schnittstellen zwischen der Klimapolitik und anderen Politikbereichen, darunter Agrar-, Industrie- und Wirtschaftspolitik, adressiert werden. Mit einer Vielzahl von Gesetzgebungsprozessen und weiteren Strategieprozessen5 stellt der Green Deal alle Beteiligten in den EU-Institutionen, den nationalen Administrationen sowie Interessenvertretungen und die Zivilgesellschaft vor große Herausforderungen.
Zwischen externen Erwartungen, internen Konflikten und neuen Krisen
Die zentrale Herausforderung in der Klimapolitik besteht darin, die globalen Treibhausgasemissionen, die auch neun Jahre nach dem Verhandlungserfolg des Pariser Abkommens weiterhin ansteigen, zu reduzieren und die negativen wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieser Transformation möglichst gering zu halten. Die anfängliche Euphorie über die multilaterale Einigung im Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) im Jahr 2015 ist mittlerweile einer nüchternen Erkenntnis gewichen: Altbekannte und vielschichtige Konflikte in der internationalen und nationalen Klimapolitik stehen der Zielerreichung weiterhin im Weg.
Die EU sieht sich bei Umsetzung des Green Deal drei Problemlagen ausgesetzt: interne Konfliktlinien, neue Krisen, internationale Erwartungen.
Zwar positioniert sich die EU, die maßgeblich zum Erfolg der Verhandlungen in Paris beigetragen hat, selbst als Vorreiterin in der Klimapolitik und strebt an, durch vorbildliche Ambitionen und innovative klimapolitische Instrumente auf einen ehrgeizigen Klimaschutz in Drittstaaten hinzuwirken.6 Allerdings sieht sie sich in ihrer Klimapolitik auch drei Problemlagen ausgesetzt, die die konkrete Umsetzung des Green Deal maßgeblich prägen.
Interne Konfliktlinien
Die EU agiert in der Klimapolitik nicht als einheitliche Akteurin. Die Entwicklung der klima- und energiepolitischen Architektur vor und seit der Verabschiedung des Vertrags von Lissabon war von erheblichen Konflikten zwischen den Mitgliedstaaten geprägt.7 Die Gründe dafür sind vielfältig und umfassen unter anderem: divergierende Strukturen in emissionsintensiven Sektoren wie Energie, Industrie und Landwirtschaft, Pfadabhängigkeiten in nationalen Energie- und Klimapolitiken sowie unterschiedliche politische Mehrheiten für ambitionierten Klimaschutz. Die prominentesten Allianzen zwischen den Mitgliedstaaten sind die Green Growth Group (mit Frankreich, Dänemark, Deutschland, Spanien und anderen) und die Visegrád-Gruppe (Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn). Die Visegrád-Gruppe – oder einzelne Länder daraus – haben sich wiederholt als Kritiker neuer Reformen und gesteigerter Ambitionsniveaus hervorgetan, wohingegen die Green Growth Group sich im Allgemeinen dafür ausspricht. Allerdings wurde im Zusammenhang des Green Deal nochmals deutlich, dass die Allianzenlandschaft in den konkreten Gesetzgebungsprozessen deutlich komplexer ist; mitunter kommt es zu zahlreichen Ad-hoc-Kooperationen. Die EU-Institutionen nehmen in den Gesetzgebungsprozessen ebenfalls unterschiedliche Rollen ein, was zu weiteren Konfliktlinien führt (siehe den Abschnitt »Institutionen«, S. 46ff).
Neue Krisen: Corona-Pandemie und Russlands Krieg in der Ukraine
Kurz nach den Europawahlen 2019 und den weitreichenden klimapolitischen Versprechungen von Ursula von der Leyen bei ihrer Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin rückte das Thema Klimawandel jedoch in den Hintergrund, als Anfang 2020 die Corona-Pandemie ausbrach. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 und der daraus resultierenden Energiepreis- und ‑versorgungskrise in der EU wird der Dimension der Energiesicherheit in Energie- und Klimapolitik wieder mehr Beachtung zuteil.8 Obwohl sowohl die Corona-Pandemie als auch der russische Angriffskrieg erhebliche politische und wirtschaftliche Folgen zeitigten, versuchte die Europäische Kommission in beiden Fällen, den Europäischen Green Deal – das Leitprojekt der beiden wichtigsten politischen Akteure von der Leyen und Timmermans – als Teil der Lösung für die neuen Herausforderungen zu etablieren. Inwieweit das mit Blick auf die sich dadurch noch vertiefenden internen Konfliktlinien gelang, zeigt ein Blick auf die wichtigsten Gesetzgebungsprozesse.
Hohe internationale Erwartungen
Insbesondere jene Länder, die in den internationalen Verhandlungen als am stärksten vom Klimawandel betroffene Länder (most vulnerable countries) und »Entwicklungsländer« (developing countries) zusammengefasst werden, fordern von der EU und anderen industrialisierten Staaten mit historisch hohen Emissionen, das derzeitige Emissionsniveau drastischer als vorgesehen zu senken sowie in einen Grünen Klimafonds (Green Climate Fund) einzuzahlen. Die Erwartungen richten sich vor allem an diejenigen Länder, die – wie die EU – in der Vergangenheit große Mengen Emissionen ausgestoßen haben und jetzt zu den zentralen Kräften in der internationalen Klimapolitik zählen.
Zwar scheiterte die EU mit ihrem Ansinnen, 2009 in Kopenhagen eine Führungsrolle auf der UN-Klimakonferenz einzunehmen, 2015 in Paris aber gelang es der Union, als »leadiator«9 einen wichtigen Beitrag zum Abkommen zu leisten. Neun Jahre später, in der Implementierungsphase des Abkommens, ergeben sich aus dieser Rolle konkrete Erwartungen an die Umsetzung abgegebener Klimaschutz-Versprechen.10
Der Stand des europäischen Green Deal
Die Vorlage des EU-Klimaschutzgesetzes hundert Tage nach Amtsantritt der neuen Kommission war der Startschuss für eine Reihe von Gesetzesinitiativen.11 Durch die Verschärfung des 2030-Ziels, das auf eine Nettoabsenkung der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um 55 Prozent festgelegt wurde, und die Verankerung des unionsweiten Ziels, im Jahr 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen, setzte das Gesetz (Verordnung (EU) 2021/1119) den Rahmen für Reformen der bestehenden klimapolitischen Architektur im Kontext des sogenannten Fit-for-55-Pakets.
Im Juli 2021 legte die Kommission ein Paket von mehr als zehn Legislativvorschlägen vor, das neben den drei Hauptsäulen der EU-Klimapolitik – Emissionshandelssystem (ETS), Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF) und Lastenteilung (ESR) – unter anderem neue Vorschläge enthält, darunter ein CO2-Grenzausgleichssystem (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), den Klima-Sozialfonds und ein Emissionshandelssystem für Emissionen aus dem Straßenverkehr und Gebäuden (ETS2). Im Laufe der Zeit kamen weitere Gesetzesvorschläge hinzu, die mit dem Green Deal in Verbindung stehen, zum Beispiel das Programm NextGenerationEU, dessen Mittel zu mindestens dreißig Prozent für klimarelevante Projekte ausgegeben werden sollen,12 oder das Programm REPowerEU als europäische Antwort auf die Energiesicherheitskrise, um die Abhängigkeit von Russland zu verringern und die Versorgungssicherheit zu erhöhen.13
Die europäische Klimapolitik ist von einer hohen Zahl an Rechtsakten geprägt, die das ordentliche Gesetzgebungsverfahren durchlaufen.
Im Vergleich zu anderen Politikfeldern ist die europäische Klimapolitik von einer hohen Zahl an Rechtsakten geprägt, die das ordentliche Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Die Vielzahl an Abstimmungen und politischen Interventionspunkten in dessen Verlauf stellt die Klimapolitik der EU gerade in Krisenzeiten vor große Herausforderungen.14 Mitgliedstaaten und politische Parteien streiten im Rahmen dieser Verfahren seit jeher nicht nur über das Ambitionsniveau des Klimaschutzes, auch die konkrete Ausgestaltung der Politikinstrumente sowie die Übertragung von Kompetenzen an die EU sind Gegenstand von Konflikten.15 Ein Mix aus Instrumenten wie dem EU-Emissionshandel und national verbindlichen und nach Ambitionslevel differenzierten Zielen für bislang nicht von diesem Handel abgedeckte Sektoren hat sich als tragfähiger Ansatz erwiesen, bei dem package deals zur Überwindung politischer Konfliktlinien erprobt und bewährt sind.16
Die Kommission hat diese Differenzierung zwischen Mitgliedstaaten in ihren Vorschlägen zum Fit-for-55-Paket weiterentwickelt und die Klimapolitik flankierende Maßnahmen beigesteuert. Neben dem Klima-Sozialfonds sollen Instrumente wie der Just Transition Fund oder der Ausbau des Modernisation Fund, der ausschließlich ausgewählte einkommensschwache Mitgliedstaaten beim Übergang zur Klimaneutralität unterstützt, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der angestrebten Transformation abfedern. Mit dem CBAM als neuem CO2-Grenzausgleich wird das Ziel verfolgt, Importe CO2-intensiver Produkte – sofern sie im Produktionsland nicht CO2-bepreist sind – an der EU-Grenze mit einer Abgabe zu belegen. So soll die Abwanderung CO2-intensiver Produktion aus der EU verhindert und eine Alternative zur bisherigen kostenlosen Zertifikatszuteilung im EU-ETS als Schutz vor Carbon Leakage etabliert werden.
Insgesamt deuten diese Entwicklungen darauf hin, dass der europäische Green Deal einer Konsolidierung und Weiterentwicklung der EU-Klimapolitik Vorschub leistet, für die sich trotz tiefgreifender Krisen Mehrheiten im Mehrebenensystem der Union gefunden haben. Bei der konkreten Umsetzung der Einigungen dürften allerdings neue Konflikte auftreten, sowohl intern (etwa über die Mittelvergabe neu geschaffener Fonds) als auch extern (zum Beispiel beim CBAM).
Institutionen
Die Europäische Kommission wird häufig als Motor der klimapolitischen Entwicklung in der EU bezeichnet17 – eine Zuschreibung, die im Falle des europäischen Green Deal durchaus zutrifft. Für die oben beschriebene Konsolidierung und Erweiterung des klimapolitischen Instrumentenkastens ist sie die entscheidende Treiberin im europäischen Institutionengefüge. Allerdings ist längst nicht all ihren Vorschlägen im EU-Gesetzgebungsprozess Erfolg beschieden; die gewünschte Neuzuordnung der Emissionen aus der Landwirtschaft zum LULUCF-Sektor etwa scheiterte. Die Kommission treibt im Rahmen des EU Green Deal auch Themen voran, die nicht Teil des Fit-for-55-Pakets sind und auf die Verzahnung von Klimapolitik mit anderen Politikfeldern zielen. Hier positioniert sich die Kommission als Agenda-Setter für aufkommende Themen und Politikdesigns. Das ist an einer Vielzahl von Mitteilungen abzulesen, welche die Kommission als Strategiedokumente veröffentlicht. Exemplarisch sei das Papier zu nachhaltigen Kohlestoffkreisläufen genannt, das wichtige Schnittstellen von Klima- und Landwirtschaftspolitik betrifft. Darüber hinaus reagiert die Kommission mit neuen politischen Initiativen situativ. Prominentestes Beispiel ist der Net-Zero Industry Act als Antwort auf den Inflation Reduction Act in den USA, mit dem die Kommission Klima- und Industriepolitik enger zu verknüpfen sucht.
Im Rat der Europäischen Union und im Europäischen Rat diskutieren die Mitgliedstaaten klimapolitische Dossiers in der Regel kontrovers. Der Europäische Rat beschäftigt sich dabei vor allem mit langfristigen Richtungsentscheidungen wie übergeordneten Treibhausgaszielen oder politisch besonders umstrittenen Fragen, wenn es etwa um Kriterien für eine Differenzierung der klimapolitischen Ambitionen in der Lastenteilungsverordnung geht. Die im Primärrecht verankerte Souveränität über den nationalen Energiemix dient dabei häufig als zentrales Argument für Mitgliedstaaten, die sich gegen Reformvorschläge wenden. So bestand bei den Verhandlungen über das Ziel der Treibhausgasneutralität insbesondere Polen darauf, dass es sich um ein EU-weites Ziel handeln müsse und nicht um eines, das für jedes Mitgliedsland einzeln gelte. Ein anderes Beispiel sind die Verhandlungen zum EU-ETS: Im Rahmen der Energiekrise forderte die polnische Regierung mit Unterstützung der tschechischen, das Instrument auszusetzen.18 Jenseits der in diesen Verhandlungen üblichen übergeordneten Allianzen (etwa Green Growth Group und Visegrád-Staaten, siehe oben, S. 44) spielen in Ad-hoc-Kooperationen nationale Partikularinteressen wie der Umgang mit Kernenergie (Frankreich) oder Verbrennungsmotoren (Deutschland) regelmäßig eine wichtige Rolle. Wie es um Kompromissbereitschaft und Allianzmanagement bestellt ist, wird sich nach den Europawahlen anlässlich der Verabschiedung des EU-Klimaziels 2040 zeigen, bei dem – wie schon beim 2030-Ziel – die Mitgliedstaaten versuchen werden, die Oberhand über das Ambitionsniveau zu behalten.19
|
Dossier |
Verfahrensnummer |
|
|
Klima-Sozialfonds |
2021/0206(COD) |
|
|
CO2-Grenzausgleichssystems (CBAM) |
2021/0214(COD) |
|
|
Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF) |
2021/0201(COD) |
|
|
Lastenteilung (ESR) |
2021/0200(COD) |
|
|
EU-Emissionshandel (ETS) |
2021/0211A(COD) |
|
|
CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge |
2021/0197(COD) |
|
|
EU-Emissionshandel für den Luftverkehr |
2021/0207(COD) |
|
|
Marktstabilitätsreserve im ETS |
2021/0202(COD) |
|
Das Europäische Parlament (EP) ist in klimapolitischen Gesetzgebungsprozessen dafür bekannt, intern Mehrheiten für Ambitionssteigerungen gegenüber den Kommissionsvorschlägen zu organisieren.20 So wollte es ein 2030-Nettoeinsparungsziel von 60 statt 55 Prozent erreichen (was nicht gelang) oder den Anteil der CO2-Entnahme an der Zielerreichung im Jahr 2030 begrenzen (womit es sich durchsetzte). Einige der Dossiers aus dem Fit-for-55-Paket sorgten jedoch für erhebliche Spannungen im EP, den letztlich gefundenen Mehrheiten gingen zum Teil langwierige Verhandlungen und – wie beim ETS – zunächst gescheiterte Abstimmungen im Plenum voraus. Die öffentlich zugänglichen Daten zu den namentlichen Abstimmungen im Parlament ermöglichen eine Analyse der finalen Voten und eröffnen Einblicke in Mehrheitsverhältnisse und politische Allianzen, auf die im Rahmen des EU Green Deal hingearbeitet wurde.
Für die Analyse wurden acht Abstimmungen ausgewählt: zu den Säulen der EU-Klimapolitik ESR, ETS und LULUCF, zu neuen Elementen wie dem Klima-Sozialfonds und dem CO2-Grenzausgleichsinstrument sowie zur Revision der Verordnung zu Emissionsnormen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge (siehe Tabelle 1).
Als Datengrundlage für das Abstimmungsverhalten aller 705 EP-Mitglieder bei den acht Voten dient das Portal howtheyvote.eu, eine Plattform, die ihre Daten direkt von der Website des EP bezieht und diese aufbereitet. Im Folgenden wird das Abstimmungsverhalten nach Fraktionen im Europäischen Parlament differenziert. Für Grafik 1 wurden die prozentualen Anteile des Abstimmungsverhaltens (dafür, dagegen, Enthaltung, keine Stimme) für alle acht Voten berechnet und daraus in einem zweiten Schritt die Mittelwerte des Abstimmungsverhaltens für alle acht Voten gebildet.
Grafik 1 zeigt, dass die Abstimmungen über die Rechtsakte aufs Ganze gesehen von einer breiten Koalition getragen wurden. Die stärkste Unterstützung kam von den Grünen mit über 90 Prozent, gefolgt von den Sozialdemokraten (S&D) und der Fraktion der Liberalen, Renew Europe. Die Europäische Volkspartei (EVP) stimmte mit etwas mehr als 70 Prozent zu, die Fraktion der Linken mit etwas mehr als 60 Prozent. Bei den fraktionslosen Abgeordneten fiel die Zustimmungsrate auf weniger als 40 Prozent, noch deutlicher gegen die Rechtsakte votierten die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) sowie die Fraktion Identität und Demokratie (ID). Es ist wichtig zu beachten, dass die Zustimmungsraten einen Durchschnitt darstellen und im Einzelfall von Fraktion zu Fraktion und Abstimmung zu Abstimmung durchaus variierten. Dennoch geben sie einen allgemeinen Überblick über die Haltung der verschiedenen Fraktionen zu den zentralen Rechtsakten des Green Deal. Berücksichtigt man die Sitzverteilung im EP, in der die Grünen, die Sozialdemokraten und Renew zusammen über nur 315 Stimmen verfügen, so wird deutlich, wie wichtig die zumindest anteilige Zustimmung der EVP als größter Fraktion ist, um die für Ambitionssteigerung erforderliche Mehrheit zu erreichen. Dies zeigte sich zuletzt auch in den intensiven Auseinandersetzungen über das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur (Nature Restoration Law).21
Im EP-Parteienspektrum gibt es erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Klimapolitik.
Diese Daten sind ein weiteres Indiz für die erheblichen Unterschiede im EP-Parteienspektrum hinsichtlich der Klimapolitik. Obwohl die wichtigsten Reformen des europäischen Green Deal von einer breiten politischen Allianz aus EVP, Sozialdemokraten, Grünen und Renew verabschiedet wurden, offenbart ein Blick auf die einzelnen Abstimmungen Konflikte innerhalb und zwischen den Fraktionen. Dass beispielsweise die erste Abstimmung über die Reform des Emissionshandels im Plenum aufgrund einer Auseinandersetzung über die industriepolitisch motivierte freie Zuteilung von Zertifikaten scheiterte, zeugt von der Fragilität dieser Allianz.22 Noch tiefer reichte die Kontroverse um das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, das neben umwelt- und klimapolitischen auch landwirtschaftspolitische Aspekte berührt. Insbesondere innerhalb der EVP waren interne Diskussionen sowie harte Debatten mit den anderen Fraktionen und Abgrenzungsbemühungen erkennbar. An Versuchen, die Abstimmung über die Verordnung in der Plenarabstimmung zu stoppen, zeigt sich die zunehmende Politisierung der EU-Klimapolitik. Die bevorstehenden Europawahlen und die Debatten über die Zusammensetzung der Kommission werden die parteipolitischen Unterschiede und parteiinternen Differenzen auf europäischer Ebene noch deutlicher hervortreten lassen. Hinzu kommen divergierende Haltungen zu einer ambitionierten Klimapolitik auf Ebene der Mitgliedstaaten sowie nationale Besonderheiten, die sich vor allem im Rat und Europäischen Rat abzeichnen und unter anderem die Diskussionen über das 2040-Ziel prägen werden.
Ausblick und Handlungsempfehlung
Der europäische Green Deal als wichtigstes Projekt der amtierenden Kommission hat mit der Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zwei substanzielle Krisen überstanden und wurde als Teil der Krisenbewältigungsstrategien verankert. Auch wenn nicht alle Vorschläge der Europäischen Kommission angenommen wurden, so ist es doch gelungen, die Klimapolitik als wichtigen Bestandteil der politischen Agenda zu erhalten. Insbesondere das Fit-for-55-Paket demonstriert, dass die Klimapolitik nicht geschwächt, sondern fortgeführt und weiterentwickelt wurde. Dass ein derart umfassendes Gesetzespaket in Zeiten multipler Krisen erfolgreich verabschiedet werden konnte, beweist die politische Resilienz eines Politikfelds, das im Vergleich zu anderen durch eine Vielzahl von Rechtsakten – mit jeweils eigenen Pfadabhängigkeiten, Akteursallianzen und interessenstrukturierenden Effekten – vorangetrieben wird.
Mit der Verabschiedung wurden erste Weichen für die Erreichung des Netto-Null-Treibhausgasziels gestellt. Allerdings steht erst die nächste Kommission vor der Herausforderung, neben der konkreten Umsetzung der beschlossenen Reformen die Ausgestaltung des klima- und energiepolitischen Rahmens für den Zeitraum 2031 bis 2040 zu entwickeln und bis zu den nächsten Wahlen 2029 abzuschließen.
Insbesondere an der Schnittstelle zur Landwirtschaft sind intensive Auseinandersetzungen zu erwarten.
Damit die klimapolitischen Ziele in allen Sektoren wirksam werden, bedarf es der fortschreitenden Verknüpfung mit anderen Politikfeldern. Dies ist neben der Ambitionssteigerung schon jetzt ein zentrales Anliegen der Kommission, die Schnittstellen etwa zu Landwirtschaft und Industrie sowie zur Energiepolitik zu schaffen sucht. Diese Ausweitung der Klimapolitik eröffnet zum einen Chancen darauf, klimapolitische Ziele durch die Verankerung in anderen Politikfeldern erreichbar zu machen. Sie birgt jedoch auch das Risiko, dass in anderen Politikfeldern etablierte Konfliktlinien auf klimapolitische Prozesse übertragen werden (politics spill-over) – das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur ist hierfür ein prominentes Beispiel. Insbesondere an der Schnittstelle zur Landwirtschaft sind in den kommenden Jahren intensive Auseinandersetzungen zu erwarten.
Schon bei den abgeschlossenen Gesetzgebungsprozessen trat in den Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten und im EP eine Vielzahl von Konfliktlinien zutage. In der Reform und Weiterentwicklung der Zielarchitektur und des klimapolitischen Instrumentariums mit Blick auf 2040 werden diese verstärkt hervorbrechen. Die Mitgliedstaaten unterscheiden sich zum Teil erheblich bezüglich ihrer Ausgangspunkte für die Transformation zur Klimaneutralität sowie in ihren gesellschaftspolitischen Präferenzen für Lösungsansätze zur Erreichung dieses Ziels. Das Management von Allianzen sowohl im Rat als auch im Europäischen Parlament ist ein zentraler Baustein der EU-Klimapolitik und wird in den kommenden Jahren mit fortschreitender Dekarbonisierung und sich verschärfenden Verteilungskonflikten schwieriger werden und noch mehr an Bedeutung gewinnen.
Im bevorstehenden Wahlkampf dürfte insbesondere das Klimaziel 2040 zum Kristallisationspunkt der parteipolitischen Auseinandersetzungen um das Ambitionsniveau der europäischen Klimapolitik werden. Im Anschluss daran werden die Verhandlungen über die Zusammensetzung der Kommission und ihr politisches Programm nach den Europawahlen zeigen, ob die Klimapolitik ihren hohen Stellenwert beibehalten wird. Die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament sowie Veränderungen in nationalen Regierungen werden essenziellen Einfluss auf die künftige Ausgestaltung der europäischen Klimapolitik nehmen.
Die anstehende Überarbeitung des klima- und energiepolitischen Rahmens für den Zeitraum 2031 bis 2040, der stärker in andere Politikfelder hereinreichen wird, als das bisher der Fall war, wird bestehende Allianzen wiederholt auf eine harte Probe stellen und gleichzeitig neue entstehen lassen. Ob das Netto-Null-Klimaziel für das Jahr 2050 in greifbare Nähe rückt und die EU ihrer selbsterklärten Vorreiterrolle gerecht werden wird, hängt einerseits maßgeblich davon ab, inwieweit das mit dem Fit-for-55-Paket beschlossene klimapolitische Instrumentarium in den kommenden Jahren gegen Initiativen zur Ambitionsreduktion abgesichert werden kann. Andererseits ist entscheidend, ob die Weiterentwicklung der Klimapolitik für die nächste Dekade bis 2040 trotz erwartbarer politischer Blockaden gelingt.
Gesundheitspolitik der Europäischen Union
Nach einer weit verbreiteten Auffassung spielt die Europäische Union (EU) in den Politikbereichen öffentliche Gesundheit und Gesundheitsversorgung aufgrund mangelnder Kompetenzen eine untergeordnete Rolle. Insofern war es durchaus eine Überraschung, als Kommissionspräsidentin von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union 2020 eine Europäische Gesundheitsunion (EGU) ankündigte.1 Während diese Initiative – eine Reaktion auf die Covid-19-Pandemie – von der Kommission ausging, haben sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat umgehend den Aufbau der EGU unterstützt und sich das Projekt durch die Verabschiedung einzelner Rechtsakte zu eigen gemacht.2 Diese politische Aufmerksamkeit spiegelt wider, dass in Umfragen 2020 und 2021 fast ein Viertel der befragten EU-Bürgerinnen und ‑Bürger Gesundheit als das wichtigste Thema auf europäischer Ebene einordnete.3
Die erklärten Ziele der EGU sind der Schutz der Gesundheit, der Aufbau von Kapazitäten für eine wirksamere und koordiniertere Pandemieprävention, ‑vorsorge und ‑reaktion sowie die Stärkung der Resilienz von Gesundheitssystemen.4 Offen ist dabei nicht nur, wie die EU im Rahmen ihrer Kompetenzen eine effektive EGU umsetzen kann oder ob es dazu einer Kompetenzerweiterung bedarf. Es stellt sich auch die Frage, ob die EGU das bisherige Handeln der EU qualitativ verändern soll oder eher als eine Fortschreibung der bisherigen EU-Gesundheitspolitik zu verstehen ist. Die Beantwortung dieser Fragen ist von hoher politischer Relevanz. Neben Hinweisen auf die existierenden Instrumente der EU-Governance, etwa die Koordinierung und Unterstützung von Gesundheitspolitiken der Mitgliedstaaten sowie die Förderung der Gesundheitsversorgung durch EU-Fonds, ist in den Diskussionen über den Aufbau der EGU immer häufiger die Forderung nach Vertragsänderung und Kompetenzerweiterung zu hören.5 Zunächst gilt es jedoch den bisherigen Handlungsrahmen auszuloten.
Mit Blick auf die Kompetenzen der EU gilt es zwischen Gesundheitsversorgung und öffentlicher Gesundheit sowie dem besonderen Fall der gemeinsamen Sicherheitsanliegen in der öffentlichen Gesundheit zu unterscheiden. Gesundheitsversorgung umfasst die Bereitstellung von Gesundheitsdiensten im Rahmen von Gesundheitssystemen, wohingegen es bei der öffentlichen Gesundheit um die Bekämpfung von übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheitserregern geht.6 Die gemeinsamen Sicherheitsanliegen wiederum beziehen sich speziell auf grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren durch übertragbare Krankheiten. Während die gemeinsamen Sicherheitsanliegen als geteilte Zuständigkeit gemäß Artikel 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) eingeführt werden, verbleibt die Förderung der menschlichen Gesundheit laut Artikel 6 AEUV in nationaler Zuständigkeit, die EU hat hier nur eine unterstützende Zuständigkeit. Im Allgemeinen sprechen die Artikel 4 und 6 AEUV der EU also nur eine begrenzte Rolle in der Gesundheitspolitik zu.7 Im Detail verfügt sie dort über dreierlei Kompetenzen, die in Artikel 4 und 6 AEUV weiter konkretisiert werden: zum einen direkte gemäß Artikel 168 AEUV, zum anderen indirekte über die Binnenmarktkompetenzen nach Artikel 114 AEUV und durch fiskalische Steuerung im Rahmen des Europäischen Semesters.8
Im Einzelnen gestattet Artikel 168 Absatz 5 AEUV der EU, Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Bekämpfung grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren zu ergreifen. Dies gilt jedoch »unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung«. Zudem stellt Artikel 168 Absatz 7 AEUV klar, dass die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in der Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten liegt. Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen ökonomischer Integration und menschlicher Gesundheit hat die EU jedoch indirekt über Kompetenzen im Bereich des Binnenmarktes nach Artikel 114 AEUV eine Fülle von Rechtsakten erlassen, die als Nebenprodukt die öffentliche Gesundheit und die Gesundheitsversorgung betreffen. Darüber hinaus wirkt die EU im Rahmen des Europäischen Semesters durch länderspezifische Empfehlungen (CSR) auf die nationale Gesundheitspolitik ein.9 Obwohl die CSR lediglich von den jeweiligen Mitgliedstaaten in ihrer Politik sowie in der Aufstellung des nationalen Haushalts berücksichtigt werden sollen und sich aus ihnen keine unmittelbaren Handlungsverpflichtungen ergeben, kommt diesen Empfehlungen wachsende Bedeutung als Instrument der Koordinierung von Gesundheitspolitiken zu. Dies zeigt sich schon allein darin, dass die CSR immer detaillierter Bezug auf Gesundheitspolitik nehmen. So enthielten beispielsweise die CSR für Deutschland im Jahr 2014 Empfehlungen zu mehr Kosteneffizienz im Gesundheitssektor und die CSR für Rumänien im Jahr 2019 Anregungen, wie sich der Zugang zu Gesundheitsversorgung verbessern ließe. Letztlich kam es im Zuge der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 zu einer ganzen Reihe an Empfehlungen.10
Die EU war – insbesondere mittels Artikel 114 AEUV – bereits vor der Covid-19-Pandemie äußerst aktiv in der Gestaltung der europäischen Gesundheitspolitik. Zwar wurden diese Ansätze nicht in einem größeren politischen Projekt gebündelt, sie können aber dennoch als Vorläufer der EGU verstanden werden. Bereits im Zusammenhang mit diesen Vorläufern der Gesundheitsunion ergaben sich Konflikte zwischen der EU und den Mitgliedstaaten, da Letztere nicht nur die Überschreitung des rechtlichen Handlungsrahmens der EU monierten, sondern auch eine direkte Einflussnahme der EU auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung fürchteten.
Konfliktfelder europäischer Gesundheitsgovernance
Die legitimatorische Bedeutung staatlicher Daseinsvorsorge erklärt, warum die Gesundheitspolitik für Nationalstaaten eine so zentrale Rolle spielt. Die Sorge vor einer zu starken Einflussnahme der EU spiegelt sich vor allem darin wider, dass die Mitgliedstaaten den Handlungsspielraum der EU zusätzlich zu den Regelungen in Artikel 4 und 6 AEUV auch durch das grundsätzliche Harmonisierungsverbot nach Artikel 168 AEUV einschränken wollen.11 Hierbei geht es zum einen um die Abwehr einer positiven Integration, im Zuge derer einheitliche Regelungen und neue gemeinsame Institutionen zur Angleichung von Gesundheitssystemen geschaffen werden. Zum anderen geht es aber auch um die Verhinderung einer negativen Integration im Sinne einer Liberalisierung, etwa indem EU-Bürgerinnen und ‑Bürger freien Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen in allen Mitgliedstaaten erhalten.
Die Mitgliedstaaten haben das Handeln der EU in öffentlicher Gesundheit und Gesundheitsversorgung stets kritisch betrachtet.
Historisch gesehen haben die Mitgliedstaaten das Handeln der EU in den Bereichen öffentliche Gesundheit und Gesundheitsversorgung stets kritisch betrachtet und einschlägige Rechtsakte der EU regelmäßig vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) gebracht.12 Beispielhaft seien die Richtlinie zum Tabakwerbeverbot13 sowie die Richtlinie über medizinische Behandlungen von Patientinnen und Patienten im EU-Ausland14 erwähnt. Neben dieser anekdotischen Evidenz zeigen Daten über das Abstimmungsverhalten von Mitgliedstaaten im Rat, dass es seit 2019 in durchschnittlich 31 Prozent der Abstimmungen im Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz (EPSCO) eine oder mehrere Gegenstimmen gab, während es in den anderen Ratsformationen im Durchschnitt nur 15 Prozent waren, wobei dieser Befund selbstredend nicht nur auf Konflikte in Bezug auf Gesundheitsthemen zurückgeführt werden kann.15 Die Bündelung der Politikbereiche in der EPSCO-Ratsformation unterstreicht im Übrigen die enge Verknüpfung von Gesundheit mit Sozialpolitik und Bereichen staatlicher Fürsorge.
Die skizzierte Konfliktträchtigkeit von Themen staatlicher Fürsorge und insbesondere des Themas Gesundheit wurde im Zuge der Covid-19-Pandemie – nach einer kurzen Phase nationaler Alleingänge – schnell überwunden. Sowohl im Bereich der öffentlichen Gesundheit als auch der Gesundheitsversorgung unterstützten die Mitgliedstaaten die Aktivitäten der EU zur Bekämpfung der Pandemie. Wichtige Beispiele sind die gemeinsame Impfstoffbeschaffung sowie die Initiierung und die Aufnahme von Verhandlungen über einen völkerrechtlichen Pandemievertrag. In beiden Fällen haben die Mitgliedstaaten der EU-Kommission ein entsprechendes Mandat übertragen, das diese ermächtigt, zentrale Weichen für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu stellen und ein internationales Instrument zur Pandemiebekämpfung auszuhandeln, wenn auch im engen Austausch mit den Mitgliedstaaten. Die Mandate zeigen deutlich die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, wichtige Instrumente der öffentlichen Gesundheit und Gesundheitsversorgung in einer vorher kaum vorstellbaren Weise in die Hände der EU zu legen.
Allerdings sollte dieses gemeinsame Handeln nicht über die Konflikte unter den Mitgliedstaaten hinwegtäuschen. Zum einen diente die gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen nur der Verhinderung eines sich bereits abzeichnenden Aufkaufwettbewerbs unter den Mitgliedstaaten.16 Zum anderen kam es trotz der Bemühungen der Kommission dazu, dass einzelne Staaten das Verbot der Einführung von Exportrestriktionen im Handel mit medizinischer Schutzausrüstung und pharmazeutischen Produkten missachteten. Auch in den Debatten über den Pandemievertrag zeigen sich deutliche Konfliktlinien zwischen Mitgliedstaaten, etwa dort, wo es um Patentrechte geht oder um den gerechten Vorteilsausgleich beim Zugang zu genetischen Ressourcen und deren Nutzung. Diese und andere Konflikte existieren weiterhin. Der Handlungsrahmen der EGU wird auch sie beschwichtigen und so die Grundlage für eine angemessene Reaktion auf zukünftige Gesundheitsnotlagen schaffen müssen, wenn man nicht erneut auf eine Ad-hoc-Lösung im Ernstfall vertrauen will.
Stand der Gesundheitsunion
Die EGU wird gemäß der Zielsetzung an unterschiedlichen Aspekten der europäischen Gesundheitspolitik anknüpfen und diese erweitern sowie neue Komponenten einführen, die zum Gesundheitsschutz, der Schaffung von Kapazitäten zur Bekämpfung von Gesundheitsbedrohungen und zur Stärkung der Resilienz von Gesundheitssystemen beitragen. Um den Stand der Gesundheitsunion zu erfassen und die Frage zu beantworten, ob die EU im Rahmen ihrer Kompetenzen eine effektive EGU aufbauen kann oder ob es einer Kompetenzerweiterung bedarf, gilt es zunächst, die EU-Gesundheitspolitik vor der Covid-19-Pandemie, insbesondere seit dem Vertrag von Lissabon, sowie die im Zuge der Pandemie eingeführten Komponenten aufzuschlüsseln. Erst auf dieser Basis lässt sich eine Einschätzung des Integrationsstands vor weitergehenden Vertragsrevisionen abgeben.
Gesundheitsunion vor der Covid-19-Pandemie
In Anbetracht der legislativen Tätigkeit vor der Pandemie stellt sich die Frage, ob der Plan zur Errichtung der EGU zu einer qualitativen Veränderung des Handelns der EU geführt hat oder noch führen soll. Das Konzept der EGU ist relativ vage und wenig ausbuchstabiert.17 Es ist somit fraglich, unter welchen Umständen man überhaupt von einer Gesundheitsunion sprechen kann. Man könnte argumentieren, dass eine solche Union nur dann besteht, wenn eine dem Binnenmarkt entsprechende Situation im Gesundheitssektor vorliegt. Dazu bedürfte es eines gemeinsamen Handlungsrahmens von Mitgliedstaaten in der grenzüberschreitenden öffentlichen Gesundheit und einer gesicherten Gesundheitsversorgung gerade mit Blick auf gesundheitliche Notlagen. Explizit im Sinne dieser Lesart zielt die Arzneimittelstrategie von 2023 laut EU-Kommissarin Stella Kyriakides darauf ab, einen »Binnenmarkt für Arzneimittel«18 zu schaffen, um allen Bürgerinnen und Bürgern gleichen Zugang zu ermöglichen.
Während hier keine ausführliche Darstellung der EU-Gesundheitspolitik erfolgen kann, sollen dennoch kurz die Kernelemente des Handelns der EU vor 2020 beschrieben werden.19 Seit 1962 gelten einheitliche Standards für Lebensmittelsicherheit, die infolge des BSE-Skandals verschärft wurden.20 Ebenfalls seit den 1960er Jahren existiert ein sich stetig weiterentwickelnder Rechtsrahmen für pharmazeutische Produkte, etwa zur Marktzulassung21 und zur Preistransparenz.22 Ähnlich geregelt werden medizinische Geräte23 sowie der Umgang mit Substanzen menschlichen Ursprungs.24 Zudem wurden legislative Akte zur Einführung von Standards in der Ausbildung medizinischen Personals auf den Weg gebracht.25 Und die Richtlinie über Patientenrechte seit 2011 ermöglicht, dass Bürgerinnen und Bürger im EU-Binnenmarkt ärztliche Dienstleistungen wahrnehmen und in ihrem Heimatland abrechnen.26 Aus dieser kurzen Übersicht folgt, dass die EU bereits in weiten Teilen einheitliche Standards für einen grenzüberschreitenden Verkehr von Patientinnen und Patienten sowie von medizinischen Gütern und medizinischem Personal geschaffen hat. Zudem weisen die genannten Rechtsakte in weiten Teilen enge Verbindungen zum Binnenmarkt auf, indem sie der effektiven Umsetzung der Grundfreiheiten dienen oder die Funktionsweise des Binnenmarkts sichern. So stützen etwa die früh eingeführten einheitlichen Lebensmittelstandards die Warenverkehrsfreiheit insbesondere für Agrarprodukte. Ebenso ist die Möglichkeit, unmittelbar ärztliche Hilfe in anderen Mitgliedstaaten aufzusuchen, eine notwendige Konsequenz der Personenverkehrsfreiheit. Aus den Kernkompetenzen der EU im Bereich des Binnenmarkts folgt damit systematisch ein stetiger »Spill-over-Effekt«, der als Nebenprodukt Regelungen im Gesundheitsbereich nötig macht. Zur effektiven Umsetzung der Regelungen wurden zudem mit dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) neue unabhängige Agenturen geschaffen. Vor allem die Schaffung des ECDC und die Maßnahmen im Zuge der Ebola-Epidemie 2014 zeigen,27 dass ein vollständig integrierter Binnenmarkt die koordinierte und gemeinsame Bekämpfung von Gesundheitsbedrohungen mittels gesundheitspolitischer Rechtsakte erfordert.
Gesundheitspolitische Rechtsakte der EU
Bei der Gesetzgebungstätigkeit der EU kann im Allgemeinen zwischen »Hard-Law« und »Soft-Law« unterschieden werden. Ersteres bezieht sich auf Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse, Letzteres primär auf Empfehlungen und Stellungnahmen der EU. Grafik 1 gibt einen Überblick über die Anzahl der Gesetzgebungsakte im Gesundheitsbereich seit 2009. Im Bereich »Hard-Law« zeigt die Grafik deutliche Schwankungen. Während 2013 nur sieben Rechtsakte zu verzeichnen sind, markierte das Jahr 2022 mit 26 Rechtsakten ein Allzeithoch.
In Bezug auf »Soft-Law« war die EU im Vergleich dazu deutlich weniger aktiv. Die kleinere Spitze im Jahr 2014 und der starke Anstieg zwischen 2020 und 2022 fallen mit dem Ebola-Ausbruch 2014 und der Covid-19-Pandemie zusammen. Demnach scheint sich die EU in Krisensituationen im Bereich der öffentlichen Gesundheit vor allem auf »Soft-Law« zu verlassen, während »Hard-Law« kontinuierlich und immer häufiger angewandt wird. Dies deutet darauf hin, dass der Aufbau der Widerstandsfähigkeit nach der Pandemie eher durch Verordnungen und Richtlinien im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens mit dem EU-Parlament als durch Empfehlungen gesteuert werden wird.
Eine relevante Frage im Zusammenhang mit dem rechtlichen Handeln der EU ist, wie wichtig die Themen für die EU-Bürgerinnen und ‑Bürger sind. Grafik 2 weist den prozentualen Anteil der im Rahmen des Eurobarometers Befragten aus, für die Gesundheitsfragen derzeit die wichtigsten Themen auf persönlicher, staatlicher oder europäischer Ebene sind. Die Grafik lässt nach 2011 einen deutlichen und kontinuierlichen Anstieg erkennen. Leider wird die Frage nach der EU-Ebene erst ab 2020 einbezogen. Der Anteil der Befragten ist hier aber mit rund 22 Prozent ebenfalls relativ hoch. Bemerkenswert ist, dass bei allen Indikatoren im Jahr 2022 ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen ist. Die Werte liegen sogar substantiell niedriger als jene im Jahr 2015, in dem das Thema Migration in der EU außerordentlich dominant war. Das ist insofern bemerkenswert, als nur ein Thema als Priorität genannt werden kann und etwa 20 Prozent der Befragten Gesundheit mehr Beachtung schenken als Migration und anderen Themen.
Die EGU muss sich daran messen lassen, ob sie Elemente enthält, die effektiv umsetzbar sind und die europäische Gesundheitsgovernance qualitativ verbessern.
Der Rückgang nach 2021 lässt vermuten, dass andere Themen an Relevanz gewonnen haben, zumal die Öffentlichkeit die Pandemie und die damit verbundenen Aspekte hinter sich lassen möchte. Die so deutlich gesunkene öffentliche Aufmerksamkeit fällt zusammen mit der Verabschiedung der höchsten Zahl an Rechtsakten zu Gesundheitsthemen seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon (siehe Grafik 1). Auf der einen Seite kann dies als responsive Reaktion der EU-Institutionen auf das zuvor gestiegene öffentliche Interesse verstanden werden. Dies würde die krisengetriebene Schaffung der EGU zusätzlich legitimieren. Auf der anderen Seite birgt die wieder nachlassende Aufmerksamkeit aber auch eine legitimatorische Gefahr, da die EU beim Aufbau der EGU möglicherweise eine schwache Kompetenzgrundlage hat und die Öffentlichkeit dem Handeln der EU in der konkreten Umsetzung wenig Beachtung schenkt. In jedem Fall wird sich die EGU daran messen lassen müssen, ob sie Elemente enthält, die nicht nur effektiv umsetzbar sind, sondern auch die europäische Gesundheitsgovernance qualitativ verbessern. Andernfalls könnte das Vorhaben lediglich wie Symbolpolitik wirken, die auf ein vorübergehend besonders ausgeprägtes Interesse der Öffentlichkeit reagiert. Im Folgenden sind daher die Elemente der EGU einer genaueren Betrachtung zu unterziehen.
Elemente der Europäischen Gesundheitsunion
Die als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie angestrebte EGU beruht derzeit auf sieben Initiativen. Bei den fünf bereits umgesetzten Initiativen handelt es sich um die neue Verordnung über grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren,28 die erweiterten Mandate des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC)29 und der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA),30 die neu geschaffene Behörde für die Krisenvorsorge und ‑reaktion bei gesundheitlichen Notlagen (HERA)31 und das Förderprogramm EU4Health.32 Weitere Initiativen sind die Überarbeitung des Arzneimittelrechts mittels einer Verordnung33 und einer Richtlinie34 sowie die Schaffung des Europäischen Gesundheitsdatenraums (EHDS).35 Grundsätzlich lässt sich mit Blick auf diese Initiativen festhalten, dass die EU und die Mitgliedstaaten im Sinne neofunktionalistischer Integrationstheorien auf durch Integration verursachte Probleme mit verstärkter Integration reagiert haben, dabei aber auf existierenden Strukturen und Instrumenten aufbauen, anstatt umfassend neue Kompetenzen und Elemente supranationalen Regierens zu schaffen.36 Krisengetriebene »Spill-over-Effekte«, die den Grad an Integration im Gesundheitsbereich substantiell verändern würden, sind damit nicht gegeben.
Durch die im November 2022 verabschiedete Verordnung zu grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren kann die EU Gesundheitsnotfälle erklären und nationale Notfallpläne überprüfen. Kommt es zur Erklärung eines Notfalls, geben die Mitgliedstaaten ihre Autonomie zur Verhandlung von Kaufverträgen für medizinische Güter und Mittel auf und verpflichten sich, dem ECDC alle relevanten Informationen zur identifizierten Gesundheitsgefahr zu übermitteln. Zudem kann das ECDC gegenüber den Mitgliedstaaten unverbindliche Empfehlungen aussprechen. Während diese Empfehlungen und die Pflicht zur Informationsübermittlung durchaus bedeutende Schritte sind und supranationalen Charakter haben, stellen sie keine substantielle Kompetenzerweiterung und auch kein neues Element supranationaler Steuerung dar, da die Mitgliedstaaten weiterhin ihre jeweiligen Reaktionen auf Gefahren für die öffentliche Gesundheit unabhängig vom ECDC festlegen.
Gleiches gilt auch für die EMA, deren neue Aufgaben zur Überwachung und Bekämpfung von Engpässen bei der Versorgung mit medizinischen Gütern in Notfallsituationen supranational geregelt sind. Aufgrund der Unverbindlichkeit und der Beschränkungen ist aber auch hier keine qualitative Veränderung der Integration festzustellen.
Ebenso wenig lässt sich ein solcher qualitativer Wandel mit Blick auf die Schaffung von HERA konstatieren. Zentrale Aufgabe von HERA wird es sein, in zwei Arbeitsmodi (Vorsorge und Krisenreaktion) die Entwicklung, Herstellung und Verteilung von Arzneimitteln, Impfstoffen und anderen medizinischen Gegenmaßnahmen innerhalb der EU zu sichern.37 Bei der Einrichtung von HERA rangen die Mitgliedstaaten über das Europäische Parlament um mehr Transparenz und Mitbestimmung sowie um größere Unabhängigkeit von der Kommission. Letztlich wurde HERA dennoch als Generaldirektion mit wenig Kontrolle durch das Parlament installiert. Damit ist diese Initiative bei der supranationalen Kommission angesiedelt, wobei die Mitgliedstaaten – für eine Generaldirektion unüblich – zumindest über das Health Crisis Board eingebunden sind. Zwar hat die EU durch die Schaffung von HERA neue Befugnisse erhalten, ihre Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Mitgliedstaaten sind dennoch relativ gering. Vielmehr drückt sich in HERA die unterstützende und koordinierende Tätigkeit der EU in gesundheitlichen Notlagen aus.
Ungeachtet dessen haben sich die Mitgliedstaaten für den Fall der Erklärung einer grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahr zu einer gemeinsamen Beschaffung von Impfstoffen verpflichtet – eine Lehre aus der Covid-19-Pandemie. Auch wenn bereits die gemeinsame Beschaffung von Impfstoffen in der Pandemie eine rechtliche Grundlage hatte, bedurfte es einer besseren Regulierung, da das Europäische Parlament nach der alten Rechtsgrundlage nicht eingebunden war und Mitgliedstaaten sich lediglich ad hoc dazu verpflichteten, keine parallelen Verhandlungen mit Herstellern zu führen. Die Entscheidungsbefugnisse der EU sind nun aber spezifisch auf grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren beschränkt, wobei offen ist, ob sich Mitgliedstaaten auch an ihre Verpflichtungen halten werden. Beim Kauf von Impfstoffen gegen das Mpox-Virus beispielsweise hat sich Frankreich bereits gegen eine gemeinsame Beschaffung durch HERA entschieden.38
Einen noch größeren Gestaltungsspielraum bzw. Rahmen für Einwirkung auf Mitgliedstaaten bietet das EU4Health-Programm mit einem Gesamtbudget von 5,3 Milliarden Euro, da 20 Prozent dieser Mittel für Gesundheitsversorgung vorgesehen sind. Das Programm hat ein deutlich größeres Volumen als das vorangehende dritte Gesundheitsprogramm, das nur knapp 450 Millionen Euro zur Verfügung hatte. Mit den neuen Mitteln könnte das Programm den Grundstein für die stärkere Integration der Gesundheitssysteme, den koordinierten Umgang mit Impfstoffen, die Übermittlung standardisierter Gesundheitsdaten und die Überwachung von Notfallplänen legen.39
Die bisherigen Initiativen im Rahmen der EGU bedeuten keine substantielle Ausweitung supranationalen Handelns.
Sieht man von den jeweils genannten Teilbereichen ab, bewegen sich die bisherigen Initiativen im Rahmen der EGU folglich innerhalb der bestehenden Kompetenzen und stellen keine substantielle Ausweitung supranationalen Handelns dar. Anders gesagt: Die EU kann sich auch weiterhin auf keine geteilte Zuständigkeit im Falle gemeinsamer Sicherheitsanliegen in der öffentlichen Gesundheit stützen und somit auch keine verbindlichen Entscheidungen für die Mitgliedstaaten treffen. Insofern lässt sich nicht behaupten, dass es bereits zu einer qualitativen Veränderung gekommen wäre. Vielmehr stellen die Initiativen eine Fortschreibung bisheriger Integration im Rahmen der Verträge und in engem Zusammenhang mit dem Erhalt der Funktionsweise des Binnenmarkts dar. Wenngleich diese Schritte in Richtung EGU also keineswegs auf instabiler primärrechtlicher Basis, sprich EUV und AEUV, erfolgt sind, so könnten die noch nicht umgesetzten und derzeit diskutierten Elemente der EGU doch sehr wohl noch substantielle Kompetenz- und damit Vertragsänderungen erfordern.
Notwendigkeit von Vertragsänderungen?
Eine Vertragsänderung könnte der EU größere Kompetenzen im Gesundheitsbereich übertragen, sodass sich ihr Handlungsspielraum erweitern würde. Dabei wäre erneut zwischen öffentlicher Gesundheit und Gesundheitsversorgung zu unterscheiden. Die bisher verabschiedeten Elemente der EGU stehen grundsätzlich nur im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit und klammern zum Teil explizit ein Eingreifen in die nationale Gesundheitsversorgung aus, da das Vertragsrecht dem Handeln der EU hier klare und enge Grenzen setzt. Dementsprechend ist auch der Weg zur Übertragung von mehr Kompetenzen im Bereich öffentlicher Gesundheit deutlich einfacher zu beschreiten als im Bereich der Gesundheitsversorgung.
Die Übertragung von mehr Kompetenzen in der öffentlichen Gesundheit wäre insbesondere dadurch möglich, dass man den Bereich vertragsrechtlich von einer größtenteils unterstützenden in eine geteilte Zuständigkeit überführt.40 Hierzu müsste die Formel »Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit« aus Artikel 6 AEUV in die Auflistung unter Artikel 4 AEUV eingefügt werden.41 Je nach konkretem Umfang wäre zudem öffentliche Gesundheit aus dem Harmonisierungsverbot gemäß Artikel 2 Absatz 5 AEUV auszuklammern.
Die Frage ist jedoch, ob solche Kompetenzerweiterungen überhaupt nötig sind, um weitere Initiativen auf dem Weg zu einer effektiven EGU umzusetzen, bzw. welche Defizite in den Gesetzgebungskompetenzen und Handlungsressourcen durch die Vertragsänderungen eigentlich überwunden werden sollen. In den Diskussionen über eine Erweiterung des Handlungsspielraums werden konkrete neue Aufgaben meist zu wenig beleuchtet. Die Stoßrichtung ist hier häufig allgemeiner Natur und geht mehr oder weniger davon aus, dass eine geteilte Zuständigkeit für öffentliche Gesundheit eine bessere rechtliche Basis für das Handeln der EU darstellen würde als der häufige Rückgriff auf die Kompetenzen zum Binnenmarkt aus Artikel 114 AEUV. So könnte die EU in Feldern tätig werden, die bislang klar außerhalb des Anwendungsbereichs von Artikel 114 AEUV liegen. Mögliche Beispiele wären ein EU-weites Rauchverbot in Bars und Restaurants42 sowie ein Verbot von E‑Zigaretten.
Es ist jedoch zweifelhaft, ob solche Maßnahmen den Kern der EGU ausmachen sollten. Vielmehr kommt es, wie zuvor diskutiert, beim Aufbau der EGU darauf an, für einen gemeinsamen Handlungsrahmen von Mitgliedstaaten in der grenzüberschreitenden öffentlichen Gesundheit und bei der Schaffung resilienter Gesundheitssysteme zu sorgen. Was die öffentliche Gesundheit angeht, so bieten die skizzierten Elemente der EGU bereits eine solide Grundlage für einen gemeinsamen Handlungsrahmen, der jedoch weiter ausgebaut werden muss. Vor allem dem schnellen und umfangreichen Austausch von Daten kommt dabei eine enorme Bedeutung zu. Zwar haben die Mitgliedstaaten durch die Verordnung zu grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren und die Erweiterung des Mandats des ECDC mittlerweile Meldepflichten gegenüber dem ECDC, doch fehlt in den einschlägigen Verordnungen die explizite Pflicht, Daten schnell zu übermitteln – etwa über nicht pharmazeutische Interventionen, wie etwa Lockdowns –, und zwar in einer vom ECDC vorgegebenen standardisierten Form. Nur mit entsprechenden standardisierten Daten kann das ECDC sein Mandat vollständig erfüllen und den Mitgliedstaaten Handlungsempfehlungen geben. Aus vertragsrechtlicher Perspektive spricht nichts gegen eine solche Verpflichtung im Bereich öffentlicher Gesundheit, da sich schon jetzt, gestützt auf Artikel 168 AEUV, vielfältige Mitwirkungspflichten aus der Verordnung zu grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen ergeben.43
Während man also durchaus vom Aufbau eines gemeinsamen Handlungsrahmens zur Sicherung der grenzüberschreitenden öffentlichen Gesundheit sprechen kann, findet die Stärkung von Gesundheitssystemen und die damit zusammenhängende Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung noch zu wenig Beachtung. Gerade auf diese kommt es aber bei der Schaffung einer Gesundheitsunion an. Nach wie vor existieren zwischen den Bevölkerungen älterer und neuerer Mitgliedstaaten deutliche Unterschiede in der Lebenserwartung und bei der Häufigkeit chronischer Erkrankungen.44 Sie sind Ausdruck von Gesundheitsungleichheiten, die sowohl zwischen als auch innerhalb von Mitgliedstaaten bestehen und im Verlauf der Pandemie zu markanten Divergenzen in der Übersterblichkeit geführt haben.45 Auch diese Unterschiede müssen im Rahmen des Aufbaus einer EGU angegangen werden, zumal mangelnde Gesundheitsversorgung schnell auch mit grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren einhergeht.
Die Abwesenheit expliziter Regelungen zur Gesundheitsversorgung lässt sich damit begründen, dass der EU in diesem Bereich vertragsrechtlich enge Grenzen gesetzt sind. Dennoch kann auch hier noch stärker als bisher auf die Mitgliedstaaten eingewirkt werden. Eine Möglichkeit wäre die systematische Nutzung von EU4Health sowie von Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds). EU4Health hat unter anderem spezifisch die Stärkung von Gesundheitssystemen zum Ziel.46 ESI-Fonds wiederum können dies dadurch flankieren, dass sie einerseits den Aufbau und die Weiterentwicklung medizinischer Infrastruktur unterstützen und andererseits auf die ökonomischen Determinanten von Gesundheit einwirken.47 Die EU sollte hier stärker koordinierend in Erscheinung treten, indem sie etwa länderspezifisch Investitionsbedarf identifiziert und Mitgliedstaaten beim Einreichen von Förderanträgen und bei der Verzahnung verschiedener Förderinstrumente unterstützt. Letzteres ist notwendig, da etwa die EU4Health-Projekte wenige bis keine Querbezüge zu dem ebenfalls für die öffentliche Gesundheit und Gesundheitsversorgung relevanten Europäischen Struktur- und Investitionsfonds aufweisen.
Eine weitere Möglichkeit zur Schaffung eines gemeinsamen Handlungsrahmens in der Gesundheitsversorgung bietet der EHDS. Dieser soll – in der gegenwärtig anvisierten Version – Patientinnen und Patienten die Hoheit über ihre digitalen Gesundheitsdaten in einer europaweit standardisierten Form geben. Im besten Fall könnten sich Erkrankte dann mit ihrer digitalen Akte in allen EU-Mitgliedstaaten behandeln lassen, wobei die medizinische Vorgeschichte in die jeweilige Landesprache des behandelnden Personals standardisiert übersetzt würde. Die Befunde würden dann ebenfalls digital hinterlegt, sodass behandelnde Ärztinnen und Ärzte im Heimatland problemlos Diagnosen einsehen könnten.
Die EU muss eine Strategie entwickeln, mit der sich Gesundheitsungleichheiten im Rahmen der EGU überwinden lassen, ohne primärrechtliche Grenzen zu überschreiten.
Letztlich bietet auch das Europäische Semester durch die CSR eine Möglichkeit, auf die Gesundheitspolitik der Mitgliedstaaten einzuwirken. Die CSR können vertragskonform sehr spezifische, aber unverbindliche Vorschläge zur effizienten Organisation – und damit Harmonisierung – von Gesundheitssystemen enthalten.48 Verbindlichere Regelungen für Investitionen in Gesundheitssysteme und in den Abbau von Gesundheitsungleichheiten sind derzeit dagegen alleine aus politischen Gründen nicht realisierbar, da Gesundheitsversorgung elementar mit staatlichen Wohlfahrtsregimen verknüpft ist,49 was der EU auf lange Sicht größeren Einfluss verwehren wird. Ungeachtet dessen sollte bzw. muss die EU eine Strategie entwickeln und Möglichkeiten eruieren, wie durch systematische Empfehlungen und Investitionsanreize für Mitgliedstaaten Gesundheitsungleichheiten im Rahmen der EGU überwunden werden können, ohne dass sie dabei die primärrechtlichen Grenzen überschreitet. Nur so sind resiliente Gesundheitssysteme in der EU zu realisieren und lässt sich eine effektive EGU aufbauen.
Wege zu einer effektiven Gesundheitsunion
Der Aufbau einer effektiven EGU wird im Kern mit der Schaffung eines gemeinsamen Handlungsrahmens in Belangen der grenzüberschreitenden öffentlichen Gesundheit sowie der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung einhergehen müssen. Ungeachtet ihrer beschränkten Kompetenzen hat die EU bereits deutlich vor der Covid-19-Pandemie und dem Aufbau der EGU Rechtsakte erlassen, die als Meilensteine in der Errichtung eines solchen gemeinsamen Handlungsrahmens anzusehen sind. Die existierenden Ansätze wurden dann durch die neuen Initiativen während der Pandemie ausgebaut und um erweiterte Mandate für ECDC und EMA, die Behörde HERA und einen verbindlicheren Handlungsrahmen im Falle gesundheitlicher Notlagen ergänzt. Durch die Einführung nur weniger neuer supranationaler Elemente stehen die oben diskutierten Initiativen eher im Kontext einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der EU-Gesundheitspolitik vor der Pandemie, als dass sie den Kompetenzrahmen qualitativ erweitert hätten. Darüber hinaus beschränken sich die genannten Erweiterungen in der Gesundheitspolitik auf den Bereich der öffentlichen Gesundheit. Die Gesundheitssysteme und die damit zusammenhängende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung bleiben aufgrund politischer Vorbehalte nach wie vor weitgehend unintegriert.
Die EU kann den Aufbau der EGU für den Bereich der öffentlichen Gesundheit weiterhin im Rahmen ihrer Kompetenzen vorantreiben.
Was die zentrale Frage nach Kompetenzerweiterungen auf dem Weg zu einer effektiven EGU angeht, so zeigen die Ausführungen, dass die EU den Aufbau der EGU für den Bereich der öffentlichen Gesundheit wie bisher im Rahmen ihrer Kompetenzen vorantreiben kann. Zu denken ist hier vor allem an Verbesserungen bei der Datensammlung und an eine funktionale Integration des EHDS in diese Sammlung. Zwar ließe sich öffentliche Gesundheit vollständig, also nicht nur beschränkt auf die gemeinsamen Sicherheitsanliegen, als geteilte Zuständigkeit einrichten, es bleibt jedoch unklar, welche konkreten Politikmaßnahmen diesbezüglich verfolgt werden sollten und der EGU unmittelbar dienlich wären.
Ein größerer Handlungsspielraum der EU im Bereich der Gesundheitsversorgung könnte dazu beitragen, Gesundheitsungleichheiten in der EU zu überwinden. Doch ist eine solche Kompetenzausweitung aus politischer Perspektive derzeit nicht denkbar. Dennoch sollte die EU eine Strategie entwickeln, um systematisch auf eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung, die Überwindung gesundheitlicher Ungleichheiten durch EU-Fonds sowie eine stärkere Koordination durch intensivere Nutzung von CSR hinzuwirken. Eine solche Strategie ließe sich vor allem damit begründen, dass die EU in der Bekämpfung von Gesundheitsbedrohungen nur so stark ist wie ihre schwächsten Mitgliedstaaten und Regionen.
Beim derzeitigen Stand der Integration und mit Blick auf nächste Schritte im Aufbau der EGU erscheint eine Erweiterung der Kompetenzen daher nachrangig. Vielmehr sollte der Handlungsspielraum effizienter genutzt werden, um die neuen Elemente bzw. Initiativen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit umzusetzen und die Gesundheitsversorgung innerhalb der EU zu verbessern. Konkret bieten sich als nächste Schritte an, das Mandat des ECDC mit weiteren Initiativen zur Erhebung von Gesundheitsdaten im Rahmen des EHDS flankierend zu unterstützen und eine Strategie zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung sowohl durch systematische Identifikation von Schwächen als auch durch gezielte Förderung mittels EU-Fonds und CSR zu entwickeln.
Neofunktionalistische Mechanismen der digitalen Agenda: Von der Digitalmarktintegration zur externen Wirkung europäischer Cyberpolitiken
Der Anspruch der digitalen Souveränität und die digitale Agenda
Sicherung von Wohlstand und sozialem Frieden durch Wirtschaftswachstum sowie das Streben nach europäischer Souveränität1 sind die Kernanliegen der europäischen Digitalstrategie. Durch die offensiv genutzte Marktregulierungskompetenz der Europäischen Kommission (EK) hat sich die digitale Selbstbehauptung der Europäischen Union (EU) spätestens seit 2015 zu einer zentralen Integrationspolitik entwickelt, die sowohl markt- und innenpolitische als auch außen- und sicherheitspolitische Dimensionen umfasst. Die gegenwärtig amtierende »geopolitische Kommission«2 hat Digitalisierung und Ökologisierung zum Kernprojekt erhoben und beide in ihrer Wachstumsstrategie des European Green Deal sowie im mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 2021 bis 2027 und dem damit verknüpften Wiederaufbaufonds NextGenerationEU (NGEU) verankert.3 Dabei ist die digitale Integration eng mit der Selbstbehauptung Europas verflochten, nach innen gegenüber den einzelnen Mitgliedstaaten sowie nach außen gegenüber Drittstaaten wie den USA und der Volksrepublik (VR) China.
Integrationspolitisch lassen sich Strategie und Wirkung der digitalen Agenda der EU durch die Folie des Neofunktionalismus (Ernst B. Haas) plausibilisieren: Europas digitale Integration folgt einer Spill-over-Logik, also dem »Überspringen« von Integrationsbedarf aus einem Sektor in einen angrenzenden Sektor, etwa von der Binnenmarktintegration über Verbraucherschutz hin zu Cybersicherheit.
Die europäischen Verträge enthalten keine expliziten Zielsetzungen für die digitale Agenda oder für Cyber- bzw. Technologiegovernance, daher beruft sich die EK für Regulierungsinitiativen auf übergeordnete sektorale und horizontale Politiken, insbesondere aus dem Bereich des Binnenmarkts.4 So bezieht sich etwa die Richtlinie über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cyberniveau (NIS-2-Direktive) auf Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), also auf die Angleichung einzelstaatlicher Vorschriften zur Überwindung bzw. Vermeidung einer Binnenmarktfragmentierung.5
Geopolitische Ausgangsbedingungen und zentrale Konfliktlinien
Drei Charakteristika digitaler Technologien fordern die staatliche Souveränität im Cyberraum heraus: transnationaler Charakter, »Dual-Use«-Problematik sowie »Unteilbarkeit.« Vom Dual-Use-Charakter einer Technologie spricht man, wenn diese Technologie sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden kann; der Begriff »unteilbar« meint, dass große Technologiefirmen aus Kostengründen nur einen Produktstandard für verschiedene Märkte vorhalten können.6 Staaten und die EU verlieren dadurch relativ an Macht und der Fähigkeit, ihre Normen7 bei der Kontrolle von (grenzüberschreitenden) Informations-, Geld- und Warenflüssen durchzusetzen; große Technologieunternehmen sowie digitale Akteure dagegen gewinnen an Gestaltungsmöglichkeiten. Grafik 1 stellt die zentralen Souveränitätsträger im digitalen Raum dar und illustriert ihre bevorzugten Governance-Ansätze.
Die digitale Integration folgt der Idee des Supranationalismus.
Im Bestreben, (globale) Cybergovernance zu betreiben und durch die Etablierung der eigenen Normen Kontrolle im digitalen Raum auszuüben oder zurückzuerlangen, verfolgen Staaten oft den Ansatz der Normdiffusion: der Externalisierung der eigenen Normen.8 Auch europäische Institutionen, allen voran die EK, nutzen die transnationale und unteilbare Natur digitaler Technologien zur Rückerlangung von Gestaltungsmacht durch Normdiffusion; als Mittel dient ihnen dabei das Politisieren der Binnenmarktprinzipien: Marktzugang erhält nur, wer die vom europäischen Ansatz vorgegebenen Regeln der Internetgovernance einhält – und da dieser Ansatz oft die international höchsten bzw. striktesten Standards umfasst, beispielsweise im Datenschutz, werden diese internen Prinzipien aufgrund der Unteilbarkeit digitaler Technologien externalisiert. Damit bestimmt die EK auch die Governanceproblematik im Innern: Durch Binnenmarktintegration und Direktwirkung europäischen Rechts werden Kompetenzen in der Technologiegovernance aus den Hauptstädten nach Brüssel übertragen. Die digitale Integration folgt also der Idee des Supranationalismus: Europäische Eliten aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft treiben die Idee der informationellen Selbstbestimmung Europas maßgeblich über die EK voran, im Bewusstsein der integrationsvertiefenden Wirkung europäischen Rechts sowie der internationalen Regulierungsmacht der EU. Damit entfalten die ideelle und funktionale Dimension der Integration eine Wechselwirkung. Die EU-Institutionen verfolgen dabei mit ihren Integrationsbemühungen zunehmend eigene Machtinteressen wie das Erweitern ihres Kompetenzspielraums, die teils im Widerspruch zu internationalen Sorgfaltspflichten wie der Gewährung von Rechtssicherheit stehen (etwa im Falle des transatlantischen Datenaustausches). Zudem ergeben sich Konflikte mit den Mitgliedstaaten, wie der folgende Abschnitt am Beispiel des Konnektivitätsausbaus zeigen wird.
Innerhalb der EU stellt der Umgang mit digitalen Angeboten aus autoritären Staaten, insbesondere der VR China, eine zentrale Konfliktlinie dar. Die Volksrepublik bietet schnelle Verbesserung der (nationalen) Konnektivität, was jedoch eine Abhängigkeit von chinesischem Systemstandards und Know-how bedeutet und angesichts der Dual-Use-Problematik und der transnationalen Natur digitaler Technologien die Infrastrukturresilienz der Gefahr von Spionage oder Sabotage aussetzt. In der EU ist die Abhängigkeit von chinesischen Digitalprodukten weit verbreitet, der Umgang mit chinesischer Beteiligung an Digitalunternehmen und Infrastruktur für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) ist fragmentiert. So sind beispielsweise 76 Prozent der rumänischen, 59 Prozent der deutschen und 17 Prozent der französischen 5G-RAN-Infrastruktur (also der Funkzugangsnetze) mithilfe chinesischer Komponenten bereitgestellt worden; in der Tschechischen Republik, Schweden oder den baltischen Staaten hingegen sind es null Prozent.9 Dafür sind sowohl politische als auch ökonomische Überlegungen ausschlaggebend; so hat sich Tschechiens größter Betreiber digitaler Infrastrukturen CETIN gegen eine Kooperation mit Huawei entschieden, im Interesse der unternehmerischen Sicherheit und ohne politische Maßgaben.10 In Schweden dagegen wurde die Beteiligung chinesischer Firmen am Netzausbau gesetzlich verboten.11 Ein Mittelweg, wie ihn die Bundesrepublik Deutschland gehen wollte, hat sich als nicht praktikabel erwiesen; nun wollen einzelne Firmen in Erwartung eines nationalen Verbots (kosten-)aufwendig bis Ende 2028 alles bereits verbaute Equipment von Huawei wieder aus ihrer physischen Digitalinfrastruktur entfernen.12 Die Tatsache, dass die Bundesregierung die 2020 erlassenen (nichtbindenden) EU-Richtlinien aus der Toolbox für sichere 5G-Netze nicht zur Anwendung brachte, hat ihr Kritik der EK eingebracht.13 Auch andere EU-Mitgliedstaaten halten an der Kooperation mit chinesischen IKT-Unternehmen fest; mittlerweile diskutiert die EK daher ein bindendes Verbot,14 das durchzusetzen jedoch schwierig sein dürfte, da in den Mitgliedstaaten die Abhängigkeit von chinesischer Technologie, der Zugang zu Alternativen, die Einbettung von Technologiegovernance in die nationale Außenpolitik sowie die Positionierung gegenüber der VR China ebenfalls variieren.
Auch auf internationaler Ebene gibt es verschiedene Konfliktlinien: Autoritäre Staaten bevorzugen einen zentralen Ansatz der Cybergovernance, der einseitige Abhängigkeiten von Systemstandards und vor allem von Unternehmen schafft, die mehr oder weniger direkt als außenpolitisches Instrument der Exekutive fungieren.15 Entsprechend musste sich Schweden etwa mit einer Klage Huaweis gegen dessen Ausschluss vom Konnektivitätsausbau auseinandersetzen – der Konzern unterlag, da Huawei eben kein privater Marktakteur, sondern eng mit der Kommunistischen Partei Chinas und dem chinesischen Militär verflochten ist.16 Auch im Falle eines EU-Gesetzes zum Verbot der Kooperation mit chinesischen IKT-Unternehmen wäre mit Klagen zu rechnen.17
Das Bemühen um einen »europäischen Weg« zwischen den USA und der VR China ist auch Ausdruck von Integrationsbestrebungen der EU‑Institutionen.
Zwischen demokratischen Akteuren kommt es ebenfalls zu Konflikten, vor allem, da es der EU selbst an erfolgreichen Digitalunternehmen mangelt, sie gegenüber Firmen – oft aus den USA –, die digitale Produkte anbieten, allerdings mitunter sehr konfrontativ auftritt. Dieses Bemühen, einen »europäischen Weg« zwischen den USA und der VR China zu finden, ist auch Ausdruck von Integrationsbestrebungen der EU-Institutionen, welche zur Geschlossenheit der EU mahnen, damit diese als Ganze auf die großen Marktakteure Einfluss nehmen bzw. sich zwischen den beiden Polen USA und VR China behaupten kann. Die transatlantischen Konflikte betreffen vor allem die Diffusion europäischer Normen in den amerikanischen Markt, außerdem werfen sich beide Seiten Protektionismus18 angesichts von Förderprogrammen vor, die explizit der nationalen bzw. europäischen Kapazitätsentwicklung dienen, etwa durch Investitionen in die Halbleiterindustrie. Dennoch verfolgen sowohl die EU als auch die USA das Ziel, im Rahmen einer »Allianz für demokratische Technologie« in Forschung und Entwicklung (FuE) zu investieren und Dispute in Institutionen wie dem EU-US-Handels- und Technologierat zu thematisieren, anstatt gezielt Abhängigkeiten in Schlüsselbereichen wie Semikonduktoren zu schaffen und Sanktionsregime wie in der Aluminium- und Stahlindustrie zu etablieren.
Dass das Setzen klarer Richtlinien bei Aufrechterhalten von Gesprächsbereitschaft und dem Angebot von Rechtssicherheit funktionieren kann, das durch demokratische Prinzipien garantiert wird, zeigen die Reaktionen großer US-amerikanischer Unternehmen: Beispielsweise leitete die EK 2015 ein Kartellverfahren unter anderem wegen Vorwürfen der manipulierten Anzeige von Suchergebnissen gegen Google ein; dessen Verurteilung wurde 2022 vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) bestätigt. Google passte sein Geschäftsmodell noch während des laufenden Prozesses an19 und sucht bei der Weiterentwicklung seines Produktportfolios nun schon im Vorfeld Zugang zur Mitgestaltung europäischer Cyberpolitiken.20 Diese Entwicklung unterstreicht einmal mehr den Einfluss europäischer legislativer Aktivitäten auf (einflussreiche) externe Akteure; EU-Institutionen wie die EK und der EuGH sind sich dessen durchaus bewusst und nutzen dies zur externen Selbstbehauptung der EU sowie zur Vertiefung der europäischen Integration.
Legislative Aktivitäten im Rahmen der vier Großprojekte der digitalen Integration
Eine zentrale Rolle für die europäische digitale Integration nimmt die Rechtsprechung des EuGH zum Datenschutz ein. Die Enthüllungen Edward Snowdens über Massendatenspeicherungen lösten 2013 eine transatlantische Vertrauenskrise aus und führten zu einer Reihe von Prozessen gegen US-amerikanische Unternehmen aufgrund mangelhaften Schutzes privater Daten. Im Jahr 201421 erklärte der EuGH die damalige Richtlinie für Datenvorratsspeicherung für unzulässig; im Jahr darauf wurde das transatlantische Datenschutzabkommen »SafeHarbor« für unzureichend befunden.22 Es folgte eine Vielzahl von EU-Rechtsakten, die auf den verschiedenen Ebenen des transatlantischen Datentransfers in seiner wirtschaftlichen, aber auch juristischen Dimension neue Anpassungen notwendig machten, weil die Staatenpraxis unvereinbar mit europäischen Standards war. Die digitale Selbstbehauptung der EU hat seither einen festen Platz auf der Agenda des Europäischen Rats (siehe Grafik 2). Durch diesen exogenen Konflikt – Marktdominanz US-amerikanischer Unternehmen sowie erwiesener missbräuchlicher Umgang mit europäischen Nutzerdaten – wurde die endogene Entwicklung der digitalen Integration mittels der Verabschiedung diverser Rechtsakte beschleunigt. Sie hatte gleichzeitig den Nebeneffekt, dass externe Akteure durch das Instrument der europäischen Marktmacht beeinflusst wurden (»Brüssel-Effekt«).23
Die seit 2018 anwendbare Datenschutzgrundverordnung24 (DSGVO) stellt einen entscheidenden Integrationsschritt und ein innovatives Regulierungsinstrument dar, das sowohl Macht als auch Grenzen des Brüssel-Effekts verdeutlicht. So haben US-amerikanische Unternehmen gemeinsam ein föderales US-Datenschutzrecht nach Vorbild der DSGVO gefordert, gleichzeitig gelang es der EK lange nicht, ein rechtssicheres Abkommen für den transatlantischen Datentransfer zu erarbeiten.25 Zentral sind zudem das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) sowie das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA), die im Februar 2024 voll in Kraft traten. Das DMA soll Transparenz und Wettbewerbsgerechtigkeit entlang der Lieferkette erhöhen, indem »große, systemische Online-Plattformen«, sogenannte Gatekeeper, reguliert werden – bei denen es sich zum großen Teil um US-amerikanische Unternehmen wie Meta oder Amazon handelt.26 Indessen umfasst das DSA eine Pflicht zur Auskunft über die Speicherung und Kommerzialisierung von Nutzerdaten sowie konkrete Nutzungsbedingungen, die Maßnahmen zum Schutz vor Desinformation und Belästigung enthalten müssen. Eine Verknüpfung negativer Integration durch Marktregulierung mit positiver Integration im Hinblick auf informationelle Selbstbestimmung ist hier also erkennbar.
Neben der oben beschriebenen Datengovernance stehen drei weitere digitalpolitische Großprojekte auf der digitalen Agenda der EU: Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Kapazitätsentwicklung in Schlüsseltechnologien.
Spill-over-Effekte sind gerade mit Blick auf die digitale Agenda nicht auf den innereuropäischen Raum begrenzt.
Im Bereich des Großprojekts Cybersicherheit wurde 2019 mit der Erteilung eines dauerhaften Mandats für die seit 2004 bestehende EU-Cybersicherheitsagentur (ENISA) ein wichtiger Integrationsschritt vollzogen.27 Im selben Jahr erfolgte außerdem erstmals eine Festlegung einheitlicher Zertifizierungsnormen für IKT-Produkte auf dem europäischen Markt.28 Neben negativer Integration wurde auch positive Integration betrieben: Die EK veröffentlichte im Januar 2020 eine Toolbox für sichere 5G-Netze,29 die zwar keine bindenden Vorschriften umfasst, dafür aber signalisiert, dass Technologiegovernance nun auch in der EU aus sicherheits- bzw. außenpolitischer Perspektive gedacht wird. Dieser außen- und sicherheitspolitische Anspruch der digitalen Agenda bzw. der EK wird zudem durch die EU Cyber Posture unterstrichen, in der festgehalten ist, dass die EU im geopolitischen Wettbewerb die Verwirklichung ihrer Vision von einem sicheren und kooperativen digitalen Raum vorantreiben möchte.30 Spill-over-Effekte sind also gerade mit Blick auf die digitale Agenda nicht auf den innereuropäischen Raum begrenzt, vielmehr besteht eine klare Intention, Recht und Normen der EU-Digitalpolitik auch zu externalisieren. Zudem lässt sich ein Spill-over von Binnenmarktintegration auf die digitale Diplomatie feststellen, soll doch etwa die ENISA sowohl das Einhalten europäischer Zertifizierungsstandards für IKT-Equipment prüfen als auch konkrete Handlungsempfehlungen zum Ausbau der europäischen Cyberkompetenzen ausarbeiten, einschließlich aktiver Cyberabwehr.
Im EU-Großprojekt digitale Infrastruktur kommt eine veränderte Wahrnehmung der Bedrohung und Resilienz solcher Infrastrukturen in der NIS-Richtlinie aus dem Jahr 2016 zum Ausdruck, der Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit.31 Anfang 2023 traten mit der NIS-2-Richtlinie die überholte Fassung und ergänzend die CER-Richtlinie (Critical Entities Resilience)32 zum Schutz vulnerabler Infrastrukturen in Kraft. Während die NIS-Richtlinie im Sinne negativer Integration bereits Betreiber und Anbieter digitaler Dienste dazu verpflichtete, technische und organisatorische Mindeststandards zur Sicherung ihrer Netzwerke und Nutzerdaten einzuhalten, werden nunmehr ganz im Sinne positiver Integration Mitgliedstaaten in die Pflicht genommen, eine nationale Sicherheitsbehörde für Netz- und Informationssicherheit zu benennen sowie zur europäischen Cybersicherheit durch Austausch und Koordinierung beizutragen.33 Damit versucht die EK auch, eine europäische (digitale) Sicherheitskultur zu etablieren, die wiederum ihre eigenen Kompetenzen in der Digital- und Sicherheitspolitik und in der Folge ihre externe Durchsetzungskraft stärkt.
Im Kontext des Großprojekts Schlüsseltechnologien ist das Gesetz über Künstliche Intelligenz (KI) aus dem Jahr 2021 hervorzuheben (Artificial Intelligence Act);34 im März 2024 nahm das Europäische Parlament den AI Act an,35 bei dem es sich um den weltweit ersten Rechtsrahmen für KI-Technologien handelt: Diese sollen erst nach erfolgter Risikobewertung auf dem europäischen Markt verfügbar sein. Vorangegangen waren längere Debatten, ob das Gesetz nicht investitionshemmend und damit kontraproduktiv sei.36 Im Spannungsfeld zwischen dem angestrebten Aufbau europäischer Kapazitäten und negativen Folgen einer protektionistischen Politik wird auch das europäische Chip-Gesetz (European Chips Act) von 2022 diskutiert.37 Es soll Investitionen in europäische Semikonduktor-FuE befördern und dem Ausbau von Halbleiterproduktionskapazitäten in der EU dienen.
EU-Rechtsvorschriften zur digitalen Agenda umfassen viele Soft-Law-Instrumente.
Betrachtet man die Zahl der EU-Rechtsvorschriften zur digitalen Agenda seit 2010, so ist diese zwar gestiegen, allerdings sind viele Soft-Law-Instrumente wie die Empfehlungen zur 5G-Toolbox darunter (siehe Grafik 3). Im Rahmen jedes dieser vier Großprojekte haben seit 2009 – aufbauend auf neofunktionalistischen Mechanismen – entscheidende Integrationsschritte stattgefunden. Manche dienen dazu, zunehmend die interne und externe (digitale) Souveränität der EU zu behaupten, insbesondere diejenigen, die sich durch die Einigung auf Hard-Law-Instrumente ausdrücken. Andere, die auf Soft-Law-Instrumenten beruhen, demonstrieren lediglich Entschlossenheit, mittels der digitalen Agenda europäische Souveränität (wieder) zu erlangen. »Digitale Souveränität« ist eben kein klar definiertes Konzept – im Bereich Datensouveränität etwa hat die EU durch Ausspielen ihrer Marktmacht deutliche Fortschritte erzielen können, in Fragen der Cybersicherheit kritischer Infrastrukturen dagegen ist die Rolle der EU auf die Erfassung von Risiken, den Kapazitätsaufbau und die internationale Normensetzung begrenzt. In diesem Bereich dominieren nichtbindende EU-Richtlinien und inkohärente, sich teils widersprechende EU-Strategiepapiere wie die Globale Strategie 2018 und Global Gateway 2021, die an den konkreten Infrastrukturbedürfnissen der Mitgliedstaaten vorbeigehen und gleichzeitig die Rolle von Technologien für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik nicht ausreichend reflektieren.
Als Integrationsmechanismus der digitalen Agenda kann damit vor allem ein kultivierter38 Spill-over beobachtet werden, der sich bei fehlender konzeptueller Klarheit seitens der EU-Institutionen in fragmentierten Politiken in den Mitgliedstaaten niederschlägt. Solange etwa weiterhin eine klare Definition von »Cybersicherheit«39 fehlt, wird auch die Erfassung von Risiken im Cyber- und Informationsraum inkohärent und lückenhaft bleiben. Dementsprechend sah die EU lange keine Notwendigkeit für eine unionsweite Lageanalyse zum Einfluss chinesischer Technologie auf die IKT-Infrastruktur und reagierte – trotz vieler Warnungen – erst, als dessen negative Konsequenzen bereits deutlich zutage traten.40
Die Digitalisierung wird in den nächsten Jahren weiter voranschreiten, geopolitische Spannungen werden zunehmen; zudem ist nicht klar, wie offen die USA einer Kooperation mit der EU nach den Präsidentschaftswahlen 2024 gegenüberstehen werden. Für die EU und die deutsche Europapolitik ergibt sich daraus eine Reihe von Handlungsempfehlungen.
Gestärkte Handlungsfähigkeit durch Etablieren einer europäischen digitalen (Sicherheits-)Kultur
Auf EU-Ebene werden zwei Vorschläge immer wieder ins Spiel gebracht, um die europäische Integration zu vertiefen: Nutzen der polyzentrischen Governancestruktur und Begreifen der Polykrise als Polychance (poly-opportunity).41 Beide Vorschläge basieren auf dem Verständnis von Spill-over als zentralem europäischen Integrationsmechanismus, nutzen diesen aber mit unterschiedlichem Erfolg. Tatsächlich hat die Europäische Kommission die digitale Integration der EU in den letzten Jahren entschieden vorangetrieben und dabei ihre eigene Position gestärkt. Gleichzeitig ist die europaweite Digitalpolitik eher von Fragmentierung als von Integration gekennzeichnet, da die Ausgangsbedingungen in den Mitgliedstaaten in wichtigen Punkten stark variieren: hinsichtlich Fortschritten in Digitalisierung und Digitalwirtschaft, wirtschaftlicher Abhängigkeit von der VR China sowie außenpolitischen Positionen und Interessen bei der Umsetzung der oftmals nichtbindenden EU-Maßnahmen. Es fehlt an klaren Definitionen der zentralen Begrifflichkeiten sowie an Anreizen zur Implementierung nichtbindender EU-Vorgaben. Im Großprojekt Kapazitätsentwicklung hingegen hat die EK das Konzept der »technologischen Souveränität« schlüssig vermitteln können und zudem einen klaren finanziellen Anreiz zur Umsetzung ihrer Ziele für die digitale Dekade in den Mitgliedstaaten gesetzt: Volumen und Verfügbarkeit von Mitteln aus NextGenerationEU sind an die Vorlage eines nationalen Wiederaufbauplans geknüpft, der entsprechende Vorhaben für Investitionen in Digitalisierungsprojekte und die Beschreibung ihres gesellschaftlichen Nutzens enthalten muss.42
Die digitale Integration übersetzt sich derzeit nicht in eine kohärente Strategie.
Festzuhalten bleibt dennoch, dass die digitale Integration der EU projektbezogen fragmentiert ist und sich derzeit nicht in eine kohärente Strategie übersetzt, in der politische Zielvorgaben deutlich formuliert und deren Nutzen für die Mitgliedstaaten sowie für die Union als Ganze klar herausgearbeitet werden. Dass ein derartiges autoritatives Vorgehen die Handlungsfähigkeit der EU als Ganzer befördern könnte, hat zuletzt die Kommunikation der EK über ein künftig konfrontativeres Auftreten gegenüber chinesischen Unternehmen wie Huawei gezeigt: Als die EU Regeln zur Erhöhung des Cybersicherheitsniveaus vorantrieb, distanzierten sich viele Mitgliedstaaten von bereits begonnenen Huawei-Kooperationen, obwohl dies mit hohen finanziellen Kosten und Verzögerungen im Infrastrukturausbau verbunden war. Motiviert wurde dieser Strategiewechsel in Richtung eines strategischen Abhängigkeitsmanagements zwischen der EU und China vor allem durch zwei Faktoren: negative Erfahrungen in der Kooperation mit chinesischen Partnern (die zum Beispiel Italien bewogen, aus dem Projekt der »neuen Seidenstraße« auszusteigen) und durch neue Sicherheitsbedenken, die der russische Angriff auf die Ukraine ausgelöst hatte.
Wenn sich demokratische Staaten gegenüber autoritären in der globalen Cybergovernance durchsetzen bzw. ihre demokratischen Normen als globalen Standard etablieren wollen, dann bedeutet dies auch, ihre Industriepolitiken mit Digitalpolitiken eng zu verknüpfen – etwa durch den Marktausschluss bestimmter, vor allem chinesischer Firmen. Da es aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtung mit der VR China ratsam ist, nicht eine Entkopplung (de-coupling), sondern die Reduktion von Risiken (de-risking) anzustreben, ist die klare Formulierung und Kommunikation der strategischen Grundlagen solcher Entscheidungen unabdingbar. Dies gilt umso mehr, wenn es um die Beachtung von Sorgfaltspflichten geht, etwa wenn Zulieferer diversifiziert und nur für besonders vulnerable Bereiche – wie eben digitale Infrastruktur – erhebliche Handelseinschränkungen erlassen werden sollen.43 Ohnehin sollte die EU im Rahmen ihrer »offenen strategischen Autonomie« auf Kooperation statt auf Autonomie setzen, denn auch wenn Investitionen in europäische FuE und Kapazitätsentwicklung notwendig sind, wird die EU gerade entlang hochdiversifizierter Lieferketten in der Digitalwirtschaft auf Partner und deren Innovationskraft nicht verzichten können (was umgekehrt auch für diese Partner gilt). Eine wie von der EK betriebene »Politisierung« im Sinne einer »Europäisierung« mit Hang zu protektionistischen Tendenzen hat sich entsprechend bislang eher als kontraproduktiv erwiesen44 – stattdessen wäre die EU gut beraten, fehlende Kapazitäten oder Ressourcen durch Zusammenarbeit mit demokratischen Partnern zu kompensieren und solche Kooperationen zu stärken, die ohne autoritäre Partner auskommen.45
Deutsche Europapolitik unter Bedingungen des Supranationalismus
Auch in der deutschen Europapolitik sollte die Sorgfaltsverantwortung als Prinzip gelten,46 und im Kontext einer langfristigen Strategie der Bundesregierung, die einen generellen Rahmen für die Abwägung sicherheitspolitischer und ökonomischer Interessen eröffnet, sollten Bedrohungen realistisch eingeschätzt werden. So ließen sich Fälle wie der Ausbau des 5G-Netzes mithilfe Huaweis vermeiden, in denen einmal getroffene und ökonomisch motivierte Entscheidungen sich schließlich aus sicherheitspolitischer Perspektive als unhaltbar und damit kostenträchtig erweisen. Die europäische digitale Agenda ist auf zehn Jahre ausgelegt und im Rahmen des bewährten Komitologie-Verfahrens entstanden. Daher sollten sich alle Mitgliedstaaten daran orientieren und auf langfristige, im EU-Rahmen abgestimmte digitale Agenden setzen. Gleichzeitig hat die EK immer wieder deutlich gezeigt, dass sie bereit und in der Lage ist, ihren Kompetenzspielraum voll auszunutzen und so durch kultivierten Spill-over die digitale Integration und damit das Übertragen von Kompetenzen nach Brüssel voranzutreiben. Durch das Erarbeiten und Praktizieren nationaler resilienzstärkender Politiken können wiederum Mitgliedstaaten als Impulsgeber für die europäische Politikgestaltung wirken, wie dies etwa Schweden mit der frühzeitigen Regulierung der Beteiligung chinesischer Firmen am IKT-Infrastrukturausbau gelang.
Grenzsicherheit, innere Sicherheit und andere nicht militärische Sicherheitsbereiche sind spätestens seit Mitte der 2010er Jahren zu zentralen Themen der EU‑Integration geworden. Zwischen 2014 und 2016 verschärfte die sogenannte Flüchtlingskrise infolge des syrischen Bürgerkriegs die strukturellen Herausforderungen im Bereich der irregulären Zuwanderung. Gleichzeitig nahm aufgrund des Aufstiegs des »Islamischen Staates« die terroristische Bedrohung in Europa markant zu. Zwischen 2015 und 2019 wurden diese Themen in Eurobarometerumfragen als die zwei wichtigsten Prioritäten der EU benannt. Auffallend ist zudem, dass in vielen EU-Mitgliedstaaten in den 2020er Jahren rechtskonservative bis rechtspopulistische Parteien bei Wahlen weiter an Boden gewonnen haben. Wenngleich dafür jeweils national spezifische Dynamiken ausschlaggebend sind, ist doch auch die öffentliche Wahrnehmung der europäischen Grenzsicherung und der inneren Sicherheit ein gewichtiger Faktor geworden.1 Der Brexit erfolgte nicht zuletzt vor dem Hintergrund eines mutmaßlichen Kontrollverlusts an europäischen Außengrenzen.
In diesem Kontext initiierte der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 2016 den Diskurs eines »Europa, das schützt«2 bzw. einer »Sicherheitsunion«.3 Der Europäische Rat griff seinerseits die Krisenwahrnehmung auf4 und hat sich seither verstärkt mit Themen der inneren Sicherheit befasst. Der inhaltliche Rahmen erweiterte sich stetig über die Grenzsicherung und Terrorismusbekämpfung hinaus. Laut der aktuellen mehrjährigen Strategie der Kommission von der Leyen5 zur Sicherheitsunion soll diese diverse Querschnittsaufgaben bearbeiten, etwa die Cybersicherheit, den Schutz kritischer Infrastrukturen oder die Abwehr hybrider Bedrohungen. Die EU-Politik für die innere Sicherheit lässt sich jedoch nicht auf die Schaffung einer immer umfassenderen Sicherheitsunion reduzieren. Vielmehr muss auf die Grundlagen dieses Politikfelds Bezug genommen werden.6 Vertragsrechtlich (Art. 3[2] EUV) hat sich die EU folgendes Integrationsziel gesetzt: »Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem – in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität – der freie Personenverkehr gewährleistet ist.«
Dieser Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (RFSR) wird im Kapitel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Union (AEUV, Art. 67–89) inhaltlich definiert. Die wesentlichen Kompetenzfelder umfassen die polizeiliche und strafrechtliche Zusammenarbeit, den Außengrenzschutz und das Asylwesen. Im Gegensatz dazu ist die Sicherheitsunion nur in politischen Mitteilungen der Kommission umrissen worden. Demnach sind die Migrationskontrolle und die Asylpolitik kein Bestandteil der Sicherheitsunion, diverse andere sicherheitspolitische Themen, die auf EU-Kompetenzen für den Binnenmarkt (Art. 114 AEUV) gründen, hingegen schon. Dies betrifft beispielsweise den Handel mit Feuerwaffen7 und Chemikalien, die für die Herstellung von Explosivstoffen genutzt werden können, sowie die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.8 Da diese Themen wiederholt im Rat der EU-Innen- und Justizminister behandelt werden, kann die Sicherheitsunion als punktuelle Ergänzung, aber nicht als eigentliches Integrationsziel der EU verstanden werden. Deshalb bleibt im Folgenden der RFSR, einschließlich der Asyl- und Grenzsicherungspolitik, zentraler Bezugspunkt der Analyse.
Kooperationsdynamik und Konfliktlinien
Die Sicherheitspolitik gilt als besonders sensibler Bereich der europäischen Integration, bei dem intergouvernementale Verfahren dominieren. Für den RFSR bzw. die EU-Innenpolitik wurden aber bereits seit Ende der 1990er Jahre mit dem Vertrag von Amsterdam viele Schwellen zur Vergemeinschaftung überschritten.9 Der Vertrag von Lissabon überführte anschließend die verbleibenden Kompetenzbereiche des RFSR in das reguläre europäische Gesetzgebungsverfahren. Nur in Einzelaspekten, insbesondere bei Maßnahmen der operativen Polizeizusammenarbeit (Art. 87[3] AEUV), gilt weiterhin ein einstimmiges Entscheidungsverfahren.10 Außerdem wurde die EU-Grundrechtecharta vertragsrechtlich verbindlich, was für den RFSR und die damit verbundene Integration des Asylrechts und des Strafrechts von besonderer Bedeutung ist.11 Der EuGH wurde nach einer Übergangszeit ab 2014 in fast allen Belangen des RFSR befugt, seine allgemeinen Aufgaben der Rechtsauslegung und ‑durchsetzung wahrzunehmen.12 Dies hatte weitreichende Folgen, unter anderem für die Nutzung des Europäischen Haftbefehls.
Die europäische Sicherheitszusammenarbeit wird als notwendige Reaktion auf die internationalen Aktivitäten von Schwerkriminellen und Terroristen betrachtet.
Diese ungewöhnliche Integrationsdynamik wird hauptsächlich damit begründet, dass der Ausbau einer gemeinsamen Außengrenzsicherung und Einwanderungskontrolle sowie einer grenzüberschreitenden polizeilichen und strafrechtlichen Zusammenarbeit eine notwendige Folge bzw. einen Spillover-Effekt der Freizügigkeit in der Schengen-Zone ist.13 Zudem wird die europäische Sicherheitszusammenarbeit als notwendige Reaktion auf die internationalen Aktivitäten von Schwerkriminellen und Terroristen betrachtet. Anschläge wie unter anderem jene in Madrid (2004) oder Berlin (2016) geben regelmäßig Anlass zur Beschleunigung der Gesetzgebung. Weitere institutionelle und soziologische Faktoren, wie etwa die Eigeninteressen von EU-Agenturen (Frontex, Europol) und EU-Institutionen oder eine transnational geteilte professionelle Kultur unter Mitarbeitenden von Sicherheitsbehörden, tragen zur Verstetigung der Zusammenarbeit in der europäischen Innenpolitik bei.14
Als intergouvernementales Erbe hält sich eine hervorgehobene Rolle des Rats15 und zugehöriger Arbeitsgruppen.16 Die EU-Kommission baute zwar seit Beginn der 2000er Jahre ihre Rolle im Bereich der inneren Sicherheit aus, insbesondere im Nachgang von Krisen (beispielsweise dem 11 September 2001).17 Der Übergang zum regulären Gesetzgebungsverfahren und zum vollen Initiativrecht mit dem Lissabonner Vertrag war insofern nur ein gradueller. Gleichwohl orientiert sich die Kommission in diesem Bereich weiterhin eng an den Interessen der Mitgliedstaaten. Scharfe Konflikte zwischen Rat und Kommission sind, bezogen auf die gesamte EU-Innenpolitik, selten und spiegeln eher Differenzen zwischen den Mitgliedstaaten wider, wie etwa in der Asyl- und Migrationspolitik.
Insgesamt gilt wie in vielen anderen EU-Politikfeldern eine starke Konsensnorm, selbst wenn seit dem Vertrag von Lissabon ein verhaltener Anstieg an Mehrheitsentscheidungen zu verzeichnen ist.18 Dies wird noch deutlicher, wenn man Großbritannien herausnimmt, das bis zum Brexit eine besonders kritische Rolle in diesem Politikfeld einnahm. Abgesehen von den weiteren historischen Opt-out-Sonderregelungen im RFSR für Irland und Dänemark19 ist keine übergreifende Konfliktlinie zwischen den Mitgliedstaaten zu erkennen. Die thematische Ausnahme der EU-Migrations- und Asylpolitik wird weiter unten gesondert besprochen.
Inhaltliche Muster der rechtlichen Integration
Quantitativ betrachtet schreitet die rechtliche Integration im RFSR kontinuierlich voran. Formal besteht zugleich ein Trend zu mehr Verordnungen im Vergleich zu Rechtsinstrumenten, die den Mitgliedstaaten größere Flexibilität einräumen. Dies ergibt sich jedoch eher aus einer inhaltlichen Verschiebung der Integrationsvorhaben als aus einer schrittweisen Vertiefung bestehender Rechtsrahmen. Seit 2010 wurden im Durchschnitt mehr als sieben Verordnungen pro Jahr verabschiedet (zwischen 2 und 12). Dem stehen im Durchschnitt nur 2,8 Richtlinien (zwischen 0 und 6) pro Jahr gegenüber. Letzteres erklärt sich primär aus dem nachlassenden Interesse der Mitgliedstaaten an einer weitergehenden Harmonisierung des Strafrechts. Gemäß Artikel 83 AEUV können in diesem Themenbereich nach wie vor nur Richtlinien erlassen werden. Vor dem Vertrag von Lissabon galt im RFSR das gesonderte Rechtsinstrument des Rahmenbeschlusses des Rates, das noch größere nationale Spielräume erlaubt. Einige wichtige Rahmenbeschlüsse gelten bis heute fort, etwa zum Europäischen Haftbefehl.20
Eine Entwicklung von einem eher »negativen« Integrationsprozess, also dem Abbau von grenzüberschreitenden Hindernissen der Kooperation, hin zu einem »positiven« Setzen gemeinsamer Standards lässt sich also nur bedingt feststellen.21 So gab es eine schrittweise Entwicklung von Instrumenten der gegenseitigen Anerkennung nationaler gerichtlicher Entscheidungen, wie beim Europäischen Haftbefehl oder der Vereinbarung von grundrechtlichen Mindeststandards für Beschuldigte in Strafverfahren. Seit Mitte der 2010er Jahre ist hier aber nur noch wenig Dynamik zu verzeichnen. Erst mit dem 2026 umzusetzenden Übergang von Richtlinien zu Verordnungen in weiten Teilen des EU-Asylrechts könnte ein neuer markanter Schritt zu formell einheitlichen Standards gelingen (siehe Abschnitt »Der Kernkonflikt um die Asylpolitik«, S. 79f).
In den vergangenen Jahren der Integration lässt sich nicht allgemein von starken Souveränitätsvorbehalten im Bereich Kernstaatlichkeit sprechen.
Im Gegensatz dazu schreitet der Ausbau gemeinsamer europäischer Kompetenzen und Ressourcen in Form von EU-Agenturen22 und gemeinsamen Datenbanken oder IT-Infrastrukturen23 für die innere Sicherheit seit langem voran. Alle diese Instrumente wurden seit dem Vertrag von Lissabon durchgängig als EU-Verordnungen gefasst. Unter anderem betrifft dies seit 2009 jeweils zwei Mandatsrevisionen von Europol und Frontex, die Aufwertung der Europäischen Asylbehörde, die Einrichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft und die Schaffung neuer Grenzkontrollsysteme und deren Vernetzung. Insofern kann in den vergangenen Jahren der Integration nicht allgemein von starken Souveränitätsvorbehalten im Bereich der Kernstaatlichkeit gesprochen werden.24 Stattdessen sind Kontext und unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte innerhalb des breit angelegten Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ausschlaggebend. So steht die eher schleppende rechtliche Konvergenz im Bereich des Strafrechts in starkem Kontrast zum fortschreitenden Ausbau exekutiver Instrumente, Infrastrukturen und Agenturen auf EU-Ebene, die die Arbeit nationaler Sicherheitsbehörden ergänzen und unterstützen sollen.
Gegengewicht und Kontrolle durch das Europäische Parlament
Trotz zunehmender parteipolitischer Fragmentierung25 fällt es dem Europäischen Parlament zu, ein Gegengewicht zu diesem Wachstum exekutiver Strukturen zu bilden. In Verhandlungen mit Rat und Kommission betont das Europäische Parlament in der Regel die Verhältnismäßigkeit neuer Sicherheitsmaßnahmen und die Wahrung von Grundrechten.26 Der Titel des federführenden EP-Ausschusses unterstreicht diese Grundorientierung: Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres.
Anlassbezogen verstärkt der Europäische Gerichtshof (EuGH) diese Konfliktlinie zwischen den Institutionen. Insbesondere im Bereich des Datenschutzes hat der EuGH europäische Rechtsakte für nichtig oder revisionsbedürftig erklärt. Prominente Beispiele betreffen etwa die verpflichtende Vorratsdatenspeicherung und die Sammlung und Auswertung von Fluggastdaten. Damit verbunden ist eine Debatte über die Bindung an EU-Recht27 im Bereich der inneren Sicherheit. So tendieren mehrere Mitgliedstaaten dazu, im Konfliktfall auf die mitgliedstaatliche Verantwortung für die nationale und öffentliche Sicherheit zu verweisen. Diese Dynamik zeigt sich unter anderem im Bereich von Schengen und der Anwendung von Binnengrenzkontrollen.28 Das Parlament wiederum versucht seine Budgetrechte zu nutzen, um eine schärfere Kontrolle über EU-Agenturen im RFSR auszuüben. Der Fokus liegt dabei auf der Kontrolle von Frontex; im Zuge dessen kam es 2022 unter anderem zum Rücktritt des ersten Direktors der Agentur.29
Der zentrale politische Konflikt im RFSR seit dem Vertrag von Lissabon betrifft jedoch die Kosten- und Lastenteilung im sogenannten Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS), das 2013 zuletzt ausgebaut wurde und mittlerweile als weitgehend gescheitert gilt. Debatten über die stark ungleiche Verteilung von Schutzsuchenden, die Fairness des Dublin-Systems zur Festlegung der Verantwortung für Asylanträge und die zugehörigen Kosten reichen bis in die 1990er Jahre zurück. Sie erhielten aber im Nachgang des Arabischen Frühlings und der sogenannten Flüchtlingskrise ab 2014 eine neue, bis dahin nicht gekannte Schärfe und haben das politische System der EU an ihre Grenzen gebracht.30 Vereinfacht gesagt, fielen die Mitgliedstaaten in mindestens drei Lager auseinander: die südlichen Erstankunftsstaaten, die nördlichen Zielstaaten der sekundären innergemeinschaftlichen Migration und die (nord-)östlichen Staaten, die Migration und Asyl so weit wie möglich einschränken wollen.
Zunächst bezog das Europäische Parlament die Position, dass Schutzsuchenden die Möglichkeit eingeräumt werden sollte, eigene Präferenzen bei der Verteilung unter den EU-Mitgliedstaaten vorzubringen.31 Mit dem Erstarken rechtskonservativer bis rechtspopulistischer Parteien in diversen Mitgliedstaaten konnte diese Linie jedoch nicht aufrechterhalten werden.
Integrationsschritte und -inhalte seit 2009
Diese Schwerpunkte und Konflikte im RFSR haben sich seit dem Vertrag von Lissabon nach und nach entwickelt. Von 2009 bis 2014 orientierte sich die EU an dem letzten mehrjährigen inhaltlichen Programm zur Erweiterung des RFSR.32 Die Ambitionen waren dabei vor allem im Bereich der strafrechtlichen Zusammenarbeit relativ weitreichend, diese entwickelte sich aber letztlich nur schleppend. Bis 2013 wurden allerdings die Grundlagen des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) verabschiedet, darunter insbesondere die Dublin-III-Verordnung und begleitende Richtlinien zu Asylverfahren, Qualifikation und Aufnahmebedingungen. Diese Rechtsakte bedeuteten im Vergleich zu den damals geltenden nationalen Asylsystemen für viele Mitgliedstaaten einen Schritt in Richtung höherer Schutzstandards.33
Fokus auf Terrorismus und Grenzsicherung
Zwischen 2016 und 2019 folgte eine dynamische Phase der krisengetriebenen Integration mit Blick auf Grenzsicherung und den internationalen Terrorismus.34 Besonders hervorzuheben sind dabei eine überarbeitete Richtlinie zur Bekämpfung des Terrorismus, die Propaganda und Unterstützung terroristischer Organisationen stärker in den Fokus rückte, sowie eine erste verbindliche Verordnung zur zeitigen Löschung terroristischer Online-Inhalte. Zudem wurden regulative Maßnahmen zur Eindämmung terroristischer Handlungen eingeführt, etwa verschärfte Regeln zum Handel mit Feuerwaffen und Vorläufern von Explosivstoffen. Ein weiterer zentraler Fortschritt war die Schaffung eines neuen Anti-Terrorismus-Zentrums bei Europol.
Parallel dazu wurden im Zuge der Flüchtlingskrise 2016 eine Reform des Schengen-Kodex und die Schaffung der Europäischen Grenz- und Küstenwache bzw. eine markante Aufwertung von Frontex beschlossen. Die Agentur sollte unter anderem eigenständige Einsatzmittel (z. B. Fahrzeuge, Drohnen und Sensoren) anschaffen, mehr Aufgaben bei der Rückführung von irregulären Zuwanderern übernehmen und eine stärkere Aufsicht über den Außengrenzschutz der Mitgliedstaaten ausüben. Die Europäische Grenz- und Küstenwache soll gemäß Artikel 71 AEUV demnach ein »integriertes Grenzmanagementsystem« aller relevanten nationalen Behörden und der EU-Ebene schaffen. Bereits 2019 erfolgte eine weitere Reform der Agentur. Wichtigster Schritt war hierbei, dass Frontex seither selbst eine Reserve von EU-Grenzschutzbeamten ausbilden und einstellen soll.35 Die finanziellen Aufwendungen für den Grenzschutz stiegen sowohl für Frontex wie im gesamten EU-Finanzrahmen markant an.
In diesem Zusammenhang einigte sich die EU auch auf die Errichtung »intelligenter Grenzen« nach US-Vorbild.36 Das beinhaltet ein biometrisches Ein- und Ausreisesystem für alle Besucher der Schengen-Zone und ein zusätzliches elektronisches Einreiseerlaubnissystem für visafreie Reisende. Diese Systeme sollen nach mehrfachen technischen Verzögerungen Ende 2024 in der Praxis ankommen. Das ursprüngliche Schengener Informationssystem (SIS) zur grenzpolizeilichen Zusammenarbeit wurde bereits bis 2022 mit neuen Datenkategorien ausgebaut. Nationale Behörden wurden zudem verpflichtet, dieses System sowohl für die Migrationskontrolle (Ausweisungsentscheidungen) als auch für die Terrorismusbekämpfung umfassend zu nutzen.37 Ergänzend vereinbarte die EU, eine neue Form der »Interoperabilität« zwischen allen bestehenden Datenbanken und Systemen der EU zu ermöglichen. Ein gemeinsames »Repositorium« biometrischer Daten soll die Datenqualität verbessern und mögliche Falschangaben erschweren. Sicherheits- und Verwaltungsbehörden auf allen Ebenen sollen so nach Bedarf und Befugnis in die Lage versetzt werden, die unterschiedlichen Datenbestände leichter und schneller zu durchsuchen.
Weitere Schritte in der strafrechtlichen Zusammenarbeit
Zum Abschluss der Legislaturperiode bis 2019 wurde nach ebenso langjährigen wie schwierigen Verhandlungen im Kernbereich der strafrechtlichen Zusammenarbeit die Einrichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EuSta) als verstärkte Zusammenarbeit zunächst unter 22 Mitgliedstaaten vereinbart. Aufgabe der EuSta ist primär die Verfolgung von Verbrechen, die gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtet sind.38 Bereits in den ersten zwei Jahren der operativen Arbeit (2021–2023) der EuSta konnten große Ermittlungsverfahren wegen Subventions- und Steuerbetrug mit einem Schadenswert von rund 15 Milliarden Euro eingeleitet werden.39 Es bleiben aber gleichzeitig viele Fragen zur operativen Zusammenarbeit und zur Kompatibilität mit den nach wie vor sehr unterschiedlichen strafrechtlichen Systemen der Mitgliedstaaten.40 Besonders positiv für die weitere Entwicklung der EuSta ist die Beitrittsankündigung der neuen polnischen Regierung unter Donald Tusk, woraufhin sich auch Schweden anschließen will. Damit würde neben Dänemark und Irland, die ihre allgemeine Sonderrolle bzw. ihre Opt-Outs im RFSR in Stellung bringen, nur Ungarn außerhalb der EuSta verbleiben, was den Konflikt der EU mit dem Land zur Rechtsstaatlichkeit unterstreicht.
Die Kernkompetenzen der EU für den Binnenmarkt haben in den vergangenen Jahren unterdessen eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Gesetzgebungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befördert.41 Bis Ende 2024 soll unter anderem eine neue europäische Behörde geschaffen werden, die nationale Einrichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche beaufsichtigen soll.42 Des Weiteren bemüht sich die EU, die Digitalisierung auch bei der strafrechtlichen und justiziellen Zusammenarbeit voranzubringen. So konnte 2023 nach jahrelangen Verhandlungen ein grundlegendes Regime zur Sicherung und Übermittlung elektronischer Beweismittel abgeschlossen werden.43
Der Kernkonflikt um die Asylpolitik
Die politischen Auseinandersetzungen wurden in den vergangenen Jahren jedoch primär durch die besonders schwierige und langwierige Reform der EU-Asylpolitik geprägt. Seit 2016 war der Bedarf an einer grundlegenden Neuordnung offensichtlich, da geltendes EU-Recht immer weniger verlässlich in den Mitgliedstaaten und an den EU-Außengrenzen umgesetzt wurde. Einzelne Maßnahmen zur Verteilung von Schutzsuchenden, ob nun formell rechtlich verbindlich oder freiwillig, schlugen in der Praxis fehl. Eine Neugewichtung der Verantwortung der Außengrenzstaaten einerseits und der Zielstaaten der sekundären Migration andererseits blieb außer Reichweite. Die ungeklärte Frage der sogenannten Lastenteilung blockierte letztlich alle Reformvorhaben des GEAS in der Legislaturperiode bis 2019.
Die ungeklärte Frage der Lastenteilung blockierte alle Reformvorhaben des GEAS in der Legislaturperiode bis 2019.
Im Herbst 2020 wurde deshalb ein neues umfassendes Paket für Migration und Asyl vorgestellt. Alle zugehörigen Legislativakte44 können hier nicht genauer dargestellt werden, sie umfassen aber sowohl Novellierungen des bestehenden GEAS von 2013 sowie neue Elemente. Zentral sind neue Mechanismen zur möglichst lückenlosen Erfassung und ersten Überprüfung aller irregulären Zuwanderer und Schutzsuchenden (»Screening«), zur verpflichtenden Durchführung sogenannter Asyl-Grenzverfahren für Personen mit geringer Anerkennungschance und ein komplexes Lastenteilungssystem, bei dem die Übernahme von Personen aus den Erstaufnahmeländern nicht verpflichtend ist und durch andere, zumeist finanzielle Leistungen ausgeglichen werden kann.
Erst nach weiteren schwierigen mehrjährigen Verhandlungen konkretisierte sich hierzu eine politische Einigung, bei der durch weitgehende Verschärfungen des Asylrechts, zusätzliche Optionen für krisenbedingte Ausnahmen und eine sehr starke Flexibilisierung von Solidaritätsleistungen die unterschiedlichen Positionen der Mitgliedstaaten überbrückt werden konnten. Dabei wurden aber – wie schon 2016 bei der einmaligen Verteilung von Schutzsuchenden – Polen und Ungarn explizit überstimmt. Ebenso entscheidend für die Einigung war, dass die amtierende Bundesregierung der zunehmend restriktiven Asyl- und Grenzsicherungspolitik der meisten anderen EU-Mitgliedstaaten Rechnung trug und bestimmte grundrechtliche Vorbehalte in den Verhandlungen aufgab, etwa den, Familien von Asyl-Grenzverfahren auszunehmen, die unter haftähnlichen Bedingungen durchgeführt werden. Trotz erheblicher Differenzen zur Position des Ministerrats akzeptierte das Europäische Parlament Ende 2023 die vorliegende Kompromisslösung in fast allen Belangen, und es konnte alle Rechtsakte des Pakts planmäßig im April 2024 verabschieden. Der politische Druck, noch vor Ablauf der Legislaturperiode zumindest eine formelle Einigung zu erreichen, überwog letztlich die Sorge vor einer strukturellen Aushöhlung des Asylrechts.
Die grundrechtliche Basis sowie die praktische Umsetzbarkeit dieser Agenda werden von externen Kommentatoren jedoch weiterhin stark in Zweifel gezogen.45 Die Erfahrungen mit dem temporären Schutz von Ukrainern, die volle Bewegungsfreiheit genossen, konnten noch nicht als positives Beispiel genutzt werden, sondern haben eher verteilungspolitische Ungleichgewichte und damit verbundene politische Bedenken verschärft. Wie das angestrebte Gleichgewicht zwischen nationaler Verantwortung und europäischer Solidarität (Art. 80 AEUV) realisiert werden kann, bleibt auch im avisierten Pakt für Migration und der darin enthaltenen Asylmanagement-Verordnung weitgehend unklar. So lässt sich nicht belastbar prognostizieren, inwieweit das darin vorgesehene System der »flexiblen Solidarität« mit diversen möglichen Unterstützungsleistungen wie nationalen Ausnahmen und Vorbehalten funktionieren wird. Zudem sollen nur 30.000 Schutzsuchende pro Jahr verpflichtend unter den Mitgliedstaaten verteilt werden, alle weiteren Solidaritätsleistungen können flexibel geleistet werden – im Gegenzug für die Bereitstellung von mindestens 30.000 Plätzen zur Durchführung beschleunigter Asylverfahren in Grenznähe. Diese Zahlen liegen um das Zwanzig- bis Dreißigfache unter dem mittelfristig weiterhin zu erwartenden Aufkommen von Asylanträgen und irregulärer Migration. Auch deshalb investiert die EU weiterhin intensiv in einen Ausbau der Grenz- und Migrationskontrollen durch Drittstaaten,46 um interne Konflikte über Lastenteilung abzuschwächen.
Narrative eines Kontrollverlusts bei der irregulären Migration und mangelnder europäischer Solidarität bleiben ein starker Anreiz für rein nationale Politikansätze
Parallel soll eine Reform der Schengen-Verordnung, die ebenso Ende der Legislaturperiode 2024 abgeschlossen werden sollte, die zunehmende Renationalisierung von Grenzkontrollen zurückdrängen. Insbesondere kam es seit 2016 zu einer Verstetigung von Binnengrenzkontrollen zur Eindämmung der sekundären Migration innerhalb der Schengen-Zone, obwohl solche Kontrollen ursprünglich zeitlich begrenzt und nur als letztes Mittel eingesetzt werden sollten. In der Pandemie kamen weitere umfangreiche Einschränkungen der innereuropäischen Freizügigkeit hinzu, die europarechtlich nicht abgedeckt waren.47 Auf Initiative Frankreichs wurde 2022 deshalb eine neue Ratsformation mit allen Innenministern der Schengen-Zone ins Leben gerufen, unterstützt durch die EU-Kommission sowie neue jährliche Berichte und beschleunigte Aufsichtsprozesse.48 Ob es gelingen wird, mit einer reformierten Verordnung, die längere Binnengrenzkontrollen durch einzelne Mitgliedstaaten zwar erlaubt, sie aber einer schärferen Kontrolle durch die EU unterwerfen will, das gegenseitige Vertrauen aller Mitgliedstaaten wiederherzustellen, hängt dabei auch von der Umsetzung des Pakts für Migration und Asyl ab. Solange die Narrative eines Kontrollverlusts bei der irregulären Migration und mangelnder europäischer Solidarität nicht überwunden werden, bleiben sie ein starker Anreiz für rein nationale Politikansätze, auch im Konflikt mit dem geltenden EU-Recht.
Ausblick und Empfehlungen
Die EU-Politik für die innere Sicherheit kann einerseits als besondere Erfolgsgeschichte der Integration betrachtet werden, bei der trotz hochsensibler Inhalte und schwieriger Krisen langfristig das Interesse an gemeinsamer Kooperation und einem Ausbau europäischer Kapazitäten überwiegt. Dies zeigt sich insbesondere im Ausbau der Grenzsicherung, sei es durch Frontex oder durch vielfältige Daten- und Informationssysteme, sowie der Bekämpfung von Terrorismus und anderen schwerwiegenden Straftaten.
Andererseits ist die Asyl- und Migrationspolitik der zentrale Problemkomplex, der in den zurückliegenden Jahren die Grundfesten und Grundwerte der EU erschüttert hat. Der sogenannte Pakt für Migration und Asyl konnte letztlich aber trotz anhaltender und erheblicher Interessenkonflikte zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen dem Rat und dem Europäischen Parlament verabschiedet werden. Ohne eine Einigung hätten die Fliehkräfte der Desintegration, der Nichtanwendung von EU-Recht und der Verlagerung der Sicherheitskooperation auf Drittstaaten weiter Auftrieb erhalten. Die für die politische Einigung notwendigen inhaltlichen Kompromisse – wie etwa die sogenannte flexible Solidarität oder weitreichende Optionen für krisenbedingte Abweichungen vom regulären Asylrecht – lassen erheblich daran zweifeln, dass in den kommenden Jahren tatsächlich ein ebenso verlässliches wie grundrechtlich vertretbares europäisches System zum Umgang mit Schutzsuchenden geschaffen werden kann.
Über alle Themenfelder des RFSR hinweg gilt es die Rechtsstaatlichkeit im Blick zu behalten. Diese muss für das Handeln der EU und ihrer Agenturen, aber auch in allen Mitgliedstaaten gewährleistet sein. Der Europäische Haftbefehl und eine grundrechtskonforme Nutzung des Dublin-Verfahrens zur innereuropäischen Überstellung von Asylsuchenden stehen dabei praktisch im Vordergrund, stellen aber bei weitem nicht alle relevanten Fälle dar.
Die Integrationsziele der EU in der inneren Sicherheit sollten vor diesem Hintergrund kritisch reflektiert werden. Es ist fragwürdig, die Erhaltung der Freizügigkeit in der Schengen-Zone von immer neuen Maßnahmen bei der Außengrenzsicherung und Einschränkungen beim Zugang zu Asyl abhängig zu machen. Die schrittweise Angleichung und Modernisierung von Strafrechtsfragen, einschließlich des Strafprozessrechts, sowie von zugehörigen digitalen Infrastrukturen dürfte hingegen wieder mehr Aufmerksamkeit erfahren. Langfristig stellt sich schließlich die Frage nach möglichen Vertragsänderungen, insbesondere solchen, die die Grenzen der exekutiven Befugnisse der EU und ihrer Agenturen etwa beim Außengrenzschutz oder der Bearbeitung von Asylverfahren präziser bestimmen.
Alte Probleme trotz neuer Instrumente in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
Seit dem Vertrag von Maastricht soll die gemeinsame europäische Außenpolitik eine koordinierte Positionierung der EU-Mitgliedstaaten in internationalen Angelegenheiten ermöglichen. Nach Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) hat sie den Anspruch, Frieden zu erhalten, internationale Sicherheit zu stärken und die multilaterale Zusammenarbeit zu fördern. Zudem will sie Demokratie, die Achtung von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit festigen. Die EU tut sich jedoch schwer, diesem Anspruch gerecht zu werden und mit einer Stimme zu sprechen. Immer wieder haben unterschiedliche nationale Interessen, historische Verbindungen und komplexe interne Entscheidungsprozesse einen einheitlichen außenpolitischen Ansatz untergraben.
Dreißig Jahre nach ihrer Gründung steht dem gestalterischen Anspruch der EU-Außenpolitik eine eher ernüchternde Bilanz in der internationalen Krisen- und Konfliktbewältigung gegenüber. Den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten wird immer wieder attestiert, keine ernsthaften Bemühungen zu unternehmen, um die Lücke zwischen den hohen Erwartungen an die europäische Außenpolitik und deren Fähigkeiten zu schließen.1 In der Folge hat sich die Reformdebatte rund um die EU-Außenpolitik zum Dauerbrenner in der Europapolitik entwickelt. Insbesondere die Fähigkeit der EU, angemessen auf Krisen und Konflikte zu reagieren, zum Beispiel mit Blick auf den Krieg im ehemaligen Jugoslawien oder die russische Annexion der Krim, wurde häufig als unzureichend, ihr Vorgehen als zögerlich kritisiert.2
In der heutigen internationalen Krisenlandschaft ist eine effektive und handlungsfähige Außenpolitik allerdings wichtiger als je zuvor. Seit der Währungs- und Finanzkrise haben sowohl globale Krisenherde wie die sogenannte Flüchtlingskrise, die Klimakrise und die Covid-19-Pandemie als auch Konflikte wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der erneute Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas das geopolitische Umfeld für die EU stark verändert. Einerseits bedrohen hybride Gefahren, wie etwa transnationaler Terror und Cyberangriffe, die innere Sicherheit der EU. Gleichzeitig beschränken interne Entwicklungen, allen voran das Erstarken von Nationalismus und Populismus innerhalb der Union oder auch der Brexit, die Handlungsfähigkeit der Union. So hat die außenpolitische Orientierung einiger rechtspopulistischer Parteien wiederholt eine gemeinsame Entscheidungsfindung in der EU-Außenpolitik erschwert oder gar verhindert.3
Angesichts dieser zahlreichen Herausforderungen hat die EU immer wieder versucht, die Debatte über eine Reform der gemeinsamen Außenpolitik voranzutreiben. In der jüngeren Vergangenheit steht zunehmend ihre eigene Rolle als starke globale Akteurin mit dem Leitmotiv der strategischen Autonomie und Resilienz im Vordergrund.4 Auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2018 erklärte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die EU müsse »weltpolitik-fähig« werden, und forderte, das Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik aufzugeben.5 Fünf Jahre später knüpfte Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen mit der »geopolitischen Kommission«6 an die Idee einer strategischen EU-Außenpolitik an und verkündete bei ihrer Rede zur Lage der Union im September 2023, dass die EU die Geburt einer geopolitischen Union erlebt habe.7
Bereits im Oktober 2023 verdeutlichte der Krieg zwischen Israel und der Hamas abermals, dass die europäische Stimme, wie bereits kurz zuvor im Krieg um Bergkarabach, auf der internationalen Bühne kaum Gehör findet. Wenngleich der Europäische Rat in seiner strategischen Agenda für die Legislaturperiode 2019–2024 die Außen- und Sicherheitspolitik der Union aktiver gestalten und besser mit den übrigen Bereichen der Außenbeziehungen verknüpfen möchte, bleibt bislang weitgehend unklar, wie das konkret erreicht werden soll.8 Stattdessen verfestigt sich der Eindruck einer Lücke zwischen den rhetorischen Absichten und einer mangelhaften ergebnisorientierten Politik im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.
Grenzen europäischer Handlungsfähigkeit
Als zweite Säule des Maastricht-Vertrags war das auswärtige Handeln der EU von Beginn an durch die Mitgliedstaaten als intergouvernementales Politikfeld definiert. Die GASP bildet seither den Rahmen für die Koordination in sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen der gemeinsamen Außenpolitik der EU-Mitgliedstaaten. Zwar schufen die Verträge von Amsterdam und Nizza die Möglichkeit konstruktiver Stimmenthaltungen sowie Sonderbestimmungen für Mehrheitsentscheidungen. Zudem beendete der Lissabon-Vertrag sogar die Säulenstruktur und ermöglichte den EU-Institutionen eine größere außenpolitische Einflussnahme, wie die stärkere Mitbestimmung des Europäischen Parlaments (EP) zeigt, zum Beispiel durch die gemeinsame Verwaltung des GASP-Haushalts.9 Trotzdem blieben einstimmige Entscheidungen die Norm und machten die GASP in besonderem Maße abhängig vom Konsens der Mitgliedstaaten und dem Grundsatz der Politikkohärenz, also dem Streben nach einer einheitlichen und abgestimmten Haltung in der GASP.10
Oftmals lassen sich die außenpolitischen Konfliktlinien innerhalb der EU auf unterschiedliche nationale strategische Interessen zurückführen. Das gilt sowohl für die jeweilige Einschätzung der sicherheitspolitischen Bedrohungen11 als auch für die unterschiedlichen geopolitischen Prioritäten. Diese wurden vor allem mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine deutlich. Während insbesondere Deutschland die Nordsee als reinen Wirtschaftsraum betrachtete, warnten Polen und die baltischen Staaten bereits länger vor den Sicherheitsrisiken einer wirtschaftlichen Abhängigkeit von Russland. In der Folge des russischen Angriffskriegs taten sich vor allem Länder wie Ungarn und Österreich schwer, ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland zu reduzieren, was immer wieder zu Verzögerungen und Uneinigkeiten in der europäischen Außenpolitik führte.
Das Fehlen eines gemeinsamen außenpolitischen Verständnisses und einer gemeinsamen strategischen Kultur in Bezug auf die Außen- und Sicherheitspolitik bedeutet für die EU auch eine Herausforderung bei der Koordination mit anderen internationalen Partnern. Einerseits verhindert es eine einheitliche Herangehensweise der Mitgliedstaaten. Immer wieder führen unterschiedliche außenpolitische Ansätze der EU-Mitgliedstaaten zu fragmentierten Politik-Antworten der westlichen Partner, beispielsweise im Hinblick auf den Bürgerkrieg in Syrien und das militärische Engagement in Afghanistan. Andererseits stehen Abhängigkeiten von externen Akteuren sowie wirtschaftliche Interessen wie beim Irak-Krieg gemeinsamen politischen Prioritäten innerhalb der Union im Wege. In der Folge ist die EU häufig als schwache und zögerliche Akteurin wahrgenommen worden.12
Es herrscht eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik und ihrer Rolle bei der Lösung von Krisen und Konflikten.
Die Diskrepanz zwischen dem Anspruch einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik und ihrer tatsächlichen Rolle in der Krisen- und Konfliktlösung schlägt sich auch in den Eurobarometer-Umfragen nieder. Seit dem Lissabon-Vertrag spricht sich eine klare Mehrheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger für eine gemeinsame EU-Außenpolitik aus (siehe Grafik 1). Mit der verschärften Bedrohungslage seit dem Jahr 2018 ist der Anteil der Befürworter sogar noch gestiegen. Deutschland steht exemplarisch für diesen Trend. Während sich im Jahr 2012 noch 72 Prozent für eine gemeinsame Außenpolitik aussprachen, waren es 2021 gut 81 Prozent. Dieser Zuwachs unterstreicht zuvorderst den gesellschaftlichen Rückhalt für eine entschiedenere gemeinsame europäische Außenpolitik. Laut Eurobarometer-Umfrage 89.2 wünschen sich mehr als sieben von zehn Befragten, dass die EU gegenüber anderen großen Weltmächten wie den USA, Russland oder China oder in Bezug auf die Instabilität des Nahen Ostens mit einer Stimme spricht.13
Neue Instrumente und alte Probleme in der GASP
Um ihre außenpolitischen Ziele zu erreichen, stützt sich die GASP auf eine Reihe von Instrumenten, darunter diplomatische Maßnahmen wie politische Erklärungen, Beschlüsse und Pressemitteilungen, zivile und militärische Missionen sowie restriktive Maßnahmen wie Sanktionen. Wenngleich eine quantitative Erfassung des GASP-Outputs mit unterschiedlichen Herausforderungen wie etwa einer mangelhaften Transparenz der Beschlussfassung und einer uneinheitlichen Kategorisierung der Daten konfrontiert ist, lässt sich in der jüngeren Vergangenheit doch ein klarer Trend in der GASP erkennen.
In erster Linie zeigt sich eine Diskrepanz zwischen dem verhältnismäßig hohen quantitativen Output im Kontext der GASP und einer mangelhaften ergebnisorientierten Politik gegenüber Drittstaaten.14 Trotz einer Zunahme der diplomatischen Kommunikation, etwa in Form von Pressemittteilungen, aber auch restriktiver Maßnahmen, zeigten die EU-Mitgliedstaaten bislang wenig Interesse an einer grundlegenden Reform der GASP. Nicht zuletzt das Prinzip der Einstimmigkeit hat tiefgreifende Reformen zusätzlich erschwert und die Lücke zwischen rhetorischem Anspruch und faktischem politischem Handeln erweitert.
Dabei sollte die Lücke zwischen Anspruch und Fähigkeiten in der GASP mit dem Vertrag von Lissabon eigentlich verkleinert werden. Die wichtigste strukturelle Veränderung war die Schaffung des Europäischen Auswärtigen Diensts (EAD) als Unterstützungsstruktur für den Hohen Vertreter (HV/VP). Der Dienst für außenpolitische Instrumente (FPI) übernahm die Zuständigkeit für die GASP-Ausgaben aus dem EU-Haushalt und befasste sich mit den rechtlichen und finanziellen Aspekten der EU-Außenpolitik.15 Zusammengenommen sollte die neue institutionelle Struktur vor allem die Kapazitäten der EU erweitern und für mehr Kohärenz in der GASP sorgen.
In den Diskussionen zur Vertragsreform von Lissabon vertraten mehrere EU-Mitgliedstaaten die Auffassung, die GASP solle nicht in die Zuständigkeit der Kommission fallen. Zugleich wollten die Mitgliedstaaten kein vollwertiges EU-Außenministerium als eigenständige Institution schaffen. Der EAD entwickelte sich in der Folge zu einer hybriden, zwischen Rat und Kommission verorteten Einrichtung, die zwar eigenständig operiert, im Hinblick auf ihr Budget sowie administrative Abläufe aber von der Kommission abhängig ist. Bei politischen Zielkonflikten zwischen der Kommission und einzelnen Mitgliedstaaten sah sich der EAD nicht zuletzt aufgrund seiner fortwährenden finanziellen Abhängigkeit von der Kommission immer wieder mit dem Mangel an Ressourcen, aber auch an Akzeptanz einzelner Mitgliedstaaten konfrontiert.16
Einerseits konnte der EAD seinen Einfluss stetig ausweiten. Beispielsweise haben die EU-Delegationen die Aufgabe des rotierenden Ratsvorsitzes übernommen und somit eine bessere Ressourcennutzung sowie ein höheres Maß an Kontinuität der europäischen Stimme in Drittländern ermöglicht. Auch die Anzahl der Pressemitteilungen ist seither sichtlich angestiegen, und bisweilen konnte der EAD als Brücke zwischen klassischer Außenpolitik und EU-Institutionen fungieren.
Andererseits fehlt dem EAD weiterhin die Schlagkraft, effektiv zwischen Mitgliedstaaten und Kommission zu vermitteln und politische Prozesse im Rat zu lenken.17 Oftmals fungiert der EAD immer noch als Sekretariat und nicht als eigenständige politische Institution. Das ist nicht zuletzt auch auf die fluktuierende Rolle des Hohen Vertreters zurückzuführen. Aufgrund ihrer Persönlichkeit und des politischen Klimas konnte allen voran Federica Mogherini neue Akzente in der europäischen Außenpolitik setzen, während andere mit Uneinigkeit unter den Mitgliedstaaten und mangelnder Klarheit in der Außenpolitik zu kämpfen hatten. Die Trennung von EU-Kommission und Außen- und Sicherheitspolitik harmoniert schwerlich mit dem geopolitischen Anspruch der Kommission.
Eine kohärente und flexible Finanzierung der EU-Außenpolitik
Mit Ausnahme der militärischen und verteidigungspolitischen Ausgaben ist das auswärtige Handeln an den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) gekoppelt. Seit 2014 steigen die Finanzmittel kontinuierlich. Allerdings hat die EU in diesem Zusammenhang eine Reihe zusätzlicher Instrumente entwickelt, die schließlich zu einer fragmentierten Finanzierung der EU-Außenpolitik geführt haben.18
In der Folge des Lissabon-Vertrags überführte der MFR 2013–2017 erstmals die knapp 30 Programme mit mehr als 90 Budget-Leitlinien der europäischen Außenpolitik in acht Hauptinstrumente unter der Rubrik »Globales Europa«. Die Reform sollte einerseits eine stärkere Differenzierung ermöglichen, zum Beispiel mit Blick auf Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Andererseits sollte sie für eine größere Konzentration und Flexibilität sowie vereinfachte Regeln und Verfahren für externe Ausgaben sorgen. Nachdem die Finanzmittel für das auswärtige Handeln zunächst von 5,7 Prozent im MFR 2007–2013 auf 6,6 Prozent des Budgets für die EU als globaler Partner im MFR 2014–2020 angestiegen waren, sanken die Ausgaben für Nachbarschaft und übrige Welt – gemessen am Gesamtbudget im MFR 2021–2027 – auf knapp 5,4 Prozent. Als Unterrubrik des Budgets für auswärtiges Handeln konnte die GASP zwar einen absoluten Anstieg von 235 Millionen Euro im Jahr 2014 auf rund 333 Millionen Euro im Jahr 2022 verbuchen. Relativ gesehen sank ihr Anteil allerdings von gut 3 Prozent im Jahr 2015 auf knapp 2,6 Prozent im Jahr 2022 (siehe Tabelle 1, S. 92).
Seit 2021 sind mehrere Finanzierungsinstrumente des auswärtigen Handelns – wie das europäische Nachbarschaftsinstrument (ENI), das Instrument für Heranführungshilfe (IPA II) und der Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) – unter dem neuen Instrument für Nachbarschaft, Entwicklung und internationale Kooperation (NDICI) zusammengefasst. Die neue Struktur sollte größere Flexibilität bei der Verwendung der Finanzmittel ermöglichen, um einerseits mehr Mittel aus einem größeren Pool unterschiedlicher Interessenvertretungen zu generieren und andererseits Haushaltsmittel mit anderen Ressourcen zu kombinieren. Eine wichtige Priorität war das Bemühen, den Privatsektor einzubeziehen und private Investitionen für die Entwicklung zu mobilisieren. Diese Umstrukturierung sollte zudem besser auf die Bedürfnisse und Prioritäten der Kommission abgestimmt werden. Insgesamt wurde der Haushalt für auswärtige Politik im MFR durch die Zusammenlegung aufgestockt, in Relation zum vorherigen Haushalt 2014–2020 um gut 12 Prozent.19
Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon konnte das Europaparlament seine Zuständigkeiten in der GASP deutlich ausweiten.
Wenngleich die Reaktionsfähigkeit durch Ad-hoc-Instrumente wie Treuhandfonds verbessert wurde, stellen sich nunmehr neue Fragen. Insbesondere zivilgesellschaftliche regionale Akteure sehen die beschriebene Zusammenlegung kritisch, da sie nicht spezifisch genug auf regionale und ländereigene Besonderheiten und Prioritäten reagieren könne. Die Konzentration auf strategische Prioritäten und politische Ziele schränke die Flexibilität und die Fähigkeit ein, wirksam auf Krisen zu reagieren. Darüber hinaus gibt es Bedenken wegen einer möglichen Verzögerung bei Entscheidungsprozessen und bei der Auszahlung. Tatsächlich zeigt sich eine signifikante Diskrepanz zwischen den Verpflichtungs- und den Zahlungsermächtigungen. Im Jahr 2021 betrug diese mehr als 5 Milliarden Euro.20 Neben den thematischen Prioritäten wirft die Reform auch Fragen auf, die die demokratische Aufsicht und die Haushaltskontrolle betreffen.
Parlamentarische Kontrolle der GASP
Mit Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags wurden die Zuständigkeiten des EP in der GASP deutlich erweitert. Das Parlament kann über die Ernennung des HV/VP mitentscheiden und diesen zur Rechenschaft ziehen. Gleichzeitig muss der HV/VP das Parlament über die wichtigsten Entwicklungen und politischen Entscheidungsprozesse informieren. Zudem hält das EP zweimal im Jahr eine Aussprache über die Fortschrittsberichte zur GASP und richtet Fragen und Empfehlungen an den Rat sowie den HV/VP. Neben »Gemeinsamen Konsultationssitzungen« zu Missionen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) und dem Zugang zu vertraulichen Informationen im Zusammenhang mit der GASP und der GSVP durch den Sonderausschuss kann das EP regelmäßig Berichte über die Umsetzung der GASP einfordern und Anhörungen mit Vertreterinnen des EAD sowie nationalen Außenministerinnen und ‑ministern abhalten. Somit hat das Parlament ein hohes Maß an informeller Zusammenarbeit mit den anderen Institutionen und den nationalen Regierungen erreicht. Allerdings hat das Parlament nach Artikel 29 EUV keine formalen Befugnisse zur Annahme von GASP-Beschlüssen oder ‑Rechtsakten und ist somit effektiv von der Gesetzgebung in der GASP ausgeschlossen.21
Außerhalb des politischen Dialogs erhielt das EP mit dem Vertrag von Lissabon zum ersten Mal die Möglichkeit zur Haushaltskontrolle, indem das EP und der Rat als gemeinsame Haushaltsbehörde der EU fungieren. Konkret hat das Parlament das Recht, den GSVP-Haushaltsplan zu genehmigen oder Änderungen vorzuschlagen. So drängte das EP zum Beispiel auf eine Kürzung der Finanzierung der EU-Mission »Sophia« sowie auf eine Überarbeitung des Missionsmandats – beides aufgrund von Bedenken, die den Umgang mit geretteten Migrantinnen und Migranten betrafen. Da kein Kompromiss gefunden wurde, musste die Seenotrettung im Rahmen der neuen Mission »Themis« ohne maritime Überwachungs- und Schleuserbekämpfungskomponenten fortgesetzt werden.22
Politisch hat sich das EP seit dem Maastricht-Vertrag für eine größere Kohärenz zwischen den politischen und finanziellen Instrumenten der GASP sowie für eine Ausweitung von deren Anwendungsbereich eingesetzt, einschließlich finanzieller Sanktionen.23 Trotz der Reformen des Lissabon-Vertrags sind immer wieder strukturelle Defizite in der institutionellen Zusammenarbeit und politische Zielkonflikte zwischen den außenpolitischen Akteuren erkennbar geworden, die nicht zuletzt auch die Entschlussfähigkeit der EU und ihre Rolle als geopolitische Akteurin beeinträchtigen. Als Konsequenz empfahl das EP wiederholt eine bessere Koordinierung und Integration der EU-Außenpolitik mit den externen Dimensionen ihrer internen Politikbereiche, vor allem in Bezug auf Migration, Handel und Sicherheit, um eine effektive und einheitliche EU-Außenpolitik zu gewährleisten.24 Darüber hinaus fordert das EP, die Entscheidungskapazität durch die uneingeschränkte Anwendung qualifizierter Mehrheitsbeschlüsse in den Bereichen Menschenrechte, Schutz des Völkerrechts sowie Verhängung von Sanktionen zu stärken.
Entscheidungsprozesse und Mehrheiten in der GASP
Den vielfach konstatierten Schwächen zum Trotz lässt sich in den vergangenen Jahren eine deutliche Zunahme an Sanktionen beobachten. Zusätzlich zur Umsetzung von Sanktionsbeschlüssen des UN-Sicherheitsrats kann die EU autonome Sanktionen im Rahmen der GASP beschließen. Der Blick auf die Entwicklung der Sanktionsakte der EU zeigt einen kontinuierlichen Anstieg (siehe Grafik 2), insbesondere bei den Ratsbeschlüssen und Ratsverordnungen.
Insgesamt hat die EU derzeit mehr als dreißig Sanktionsregime implementiert.25 Deren Analyse zeigt auf der einen Seite, dass Sanktionen häufig als Reaktion auf geopolitische Konflikte eingesetzt wurden, wie beispielsweise die Sanktionen im Zuge der Jugoslawienkriege, im Kampf gegen den Terror, aber auch gegen das iranische Atomprogramm. Auf der anderen Seite spiegelt der vermehrte Einsatz von Sanktionen auch wichtige vertragliche Reformen wider, darunter die Entwicklung der GASP im Rahmen des Maastricht-Vertrags sowie Bestimmungen des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), der in Artikel 215 das Verfahren für die Annahme von Sanktionen gegen Drittländer festlegt. Restriktive Maßnahmen sind folglich zum wichtigsten außenpolitischen Instrument der EU avanciert.
Die Bedeutung restriktiver Maßnahmen zeigt sich auch an der europäischen Reaktion auf den russischen Krieg gegen die Ukraine. Seit Februar 2022 hat die EU zwölf Sanktionspakete gegen Russland verhängt, um Russlands Wirtschaft zu schwächen und dem Kreml die Mittel zur Finanzierung des Krieges zu kappen. Eingefrorene russische Gelder könnten in diesem Zusammenhang für den Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden. Sie ergänzen die bestehenden Maßnahmen, die infolge der russischen Annexion der Krim und der Nichtumsetzung der Vereinbarung von Minsk verhängt wurden. Auffallend war zu Beginn der schnelle und gemeinsame Beschluss der europäischen Sanktionen. Gleichzeitig diskutiert die EU von jeher, wie die Durchsetzung von Sanktionen verbessert werden kann. Im Dezember 2023 erzielten das EP und der Rat eine erste Einigung darüber, die Umgehung von Sanktionen unter Strafe zu stellen.
Als Instrument der GASP müssen Sanktionen einstimmig vom Europäischen Rat beschlossen werden. In der Praxis führt das oftmals zu einem Zielkonflikt zwischen den normativen Ambitionen der EU und den nationalen Interessen der Mitgliedstaaten. Auch bei den EU-Sanktionen gegen Russland haben einzelne Regierungen immer wieder versucht, ihre nationalen Interessen durchzusetzen. Im Mai 2023 hat beispielsweise Ungarn 500 Milliarden Euro Militärhilfe im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität (EPF)26 blockiert, weil die Ukraine die ungarische Bank OTP als Kriegssponsor Russlands einstuft. Aber auch andere Mitgliedstaaten zögerten, dem elften Sanktionspaket zuzustimmen. So lehnte Deutschland die Aufnahme von acht chinesischen Unternehmen in die EU-Sanktionsliste ab, um Drittländer nicht zu vergraulen. Am Ende zog Deutschland seine Einwände zurück, nachdem die Kommission eine Strategie zur Kontaktaufnahme mit Drittländern entwickelt hatte und lediglich drei der acht chinesischen Unternehmen auf der Liste blieben.
Nach der russischen Invasion der Ukraine hat die EU mit ihren westlichen Partnern eine zuvor selten gesehene Einigkeit und Entschlossenheit demonstriert.
Um auch zukünftig in globalen Krisen handlungsfähig zu sein, haben deshalb einige EU-Staaten die Einführung qualifizierter Mehrheitsentscheidungen wieder prominenter auf die EU-Agenda gebracht. Die Diskussion über Mehrheitsentscheidungen in der GASP ist keineswegs neu. In der Vergangenheit gab es bereits Versuche wie die deutsch-britische Initiative im Jahr 2014 oder die Bemühungen von Kommissionpräsident Juncker, mehr GASP-Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit (Qualified Majority Voting, QMV) zu treffen. Entsprechende Reformen konnten allerdings nicht zuletzt aufgrund vertraglicher Einschränkungen und Legitimationsfragen bislang nicht umgesetzt werden.27 Im Zuge der sogenannten Zeitenwende nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben sich mehrere Initiativen für Mehrheitsbeschlüsse in der Union gebildet. Anlässlich der Prager Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz im Mai 2022 sprachen sich auch einige europäische Außenministerinnen und Außenminister für Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit in der EU-Außenpolitik aus.28 Dabei wiesen sie aber explizit darauf hin, dass es nicht um eine umfangreiche Änderung der EU-Verträge gehen sollte, sondern um eine pragmatische Entscheidung für bestimmte Bereiche, die derzeit verankerten Bestimmungen auf flexiblere Art zu nutzen.
Ein Blick auf das öffentliche Abstimmungsverhalten in der auswärtigen Formation des Rats zeigt, dass seit 2010 nur wenige Entscheidungen durch Gegenstimmen blockiert wurden. Dies trifft aber lediglich auf Bereiche zu, in denen QMV als Standard gilt, wie etwa die Handelspolitik oder Umweltmaßnahmen im außenpolitischen Kontext. In der GASP selbst hingegen ist das Prinzip der Einstimmigkeit vorherrschend, was bedeutet, dass eine Maßnahme nur mit den Stimmen aller Mitgliedstaaten beschlossen werden kann. Oftmals beeinflusst allein schon die Androhung eines Vetos und das Wissen um eine mögliche Blockade die politische Diskussion zu außenpolitischen Entscheidungen. Mehrheitsentscheidungen funktionieren also am besten, wenn sie Mitgliedstaaten zu Kompromissen bewegen können, die sie im Fall eines einzelstaatlichen Vetorechts abgelehnt hätten.29 Wenngleich es mit der sogenannten Passerelle-Klausel – einem Mechanismus, der es ermöglicht, statt einer einstimmigen Entscheidung eine Mehrheitsentscheidung zu treffen, ohne dafür die EU‑Verträge formal ändern zu müssen; oder einer »Super-Super-QMV-Option«, einer erweiterten Form von Mehrheitsentscheidungen – unterschiedliche Wege gäbe, den Entscheidungsprozess im Rat zu reformieren, bedarf eine solche Veränderung dennoch jeweils der Einstimmigkeit aller Mitgliedstaaten. Sofern sich die aktuellen politischen Mehrheiten im Europäischen Rat nicht grundlegend verändern, dürfte eine umfassende Reform der GASP aber unwahrscheinlich sein.30
Neue Weichenstellungen für die europäische Außenpolitik
Die russische Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 hat für die EU eine neue außenpolitische Ära eingeleitet. Gemeinsam mit ihren westlichen Partnern konnte die Union eine zuvor selten gesehene Einigkeit und Entschlossenheit demonstrieren. Sie hat nicht nur eine Vielzahl von Sanktionspaketen beschlossen, sondern auch zum ersten Mal eigene Waffen an ein angegriffenes Land geliefert. Gleichzeitig hat die Ad-hoc-Mobilisierung bestehende strukturelle Probleme in der europäischen Außenpolitik offengelegt. Mit Blick auf die integrationspolitischen Entwicklungen in der GASP seit dem Vertrag von Lissabon und die neuen Herausforderungen in einem konfliktreichen internationalen Umfeld ergeben sich für die EU verschiedene Pfade, ihre Handlungsfähigkeit als außenpolitische Akteurin zu verbessern.
Die größte Herausforderung bleibt der intergouvernementale Charakter der GASP. Immer wieder verhindern einzelne EU-Mitgliedstaaten durch das Androhen ihres Vetos eine schnelle und entschiedene Positionierung der EU. Das beeinflusst vor allem die äußere Wahrnehmung der EU, die vielfach als zögerliche außenpolitische Akteurin gilt. Als Kommissionspräsident Juncker bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2018 die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen im Zusammenhang mit Menschenrechten, Sanktionen und zivilen Aspekten der GSVP vorschlug, zeigte sich lediglich eine Minderheit der EU-Mitgliedstaaten dafür offen. Seit Russlands Krieg gegen die Ukraine haben sich jedoch die Positionen einiger Mitgliedstaaten verändert. Zum einen sprachen sich mittel- und osteuropäische Staaten wie Slowenien und Rumänien für die gezielte Nutzung der Passerelle-Klausel in der Außenpolitik aus.31 Zum anderen kam es zum zweiten Mal zu konstruktiven Enthaltungen bei Entscheidungen zur EU-Außenpolitik. Bei der Entscheidung über EU-Waffenlieferungen und die Ausbildungsmission für das ukrainische Militär haben sich Irland, Malta und Österreich enthalten, damit die Mission umgesetzt werden konnte.
Der russische Krieg hat außerdem verdeutlicht, wie wichtig eine gemeinsame Lesart der internationalen Bedrohungen innerhalb der EU ist. Während vor allem osteuropäische Länder eine resolute Antwort forderten, haderten viele Staaten wie Deutschland und Frankreich mit einer stärkeren Rolle der EU. Gleichzeitig bildete sich durch den massiven öffentlichen Druck auf die EU eine gemeinsame strategische Herangehensweise heraus. Diese Entwicklung unterstreicht einerseits das Potential für eine größere transnationale Debatte in der europäischen Außenpolitik. Andererseits verweist sie auf die Bedeutung demokratischer Legitimation, allen voran durch eine aktivere Einbindung des Europäischen Parlaments. Trotz der schon beschriebenen Straffung und Vereinheitlichung des Budgets durch neue Finanzierungsinstrumente in der GASP sollte die EU zudem ihre finanziellen Ressourcen weiter aufstocken, um noch überzeugender als flexible und bedeutsame außenpolitische Akteurin auftreten zu können.
Unterdessen hat der Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas die innereuropäische Spaltung abermals deutlich werden lassen. Nachdem Olivér Várhelyi, EU-Kommissar für Erweiterung und Europäische Nachbarschaftspolitik, ein Einfrieren der Hilfen für die palästinensischen Gebiete angekündigt hatte, musste die EU wieder zurückrudern, da dieser Schritt ohne Rücksprache mit anderen Kommissaren oder nationalen Regierungen erfolgt war. Der EU-Gipfel am 26. Oktober 2023 offenbarte eine Spaltung zwischen entschiedenen Befürwortern Israels und anderen, die den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza stärker betonen wollten. Von der Leyen selbst wurde wegen ihrer nachdrücklichen Unterstützung für Israels Selbstverteidigungsrecht kritisiert. Viele in der EU betrachteten ihre diesbezügliche Erklärung als unausgewogen und hielten von der Leyen nicht für berechtigt, in ihrem Namen außenpolitische Statements abzugeben. Eine solche Spaltung spielt im Zweifelsfall nicht nur anderen Akteuren in die Karten, sie erschwert es darüber hinaus auch, eine europäische Führungsrolle zu beanspruchen.
Durch den Ausbau gemeinsamer Analysekapazitäten und regelmäßiger Konsultationen ließe sich eine stärkere gemeinsame strategische Ausrichtung erreichen.
Mit Blick auf die Legislaturperiode nach den Europawahlen 2024 werden vor allem nationale Wahlen und Koalitionsentscheidungen für die Kohärenz der GASP von Bedeutung sein.32 Vor diesem Hintergrund sollte die EU kurzfristig auf pragmatische Entscheidungen zurückgreifen, um gemeinsames Handeln in ihrer Außenpolitik zu erleichtern. Insbesondere die Möglichkeit konstruktiver Enthaltung kann ein ambitionierteres Vorgehen in der GASP ermöglichen. Zudem könnte in den Bereichen, in denen zwar keine formale Abstimmung erforderlich, gleichwohl aber Konsens gängige Praxis ist, zukünftig mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden. Durch den Ausbau gemeinsamer Analysekapazitäten und regelmäßiger Konsultationen ließe sich eine geschlossenere gemeinsame strategische Ausrichtung erreichen. Nicht zuletzt sind ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen für die GASP essenziell, um die Wirksamkeit der europäischen Außenpolitik zu gewährleisten. Neben der flexibleren Finanzierung bedarf es dazu vor allem einer systematischen Evaluation sowie einer integrierten Vernetzung.
In Anbetracht einer möglichen EU-Erweiterung nach 2030 sollte sich die Union mittelfristig auf eine umfangreiche Vertragsänderung vorbereiten. Dabei sollte sie eine vertiefte Integration der GASP anstreben, um ihre Handlungsfähigkeit zu verbessern. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung könnte insbesondere die Einführung von Mehrheitsentscheidungen in der EU-Außenpolitik durch die Passerelle-Klausel sein. Die deutsche Regierung sollte mittelfristig auf diesbezüglich skeptische Regierungen zugehen, um eine umfassendere Reform der Außenpolitik vorzubereiten. Um die demokratische Legitimität zu stärken, sollte das Europäische Parlament eine noch aktivere Rolle bei der Überwachung und Kontrolle der GASP spielen. Dies könnte durch eine verstärkte Einbindung des Parlaments in Entscheidungsprozesse, durch regelmäßige Berichterstattung sowie durch eine Aufwertung parlamentarischer Anhörungen erreicht werden. Zudem sollte die Rollenverteilung zwischen den verschiedenen institutionellen Akteuren klarer definiert werden.
Schließlich braucht es vor allem den erkennbaren politischen Willen der nationalen Regierungen, eine gemeinsame europäische Außenpolitik umzusetzen. In den zurückliegenden Jahren ist es den Regierungen allerdings nicht gelungen, die Lücke zwischen den hohen Erwartungen an die GASP und deren Fähigkeiten zu kollektiver Entscheidungsfindung zu schließen. Immerhin hat das deutsche Außenministerium zuletzt bereits wichtige Akzente gesetzt. Die Freundesgruppe für Qualifizierte Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik der EU ist hierfür ein gutes Beispiel.33 Auf diesem Momentum sollte die deutsche Regierung aufbauen, um mittelfristig eine gemeinsame und handlungsfähige EU-Außenpolitik zu stärken.
Tabelle 1 Finanzierung und Instrumente für das auswärtige Handeln der Europäischen Union
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
European Neighbourhood Instrument (ENI) |
1.633 |
1.579 |
2.329 |
1.924 |
2.278 |
2.060 |
2.352 |
(NDICI) |
(NDICI) |
|
Development Cooperation Instrument (DCI) |
1.802 |
2.142 |
2.729 |
2.769 |
2.735 |
2.796 |
2.887 |
(NDICI) |
(NDICI) |
|
Partnership instrument for cooperation with third countries (PI) |
39 |
94 |
109 |
136 |
101 |
100 |
133 |
(NDICI) |
(NDICI) |
|
European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) |
123 |
154 |
181 |
168 |
169 |
159 |
175 |
(NDICI) |
(NDICI) |
|
Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP) |
260 |
234 |
316 |
294 |
325 |
321 |
350 |
(NDICI) |
(NDICI) |
|
Humanitarian aid (HUMA) |
1.042 |
975 |
1.471 |
1.146 |
1.130 |
1.603 |
1.275 |
1.900 |
2.091 |
|
Common Foreign and Security Policy (CFSP) |
235 |
268 |
299 |
294 |
292 |
306 |
329 |
328 |
333 |
|
Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC) |
56 |
60 |
97 |
81 |
45 |
41 |
33 |
32 |
32 |
|
Guarantee Fund for external actions (GF) |
58 |
144 |
257 |
241 |
138 |
0 |
233 |
(NDICI) |
(NDICI) |
|
Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI)* |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
6.964 |
7.891 |
|
Overseas countries and territories (OCTs) |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
33 |
52 |
|
Gesamtbudget für Globales Europa / Nachbarschaft und die Welt |
8.405 |
8.659 |
8.951 |
9.395 |
9.666 |
9.945 |
10.274 |
11.261 |
12.916 |
Bereits mit ihrer Gründung durch den Maastrichter Vertrag von 1993 deutete die Europäische Union an, dass sie auch eine sicherheits- und verteidigungspolitische Komponente entwickeln wollte: So bestimmte sie die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) zu einer ihrer drei Säulen. Obgleich die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU (GSVP) streng genommen erst 2007 mit dem Vertrag von Lissabon begründet worden ist, sind die wesentlichen Grundzüge dieses europäischen Politikfeldes bereits im Jahr 2001 mit dem Vertrag von Nizza unter der Bezeichnung Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) abgesteckt worden. Damit konnte die EU erstmals auf eigene, von den Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellte Kontingente an militärischen und zivilen Einsatzkräften zurückgreifen.
Der Krieg in der Ukraine hat die Schwächen der EU als internationaler Akteur jedoch erneut deutlich gemacht. Obwohl die EU ein Wirtschafts-, Handels- und Regulierungsriese ist, fiel es ihr vor dem 24. Februar 2022 schwer, sich als bedeutender sicherheitspolitischer Akteur zu etablieren. Vor allem in ihrer Russland-Politik war sie in den vergangenen Jahren tief gespalten. Darüber hinaus scheiterten die Versuche, eine wirksame Nachbarschaftspolitik der EU zu entwickeln, insbesondere eine »Östliche Partnerschaft«, die sich auf die Grenzstaaten zwischen der Union und Russland konzentriert. In der Auseinandersetzung zwischen Russland und dem Westen um die Ukraine wurde die EU vor dem Krieg sowohl von Moskau als auch von Washington an den Rand gedrängt. Erst mit dem Kriegsausbruch hat die EU zu einem Konsens gefunden, der für ein wirksames sicherheitspolitisches Handeln Voraussetzung ist. Dies betrifft vor allem die Nutzung von Sanktionen, berührt aber auch die Weiterentwicklung der GSVP, die in diesem Kontext eine Fülle von neuen Maßnahmen ergriffen hat. Ob diese auf Dauer eine neue integrationspolitische Dynamik entfalten können, bleibt abzuwarten, denn zum einen könnte das derzeit erkennbare Momentum nach einem russisch-ukrainischen Friedensschluss wieder erlahmen und zum anderen bleiben die drei zentralen Integrationshindernisse, auf die noch einzugehen sein wird, davon unberührt.
Die Ziele der GSVP
Ausgehend von der am Ende der 1990er Jahre, insbesondere in den Jugoslawienkriegen, zutage getretenen Handlungsunfähigkeit der EU, ist die fortschreitende Institutionalisierung der GSVP auf zwei Ziele ausgerichtet:
Erstens soll die Kohärenz in diesem Politikfeld erhöht werden, das heißt, die EU soll sicherheitspolitisch möglichst geschlossen auftreten. Da die GSVP intergouvernemental organisiert ist, bleibt dies nach wie vor eine Herausforderung. Angesichts der Tatsache, dass die GSVP im Vertrag über die Europäische Union (EUV) als integraler Bestandteil der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik konzipiert ist, reicht dieses Kohärenzgebot über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik im engeren Sinne hinaus. So wird der Rat für Auswärtige Angelegenheiten nicht einer GSVP-Krisenmanagementoperation in einem spezifischen Land oder einer Region zustimmen, ohne dass ein Konsens über die überwölbenden außenpolitischen Ziele existiert, die die EU dort zu erreichen sucht.
Zweitens soll die Handlungsfähigkeit der EU im Bereich der Sicherheitspolitik geschaffen, erhalten und weiterentwickelt werden. Mehr noch: Gemäß Artikel 42 Absatz 2 EUV umfasst die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik »die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Diese führt zu einer gemeinsamen Verteidigung, sobald der Europäische Rat dies einstimmig beschlossen hat.« Der Stand der Integration in diesem Politikfeld lässt sich daher vordergründig – nicht aber analytisch – mit folgenden simplen Fragen ermessen: Ist die EU in diesem Politikfeld mit dem Lissabonner Vertrag handlungsfähiger geworden? Ist die Integrationsdynamik erlahmt oder sind sogar Rückschritte zu verzeichnen? Dass der Rat zehn Jahre nach dem Vertrag von Lissabon Verbesserungsbedarf sieht, lässt sich aus seiner »New Strategic Agenda 2019–2024« vom Juni 2019 klar herauslesen. Darin heißt es unter anderem: »Die GASP und GSVP der EU müssen reaktionsfähiger und aktiver werden und besser mit den anderen Bereichen der Außenbeziehungen verknüpft werden. Die EU muss auch mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit und Verteidigung übernehmen, indem sie insbesondere die Verteidigungsinvestitionen, die Entwicklung der Fähigkeiten und die Einsatzbereitschaft fördert.«1
Die GSVP umfasst gemäß Artikel 43 Absatz 1 EUV erstens eine breite Palette von Maßnahmen zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit, nämlich »gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen, humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, Aufgaben der militärischen Beratung und Unterstützung, Aufgaben der Konfliktverhütung und der Erhaltung des Friedens sowie Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung einschließlich Frieden schaffender Maßnahmen und Operationen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten«. Schaut man auf die konkrete Ausgestaltung der GSVP, so galt ihre operative Priorität dem militärischen und zivilen Krisenmanagement in der Peripherie Europas.
Die Entwicklung der GSVP lässt sich 15 Jahre nach dem Lissabonner Vertrag sehr unterschiedlich bewerten.
Daneben ist, zweitens, mit Artikel 42 Absatz 7 EUV die Perspektive des Beistands hinzugetreten, die den Namen dieses Politikfelds rechtfertigt: »Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung, im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen.« Für die Unterstützung wurde kein formelles Verfahren vorgegeben. Die Klausel legt zudem nicht fest, dass eine militärische Unterstützung zwingend erfolgen sollte. EU-Mitgliedstaaten wie Österreich und Irland (sowie früher Finnland und Schweden) können somit unter Wahrung ihrer Neutralität kooperieren. Im November 2015 wurde die Beistandsklausel zum ersten und bislang einzigen Mal aktiviert – als Reaktion Frankreichs auf die Bataclan-Anschläge.2 Zurzeit scheint eine erneute Aktivierung in weiter Ferne zu liegen, dabei könnte dieser Aspekt zukünftig wieder operative Bedeutung gewinnen, wenn der Ukraine der Weg in die Nato dauerhaft versperrt sein und sie zuvor EU-Mitglied werden sollte. Dann könnte dieser Regelung eine Art Brückenfunktion zukommen.
Zentrale Governanceproblematik
Je nach Maßstab wird man 15 Jahre nach dem Lissabonner Vertrag zu einer sehr unterschiedlichen Bewertung der Entwicklung der GSVP kommen. Einerseits hat die Zahl der laufenden Krisenmanagementoperationen in den letzten Jahren abgenommen, was sich als Ausdruck einer reduzierten Handlungsfähigkeit interpretieren ließe. Andererseits lassen sich die vielen institutionellen Neuerungen der vergangenen Jahre auch so lesen, dass es gelungen ist, durch die Konzentration auf sekundäre Funktionen, wie etwa die Rüstungszusammenarbeit, eine gewisse Dynamik in der GSVP zu erhalten. Unstrittig sind jedoch die Variablen, die die Herausbildung einer echten »Europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion« (ESVU) von Beginn an erschwert bzw. verhindert haben.3
Einschränkung durch die intergouvernementale Ausrichtung
Da sich die Rechtsgrundlage der GSVP seit 2009 nicht wesentlich verändert hat, gilt auch weiterhin der Befund: Die erste und wohl wirkmächtigste Beschränkung der Entwicklungsmöglichkeit der GSVP ist die intergouvernementale Ausrichtung dieses Politikfeldes. Der EUV presst die GSVP in ein enges Korsett mitgliedstaatlicher Prärogative, indem jeder integrationspolitische Schritt nach vorn im Vertragstext zugleich mit entsprechenden nationalen Caveats kraftvoll ausgebremst wird.4 So werden die Beschlüsse zur GSVP einstimmig gefasst, was all die bekannten Folgen dieses Entscheidungsverfahrens zeitigt – jedes EU-Mitglied verfügt de facto über ein Vetorecht.5 Nicht nur, dass die Mitgliedstaaten das letzte Wort über den politischen Weg der GSVP haben, von ihnen hängt auch die Handlungsfähigkeit der EU in diesem Politikfeld ab, denn laut Artikel 42 Absatz 3 EUV sind sie es, die die notwendigen militärischen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellen.
Zwar existieren mittlerweile Spurenelemente differenzierter Integration auch für den Bereich der GSVP, auf die noch einzugehen sein wird. Handlungspotentiale für differenzierte Integration in diesem Bereich in Gestalt eines kooperativen Zusammenwirkens von Union und Mitgliedstaaten eröffnet zum Beispiel die sogenannte Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (SSZ). Einer Gruppe williger und fähiger Mitgliedstaaten soll dies Möglichkeiten der Kooperation eröffnen, die im Verbund aller Mitglieder nicht zustande käme.6 Bislang bleiben diese jedoch den Nachweis schuldig, dass sie eine größere Handlungsfähigkeit im Bereich der GSVP gewährleisten können. In Deutschland bestehen zudem hohe verfassungsrechtliche Hürden für die Übertragung von Hoheitsbefugnissen im Bereich der GSVP auf die EU. In seiner Lissabon-Entscheidung formulierte das Bundesverfassungsgericht hierzu 2009 deutlich: »Der konstitutive Parlamentsvorbehalt für den Auslandseinsatz der Streitkräfte besteht auch nach einem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon fort. Der Vertrag von Lissabon überträgt der Europäischen Union keine Zuständigkeit, auf die Streitkräfte der Mitgliedstaaten ohne Zustimmung des jeweils betroffenen Mitgliedstaates oder seines Parlaments zurückzugreifen.«7 Diese rechtliche Hürde müssen all diejenigen nehmen, die eine Vertiefung der GSVP politisch anstreben.
Einschränkung durch eine fehlende Vertiefungsoption
Gerade das Letztgesagte weitet den Blick für die zweite Beschränkung der GSVP: Sie befindet sich in einer integrationspolitischen Sackgasse und verfügt, im Gegensatz zu anderen Politikfeldern, zurzeit nicht über eine ernsthafte Vertiefungsperspektive. Europapolitiker camouflieren dies bisweilen gerne, wenn sie von der ESVU als dem nächsten denkbaren oder sogar anzustrebenden Schritt sprechen. Auch in der öffentlichen Meinung finden sich immer wieder hohe Zustimmungswerte für entsprechende Maßnahmen.8 Letztlich herrscht jedoch eine grundsätzliche Skepsis gegen entsprechende Integrationsschritte in diesem Bereich vor, der nach wie vor als Kernbereich nationalstaatlicher Souveränität wahrgenommen wird. Die durchwachsene Bilanz der GSVP verstärkt diese Vorbehalte. Natürlich kann sich hier in den kommenden Jahrzehnten vieles ändern, aber nach aktueller Lage der Dinge lässt der EUV eine vertiefte Integration in diesem Politikfeld nicht zu.
Diese Tatsache hat wiederum erkennbar einen »kompensatorischen Integrationspfad« zur Folge. Da der EUV die hochgeschraubten Erwartungen in diesem Politikfeld nicht erfüllen kann und die Handlungsfähigkeit mit dem existierenden Instrumentarium der GSVP nicht dauerhaft gesteigert werden konnte, kompensieren die beteiligten Akteure dies durch institutionelle und operative Ausweichstrategien: Sie bilden minilaterale Handlungsformate außerhalb der GSVP (Beispiel: Europäische Interventionsinitiative); sie fokussieren auf nachgeordnete Kooperationsaspekte, die für die GSVP zwar nicht unwichtig, für die politische Handlungsfähigkeit im engeren Sinne aber nicht entscheidend sind (Beispiel: rüstungspolitische Zusammenarbeit), und sie generieren zusätzliche Ressourcen außerhalb des vertraglich fixierten Rahmens. So hat der Rat im März 2021 die Europäische Friedensfazilität (EPF) geschaffen. Sie ist ein Instrument, mit dessen Hilfe die EU-Mitgliedstaaten die Fähigkeit der Union zur Konfliktverhütung, Friedenskonsolidierung und Stärkung der internationalen Sicherheit verbessern wollen. Die EPF ist an die Stelle der früheren Finanzierungsinstrumente in diesem Bereich getreten, also des Athena-Mechanismus und der Friedensfazilität für Afrika. Gleichzeitig ist ihr Anwendungsbereich ausgeweitet worden: Über die EPF dürfen operative Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen finanziert werden. Um Drittstaaten, regionale oder internationale Organisationen sicherheits- und verteidigungspolitisch zu stärken, können über diese finanziellen Mittel Kapazitäten im Militär- und Verteidigungssektor ausgebaut und/oder militärische Aspekte von Friedensoperationen unterstützt werden.
Einschränkung durch funktionale Duplizierung
Die dritte Einschränkung ergibt sich aus der Tatsache, dass die zentrale Funktion der GSVP, nämlich Europa eine genuine sicherheits- und verteidigungspolitische Handlungsfähigkeit im euro-atlantischen Raum und seiner Peripherie zu verleihen, funktional in weiten Teilen von der Nato als dominanter Organisation der westlichen Sicherheit wahrgenommen wird.
Die GSVP ist bemüht, die zentrale Bedeutung der Nato für jene Länder nicht zu schmälern, die sowohl Mitglied der EU als auch der Nato sind.
Wie ein roter Faden zieht sich daher durch die GSVP-Geschichte das Bemühen, die zentrale Bedeutung der nordatlantischen Allianz für diejenigen Länder nicht zu schmälern, die sowohl Mitglied der EU als auch der Nato sind. Auch der EUV schreibt dieses institutionelle Kräfteverhältnis in Artikel 42 Absatz 2 bzw. Absatz 7 fest: »Die Politik der Union nach diesem Abschnitt berührt nicht den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantikvertrag und ist vereinbar mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. […] Die Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich bleiben im Einklang mit den im Rahmen der Nordatlantikvertrags-Organisation eingegangenen Verpflichtungen, die für die ihr angehörenden Staaten weiterhin das Fundament ihrer kollektiven Verteidigung und das Instrument für deren Verwirklichung ist.«
Doch losgelöst von den rechtlichen Rahmenbedingungen überschattet der politische Dissens innerhalb der EU um das Verhältnis der GSVP zur Nato und zu den USA seit Jahren die Weiterentwicklung dieses Politikfelds. Etwas vergröbert lassen sich zwei Lager identifizieren: zum einen diejenigen EU-Mitglieder, die wie Frankreich unter dem Banner »strategischer Autonomie« bzw. »strategischer Souveränität« eine eigenständigere sicherheitspolitische Rolle der EU in Abgrenzung zu den USA fordern und dies institutionell, militärisch und finanziell zu unterlegen suchen;9 zum anderen diejenigen Staaten, die aus vielfältigen historischen Erfahrungen und politischen Erwägungen eine Schwächung der Nato durch eine Stärkung der GSVP befürchten.
Aufgrund der Erfahrung des russisch-ukrainischen Kriegs dürfte das zweite Lager Aufwind bekommen haben, da im Kontext dieses Krieges schmerzhaft deutlich geworden ist, dass auf nicht absehbare Zeit nur die USA über die notwendigen militärischen Ressourcen verfügen, um die europäische Sicherheit zu gewährleisten.10 Solange dies der Fall ist, werden sich viele EU-Mitglieder mit ihrer Unterstützung für die GSVP zurückhalten.
Die Existenz der Nato als einer funktionalen Alternative erklärt auch, warum der externe Schock des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht zu einem qualitativen Integrationssprung in der GSVP geführt hat. Ein solcher wäre angesichts der Erschütterung der euro-atlantischen Sicherheitsordnung grundsätzlich vorstellbar gewesen. Zumindest sind die Impulse für die Gründung einer EU-Verteidigungsunion bislang ausgeblieben, auf die einige Beobachter gesetzt hatten. Lediglich spekulieren lässt sich an dieser Stelle über die mögliche Auswirkung eines Bedeutungsverlustes der Nato auf die amerikanische Außenpolitik: Zwar könnte ein möglicher Regierungswechsel in Washington zu einer Schwächung der Beistandsgarantie führen.11 Aber auch dieser externe Schock müsste nicht zwangsläufig zu einer größeren Integrationsdynamik führen, denn den GSVP-skeptischen EU-Mitgliedern stünden weiterhin alternative Handlungspfade zur Verfügung, zum Beispiel die Vertiefung ihrer bilateralen Sicherheitsbeziehungen zu den USA oder eine vollständige Renationalisierung ihrer jeweiligen Sicherheitspolitik.
Stand der Integration
Der aktuelle Stand der Integration in diesem Politikfeld lässt sich an drei zentralen Bereichen ablesen: an der Entwicklung gemeinsamer Verteidigungsfähigkeiten, an der Entwicklung der GSVP-Missionen bzw. ‑Operationen sowie an der Reaktion der EU auf den russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022.
PESCO – EVF – CARD
Der EUV ermöglicht es einzelnen EU-Mitgliedstaaten, die sich in der GSVP in besonderem Maße engagieren wollen, ihre Kooperation im militärischen Bereich zu verstärken und eine »Ständige Strukturierte Zusammenarbeit« (SSZ/engl. PESCO) zu begründen. Dies kann die Interoperabilität zwischen EU-Mitgliedstaaten im Wehrbereich, etwa eine Synchronisierung der nationalen Streitkräftestrukturen, oder die Durchführung gemeinsamer Rüstungsprojekte betreffen. Tatsächlich haben die Außen- und Verteidigungsminister von immerhin 25 EU-Mitgliedstaaten im November 2017 dem Europäischen Rat mitgeteilt, diesen Weg künftig gemeinsam beschreiten zu wollen.12
Der Eindruck integrationspolitischer Dynamik täuscht jedoch: Im Jahr 2022 hat eine Evaluierung der im Winter 2017 begonnenen sogenannten Permanent Structured Cooperation (PESCO) enthüllt, dass die Mitgliedstaaten diesen Rahmen nicht voll nutzen. Obgleich sie politisch den Mehrwert der PESCO unterstreichen, blieben die Fortschritte bei der Umsetzung der Initiative hinter den Erwartungen zurück: Sie gäben ihr Geld nicht gemeinsam aus, planten nicht europäisch, und von den wenigen Projekten, die funktionierten, gehe keine Dynamik aus. Ihre Bemühungen um Verteidigungsplanung hätten die Mitgliedstaaten nicht im nötigen Maße zusammengeführt; die Verteidigungsinitiativen der EU würden weder ausreichend noch systematisch in der nationalen Planung und Entscheidungsfindung berücksichtigt. Von den 60 Projekten, die die Mitgliedstaaten seit 2017 im Rahmen der PESCO vereinbart hätten, werde nur etwa die Hälfte in der Lage sein, konkrete Ergebnisse zu liefern. Die Übrigen steckten hingegen noch in den Kinderschuhen oder erwiesen sich als dysfunktional. Dazu zählen auch 20 der 26 als vorrangig eingestuften Projekte. Im Gegensatz zu anderen Bereichen, in denen Agenturen oft als Integrationstreiber fungieren, kann die Europäische Verteidigungsagentur (EDA), in der das PESCO-Sekretariat angesiedelt ist, diese Rolle hier nicht einnehmen.13
Der Europäische Verteidigungsfonds (EVF) wurde 2017 zur Förderung von Kooperation und grenzüberschreitender Zusammenarbeit der Rüstungsindustrie innerhalb der EU geschaffen. Zunächst waren 5,5 Milliarden Euro pro Jahr vorgesehen. Im März 2019 wurde für die Finanzjahre 2019/20 eine Finanzierung von lediglich rund 500 Millionen Euro beschlossen, mit denen die bislang 34 gemeinsamen Projekte kofinanziert werden sollten. Im April 2021 hat das Europäische Parlament den Verteidigungsfonds endgültig beschlossen. Er wurde für die Jahre 2021 bis 2027 mit rund 7,95 Milliarden Euro ausgestattet. Davon sind rund 2,65 Milliarden Euro für Forschung vorgesehen, 5,3 Milliarden Euro für die gemeinsame Entwicklung und Beschaffung von Verteidigungsmaterial- und ‑technologie.
Weiterhin wichtig bleiben auch das Zusammenspiel und die Abstimmung der verschiedenen EU-Initiativen, beispielsweise mit dem Coordinated Annual Review on Defence (CARD)-Prozess zur jährlichen Überprüfung der Verteidigungsplanung. Die Initiativen ergänzen einander. So sollen die Fähigkeitslücken, die im CARD-Prozess auf europäischer Ebene identifiziert wurden, unter anderem durch PESCO geschlossen werden. Der EVF wiederum soll Anreize für die internationale Kooperation in der europäischen Verteidigungsindustrie schaffen und die europäische industrielle Basis stärken.
GSVP-Missionen und -Operationen
Die EU hat seit der Gründung der GSVP insgesamt 37 zivile und militärische Missionen im Rahmen des internationalen Krisenmanagements durchgeführt. Gegenwärtig laufen zwölf zivile Missionen und neun militärische Operationen; etwa 4.000 Militärangehörige und zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EU befinden sich im Rahmen der GSVP in einem Auslandseinsatz. Doch trotz dieser beeindruckenden Zahlen darf man nicht verkennen, dass die Dynamik der 1990er und 2000er Jahre, als die EU viele Operationen im robusten Einsatzspektrum initiiert hat, abgeflaut ist. Mittlerweile ist ein Trend zu weniger und begrenzteren Missionen mit Schwerpunkten in den Bereichen Sicherheitssektorreform, Ausbildung und Grenzüberwachung zu beobachten.14
Die GSVP wird absehbar kaum die ihr zugedachte Funktion erfüllen können: ein robustes Krisenmanagement in der europäischen Peripherie.
Dies hat vor allem mit dem problematischen Verlauf dieser europäischen sicherheitspolitischen Aktivitäten zu tun. Gerade die größeren Stabilisierungseinsätze, zum Beispiel im Kongo, haben trotz eines hohen Aufwands häufig nur bescheidene Ergebnisse hervorgebracht, einige schienen kein Ende zu nehmen, wieder andere waren mit ihrem Mandat überfordert. Einige wenige können bescheidene Erfolge vorweisen; andere hingegen sind weitgehend wirkungslos geblieben. Es ist nach Lage der Dinge unwahrscheinlich, dass der skizzierte Wandel der Operationen rückgängig gemacht werden kann, da es hierfür keine politische Mehrheit in der EU zu geben scheint. Die »Rückkehr« der kollektiven Verteidigung als Reaktion auf die russische Außenpolitik hat in vielen europäischen Hauptstädten zusätzlich die sicherheitspolitischen Gewichte verschoben. Im Ergebnis tritt eine paradoxe Situation ein: Die GSVP wird auf absehbare Zeit kaum diejenige Funktion erfüllen können, für die sie im Kern gegründet worden ist, nämlich das robuste Krisenmanagement in der europäischen Peripherie.
Die Zielsetzung, die globalen Konsequenzen einer dieser regionalen Krisen einzudämmen, ist jedoch Auslöser der jüngsten GSVP-Mission: Seit November 2023 haben die jemenitischen Huthi-Rebellen als Reaktion auf den Gaza-Krieg zahlreiche Raketen und Drohnen auf Handelsschiffe im Roten Meer abgeschossen, die tatsächliche oder vermeintliche Verbindungen zu Israel unterhalten. Angesichts dieser unsicheren, bedrohlichen Lage sehen sich viele Reedereien gezwungen, den Suezkanal zu meiden und für ihre Schiffe stattdessen den längeren Weg um die Südspitze Afrikas zu wählen. Das verteuert die Lieferung von Waren erheblich, verzögert sie um Wochen und gefährdet letztendlich den Verkehr von wichtigen Lebensmitteln, Kraftstoffen und humanitärer Hilfe auf der ganzen Welt.
Auf Initiative Frankreichs, Deutschlands und Italiens hat die EU am 19. Februar 2024 die maritime Militärmission Eunavfor Aspides beschlossen. Im Rahmen der Mission werden vier Kriegsschiffe für mindestens ein Jahr entsendet, die im Einsatzgebiet patrouillieren und Handelsschiffe begleiten sollen und dabei auch militärische Gewalt einsetzen dürfen, um anfliegende Raketen und Drohnen bzw. angreifende Schiffe zu zerstören. Das Mandat von Eunavfor Aspides ist gleichwohl ausschließlich defensiv ausgerichtet: Auch wenn es in der Sache plausibel wäre, hat die EU die Option ausgeschlossen, gegen die Infrastruktur der Huthi an Land militärisch vorzugehen.15
Der russische Angriff auf die Ukraine
Seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine nutzt die EU die bereits erwähnte Europäische Friedensfazilität (EPF), um die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen. Ursprünglich mit einem finanziellen Maximalbetrag von 5,7 Milliarden Euro für den Zeitraum 2021–2027 ausgestattet, hat die EU die Mittel für die EPF inzwischen bis 2027 auf 12 Milliarden Euro aufgestockt. Bis zum Sommer 2023 hat die EU der Ukraine im Rahmen der EPF militärische Unterstützung in Höhe von rund 5,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt bzw. Waffenlieferungen der Mitgliedstaaten an Kyjiw teilweise erstattet, um das Land bei der Abwehr der russischen Invasion zu unterstützen. Der Löwenanteil der EU-Gelder fließt in schwere militärische Ausrüstung. Ein kleinerer Betrag steht für Güter und Hilfslieferungen wie persönliche Schutzausrüstung, Verbandskästen und Kraftstoff zur Verfügung. Zunehmend werden aus den Geldern der EPF auch die Wartung und Reparatur bereits gespendeter Waffensysteme ermöglicht. Im Juli 2023 hat der Hohe Vertreter den Mitgliedstaaten vorgeschlagen, die EU-Waffenhilfe für die Ukraine um insgesamt 20 Milliarden Euro zu erhöhen und für vier Jahre (2024–2027) festzuschreiben, um eine durchgängige Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte zu gewährleisten.
Doch nicht nur zugunsten der Ukraine setzt die EU in bislang beispiellosem Maße Gelder für verteidigungspolitische Zwecke frei. So hat die EU-Kommission im Juli 2022 den »European defence industry reinforcement through common procurement act« (EDIRPA) vorgeschlagen, ein kurzfristig geltendes Instrument zur Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie für den Zeitraum 2022–2024. Mit diesem Instrument, das mit 500 Millionen Euro ausgestattet sein soll, können die Mitgliedstaaten gemeinsam den dringendsten Bedarf an Verteidigungsgütern decken, der durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine entstanden ist. Schließen sich mindestens drei Mitgliedstaaten bei der gemeinsamen Beschaffung der am meisten benötigten Verteidigungsgüter zusammen, können sie Gelder aus dem temporären Finanzierungsinstrument beantragen.16 Der Vorschlag zielt darauf ab, die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der gemeinsamen Beschaffung von Verteidigungsgütern zu verbessern. Interessanterweise findet sich die Rechtsgrundlage für EDIRPA in Artikel 173 EUV (Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie).
Schließlich hat der Ratsvorsitz im Juli 2023 mit dem Europäischen Parlament eine vorläufige Einigung über die Verordnung zur Förderung der Munitionsproduktion (»Act in Support of Ammunition Production«) erzielt. Mit dieser Vereinbarung werden 500 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt mobilisiert, um den Ausbau der Produktionskapazitäten für die Herstellung von Boden-Boden- und Artilleriemunition sowie von Flugkörpern zu unterstützen. Damit wird der dritte Strang des vom Rat im März 2023 vereinbarten Plans umgesetzt, mit dem die langfristige Steigerung der europäischen Munitionsproduktion zugunsten der Ukraine und der EU-Mitgliedstaaten sichergestellt werden soll. So bemerkenswert diese Entwicklungen sind, ändern sie langfristig in integrationspolitischer Hinsicht für die GSVP doch wenig; vor allem haben sie mit deren funktionalem Kern, wie er im Lissabonner Vertrag fixiert worden ist, nichts zu tun.
EUMAM Ukraine
Schließlich hat der Rat für Auswärtige Angelegenheiten am 17. Oktober 2022 beschlossen, eine Mission zur Unterstützung der Ausbildung ukrainischer Militärangehöriger einzurichten, die EU Military Assistance Mission in support of Ukraine (EUMAM Ukraine), und diese mit 106,7 Millionen Euro zu finanzieren. Mit dieser Mission betritt die EU insofern Neuland, als bisherige Ausbildungs- und Unterstützungsmissionen, die im Rahmen der GSVP durchgeführt worden sind, in dem jeweiligen Land stattgefunden haben. Die für die Ausbildung erforderliche Ausrüstung wird von den EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt und gemeinschaftlich über die EPF finanziert. Auch Drittstaaten können sich an der Mission beteiligen.
Die insgesamt 24 europäischen Teilnehmernationen planen, auf eigenem Territorium binnen zwei Jahren 15.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten aus- und weiterzubilden.17 Damit soll die Ausbildung, die Großbritannien seit Juni 2022 mithilfe mehrerer europäischer Armeen anbietet, darunter Schweden, die Niederlande und Dänemark, ergänzt werden. Die zwei Hauptquartiere von EUMAM Ukraine befinden sich in Polen und Deutschland.
Mittlerweile haben die Mitgliedstaaten den geplanten Umfang von EUMAM Ukraine bereits übertroffen: Bis Februar 2024 haben die an der Mission beteiligten EU-Mitglieder gut 40.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten aus- und weitergebildet. Bis zum Ende des Sommers 2024 sollen es rund 60.000 sein. Rund 250 Millionen Euro flossen bislang in die EU-Ausbildungsmission.18
Der Strategische Kompass
Der tiefe Einschnitt, den der russische Angriff auf die Ukraine für die GSVP bedeutet hat, zeigt sich auch an der jüngsten EU-Sicherheitsstrategie, dem »Strategischen Kompass«. Seine Erarbeitung wurde in der zweiten Jahreshälfte 2020 unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft initiiert und am 21. März 2022 unter französischer Ratspräsidentschaft durch die Billigung des Europäischen Rates abgeschlossen.19 Mit dem Dokument, das auf den vier Säulen »Handeln«, »Sichern«, »Investieren« und »Mit Partnern zusammenarbeiten« aufbaut, wollten sich die EU-Mitgliedstaaten einen ebenso ambitionierten wie realistischen Fahrplan für die Entwicklung von Fähigkeiten und Instrumenten geben, die sie in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik handlungsfähiger machen.
Russlands Einmarsch in die Ukraine hat dazu geführt, dass der Strategische Kompass noch einmal grundlegend überarbeitet wurde. Russland wird in dem 64-seitigen Dokument nunmehr in einer Art Leitmotiv als zentrale Bedrohung für die europäische Sicherheit bezeichnet. Die Renaissance der Machtpolitik in einer multipolaren Welt sieht der Strategische Kompass auch in der Herausforderung durch China, das als Kooperationspartner, wirtschaftlicher Wettbewerber und systemischer Rivale definiert wird.
Zwei gegensätzliche Entwicklungen prägen die GSVP in den letzten Jahren: eine partielle Supranationalisierung und eine differenziertere Integration.
Vor diesem Hintergrund gilt es, die Komplementarität zwischen der EU und der Nato stärker zu verankern, die Verteidigungsausgaben in Europa zu steigern und die Bemühungen um die Abwehr hybrider Bedrohungen sowie von Cyberangriffen deutlich zu verstärken. Die Umsetzung der zahlreichen Vorhaben soll bis zum Jahr 2030 erfolgt sein, viele Ziele sollen bereits 2025 erreicht sein. Dazu zählt im Bereich des Krisenmanagements etwa die sogenannte Rapid Deployment Capacity von bis zu 5.000 Einsatzkräften, die als modular organisierte Schnelleingreifkapazität aufgebaut werden und regelmäßig gemeinsam üben soll, damit die EU bei Ausbruch einer Krise rasch und entschlossen handeln kann – »nach Möglichkeit mit Partnern und notfalls allein«. Darüber hinaus sollen die militärischen Kommando- und Kontrollstrukturen der EU gestärkt und finanzielle Anreize für die Mitgliedstaaten geschaffen werden, Streitkräfte für zivile und militärische Missionen im Rahmen der GSVP bereitzustellen.20
Ausblick – Supranationalisierung und Differenzierung
In den letzten Jahren lassen sich gleichzeitig zwei scheinbar gegensätzliche Entwicklungen in der GSVP ausmachen:
Einerseits ist eine partielle Supranationalisierung zu beobachten, nicht im Sinne einer rechtlichen Vergemeinschaftung, sondern dadurch, dass die Kommission neue Aufgaben zugewiesen bekommt bzw. diese an sich nimmt.21 Diese Tendenz lässt sich vor allem an der Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds, an der Schaffung der neuen Generaldirektion der Kommission DEFIS (Defence Industry and Space) und an der Bereitstellung von EU-Haushaltsmitteln im Rahmen des Aktionsplans zur Förderung militärischer Mobilität ablesen.22 Generell ist die Rolle der Kommission in der GSVP gestärkt, ja im Kern erst geschaffen worden, vor allem durch die intensivere Nutzung ihrer Binnenmarktkompetenzen für die rüstungspolitischen Ziele der GSVP.
Die beiden nächsten Schritte sind bereits klar erkennbar: Zum einen wird sich nach den europäischen Wahlen ein Kommissar ausschließlich um den Bereich »Verteidigung« kümmern. Auch wenn dessen Portfolio erst noch inhaltlich ausgefüllt werden muss, ist schon jetzt absehbar, dass zu seinen Aufgaben zentrale Fragen der europäischen Rüstungsproduktion wie Standardisierung, gemeinsame Fertigung und Beschaffung gehören werden.23
Zum zweiten wird die European Defence Industrial Strategy, die die EU-Kommission am 5. März 2024 vorgelegt hat, den politischen und finanziellen Rahmen für diese Maßnahmen bilden. Ziel dieser Strategie ist es, die europäische Rüstungsindustrie zu stärken und dafür bis zum Jahr 2035 65 Prozent der Verteidigungsausgaben der Mitgliedsstaaten in den europäischen Rüstungsmarkt zu lenken. Darüber hinaus soll die Kooperation der Länder untereinander gefördert werden. Dazu soll mit dem Europäischen Rüstungsprogramm ein neuer Rechtsrahmen entstehen, der die Rüstungskooperation von drei Mitgliedstaaten unterstützt: Sie erhalten künftig europäische Fördermittel und werden von der Mehrwertsteuer für jene Rüstungsgüter befreit, die die Teilnehmer gemeinsam besitzen. Zudem soll die Transformation von Lieferketten gefördert und eine Möglichkeit eingeführt werden, die militärische Produktion zu priorisieren.24
Unterlegt ist die Strategie mit 1,5 Milliarden Euro für den Zeitraum 2025–2027. Industriekommissar Breton hat für die Zukunft bereits einen mit 100 Milliarden Euro ausgestatteten Fonds ins Spiel gebracht, mit dem die Staaten in Europa Waffen kaufen könnten. Dieser Betrag müsste aber durch »Eurobonds für Verteidigung« aufgebracht werden, mit anderen Worten über gemeinsame Schulden, wogegen sich bislang eine größere Zahl von Mitgliedern sträubt.
Andererseits war in den letzten Jahren auch immer wieder zu erkennen, dass die EU-Mitglieder aufgrund der angesprochenen beschränkten Entwicklungsmöglichkeit der GSVP auf Modelle der differenzierten Integration zurückgegriffen haben, wie etwa die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit, die Gründung der Europäischen Interventionsinitiative und diverse bilaterale Kooperationsprojekte einzelner Mitgliedstaaten belegen.
Aller Voraussicht nach werden diese beiden Entwicklungen anhalten. Sie mögen in der Lage sein, den »Werkzeugkasten« der GSVP zu verbessern bzw. weiterzuentwickeln. Eines können sie jedoch nicht – den politischen Willen der Mitgliedstaaten generieren, die GSVP (wieder) verstärkt für den Zweck zu nutzen, für den sie eigentlich geschaffen worden ist: das militärische Krisenmanagement in der Nachbarschaft der Europäischen Union.
Eine offene Frage muss an dieser Stelle bleiben, welche Wirkung die absehbar notwendige Neujustierung der transatlantischen Beziehungen auf die GSVP in den kommenden Jahren haben wird: Die USA sind unter Präsident Joe Biden nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ihren sicherheitspolitischen Verpflichtungen in und für Europa ohne Zögern nachgekommen und haben ihre Rolle als »europäische Macht« kraftvoll unterstrichen. Seit dem Februar 2022 hat die Biden-Administration Kyjiws mit massiven Waffenlieferungen unterstützt, den Westen auf Wirtschaftssanktionen nie dagewesenen Umfangs eingeschworen und ihre Truppenpräsenz in Europa ausgebaut. Auch die Bundesregierung hat sich mit ihren Entscheidungen im Kontext der »Zeitenwende« klar an der Seite der Regierung Biden positioniert, die nicht zwingend zu erwarten gewesen war. Folgte die Regierung von Angela Merkel in der Sicherheitspolitik dem etwas diffusen Paradigma »Europäischer werden, um transatlantisch zu bleiben«, so ließ Bundeskanzler Olaf Scholz keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Bewältigung der Krise nur in engem Schulterschluss mit Washington erfolgen könne.
Doch das Engagement der Regierung Biden zugunsten der Ukraine und der europäischen Sicherheit ist letztlich nur eine Momentaufnahme, über die man sich in den Hauptstädten Europas zwar freuen darf, die man aber nicht als Grundlage der eigenen strategischen Planungen ansetzen sollte. Wenngleich Russland und der Krieg in der Ukraine in den kommenden Monaten und vielleicht sogar Jahren ein wichtiges Thema für Washington bleiben dürfte, werden die USA das derzeitige Niveau des diplomatischen Engagements und der militärischen Unterstützung für die Ukraine langfristig nicht aufrechterhalten können und wollen. Denn die politische Hinwendung der USA zum indopazifischen Raum hält weiter an, und Chinas machtpolitischer Aufstieg lenkt die Aufmerksamkeit der USA bereits wieder auf den Pazifik. Sowohl Washington als auch die europäischen Staaten müssen daher Überlegungen dazu anstellen, wie die transatlantischen Sicherheitsbeziehungen im Lichte der geopolitischen Verschiebungen, die mit dem 24. Februar 2022 ihre äußere Form gefunden haben, neu zu justieren sind.
Seit Russlands Invasion der Ukraine im Februar 2022 wird in den europäischen politischen Debatten wieder mehr über EU-Erweiterung als geostrategisches Mittel diskutiert. Konkret geht es dabei um die horizontale (geografische) Ausweitung des Bereichs der Gültigkeit von EU-Politik und ‑Recht.1
Das Hauptargument dieses Beitrags lautet, dass der laufende Erweiterungsprozess der EU insofern nicht mehr funktioniert, als er keine politische und gesellschaftliche Transformation in den Kandidatenländern bewirkt; folglich muss er reformiert werden. Auch aus geopolitischen Gründen wäre eine Reform des Erweiterungsprozesses wichtig, um die EU angesichts einer sich schnell verändernden Sicherheitssituation in Europa in die Lage zu versetzen, agiler zu handeln. Der bisherige Prozess war in einem Maße reaktiv und krisenorientiert, dass entsprechende Reformen und Defizite nicht ernsthaft angegangen werden konnten. Dieser Reaktionismus galt nicht nur für die große Osterweiterung (2004–2007), in der die Vereinigung des Kontinents angestrebt wurde, um in den damaligen Beitrittsländern etwa eine Rückkehr zum Autoritarismus nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zu verhindern und für nachhaltige Stabilität in Europa zu sorgen.2 Er spielt auch eine Rolle bei der jüngsten, geopolitisch geprägten Belebung des EU‑Erweiterungsprozesses als Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine,3 in deren Rahmen der Ukraine, Moldau und Georgien die EU-Mitgliedschaftsperspektive angeboten wurde. Das hatte insofern auch Folgen für den Westbalkan,4 als die EU im Juli 2022 die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien eröffnete, Bosnien-Herzegowina den Kandidatenstatus zuerkannte und im Dezember 2022 Kosovos Antrag auf eine EU-Mitgliedschaft begrüßte. Im Dezember 2023 eröffnete die EU die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau und empfahl dasselbe für Bosnien-Herzegowina und Georgien unter der Bedingung, dass beide Länder eine Reihe von Reformen durchführen. Der Europäische Rat gab Bosnien-Herzegowina schließlich Ende März 2024 grünes Licht für die Beitrittsverhandlungen mit der EU. Nicht zuletzt lassen sich seit 2022 auch im Falle der Türkei neue Entwicklungen beobachten: Obwohl ihr Beitrittsprozess weiterhin blockiert ist, gibt es zumindest Bestrebungen des türkischen Präsidenten, den Prozess wiederzubeleben.5
Nach etwa zehn Jahren Stagnation steht das Thema Erweiterung somit wieder weit oben auf der EU-Agenda. Dies ist auch in der veränderten Einstellung der EU-Bevölkerung zur Erweiterung abzulesen, die lange mehrheitlich ablehnend war; doch zuletzt lag seit 2022 der Anteil der Zustimmung bei 57 Prozent, deren Nachhaltigkeit jedoch unsicher ist. Die EU nutzt abermals den Erweiterungsprozess als Instrument der Stabilisierung, der Friedenskonsolidierung und des Wiederaufbaus nach dem Krieg, so wie sie es nach dem Ende der Kriege in Jugoslawien (nach 1999) bereits versucht hat. Die Erweiterungspolitik garantiert jedoch keine Vollmitgliedschaft. Trotz der jüngsten Debatten über die Reform dieses Prozesses – beispielsweise als stufenweise oder abgestufte Mitgliedschaft in EU-Institutionen oder im Binnenmarkt der EU – ist weiterhin unklar, ob eine Mitgliedschaft am Ende des Prozesses überhaupt das angestrebte Ziel der EU ist.
Jedenfalls tut sich die EU mit internen Reformen schwer, die für eine neue Erweiterungsrunde notwendig wären. Das transformative, demokratiefördernde Potential der EU – das noch bei der (süd-)östlichen Erweiterung in den Jahren 2004 (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Malta und Republik Zypern), 2007 (Rumänien und Bulgarien) und 2013 (Kroatien) erkennbar war – ist in der Form nicht mehr gegeben. Absehbar werden die Ukraine, Moldau und möglicherweise auch Georgien die gleichen Probleme beim Erweiterungsprozess haben, wie sie die Westbalkanstaaten seit 2013 hatten. Um ihre Erweiterungspolitik wieder zu stärken, müsste die EU eine klare Roadmap für die Mitgliedschaft der acht bis neun Beitrittskandidaten entwickeln; interne Reformen sind dabei unabdingbar. Die Diskussion über die notwendige Vertiefung der Integration in der EU selbst, also über eine Änderung der Regeln oder informellen Praktiken, die die Autorität der EU über bestehende Bereiche stärken oder auf neue Bereiche ausweiten,6 wurde schon in vorherigen Erweiterungsrunden geführt und bleibt auch im jetzigen Kontext aktuell.
Stand der Erweiterungspolitik von 2010 bis 2022
Analysiert man den Stand der Integration in Belangen der Erweiterung der EU in den letzten zehn Jahren, wird deutlich, dass es seit 2013 de facto keine Unterstützung für eine Erweiterung gibt. Nach der letzten Erweiterung und der Aufnahme Kroatiens in die EU im Jahr 2013 kündigte die EU 2014 einen Erweiterungsstopp an,7 der erst mit Russlands Invasion der Ukraine wieder infrage gestellt wurde. Diese Entwicklung lässt sich auch in Grafik 1 ablesen, die die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates quantitativ nach Themen aufschlüsselt. Das Thema Erweiterung ist hier mit blauer Farbe gekennzeichnet.
Nachdem Kroatien 2013 Mitglied geworden ist, wurde in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates bis 2018 der Begriff Erweiterung kein einziges Mal erwähnt. Schließlich kündigte die EU-Kommission 2018 die sogenannte »Glaubwürdige Erweiterungsperspektive und ein verstärktes Engagement der EU gegenüber dem westlichen Balkan«8 an, womit sie den zwei damaligen Spitzenreiterstaaten Montenegro und Serbien »glaubwürdig« eine Mitgliedschaft ab 2025 unter der Bedingung in Aussicht stellen wollte, dass sie verschiedene EU-Standards erfüllen. Ebenfalls 2018 kam es zum ersten EU-Westbalkan-Gipfel seit dem historischen Thessaloniki-Gipfel von 2003, auf dem erstmals den Westbalkanstaaten die europäische Perspektive angeboten worden war.9 Zusätzlich beendete das vom Westen vermittelte Prespa-Abkommen von 2018 den Namensstreit zwischen der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und Griechenland; Mazedonien akzeptierte dabei förmlich den Namen »Nordmazedonien«. Die EU-Staaten debattierten anschießend 2019 auch über die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien, die dann jedoch von Frankreich, den Niederlanden und Dänemark mit Forderungen nach internen Reformen der EU blockiert wurden.10 2019 wurde außerdem über die »Verbesserung des Erweiterungsprozesses« gesprochen; Ergebnis war im Februar 2020 die revidierte Methodologie, die es ermöglicht, den Prozess im Falle einer Rücknahme oder Stagnation von Reformen rückgängig zu machen.11 Diese Entwicklungen erklären die in Grafik 1 erkennbare Akzentsetzung auf das Thema Erweiterung in den Rats-Schlussfolgerungen der Jahre 2013, 2018, und 2019.
Wie sich eine (Süd-)Osterweiterung der EU als Reaktion auf die jüngsten geostrategischen Veränderungen realistisch gestalten lässt, ist unklar.
Es ist auch verständlich, warum 2022 wieder von Erweiterung die Rede ist. Auf die Veränderung des geostrategischen Umfelds, die sich nach Russlands Invasion der Ukraine ergab, reagierte die EU zügig: mit der Verleihung des Kandidatenstatus an die Ukraine, Moldau und Bosnien-Herzegowina, der europäischen Perspektive für Georgien sowie der Begrüßung des EU-Beitrittsantrags des Kosovo. Eine Initiative Frankreichs, sicherheitspolitische Themen in Europa – unter Ausschluss Russlands – zu debattieren, rief die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) ins Leben, die entgegen ersten Befürchtungen der Kandidatenländer kein Ersatz für die EU-Erweiterung wurde.12 Geopolitisch geprägte Debatten über Erweiterung als Instrument zur Stabilisierung der EU-Nachbarschaft standen daher 2022 im Vordergrund. Allerdings bleibt die Frage offen, inwiefern eine weitere (Süd-)Osterweiterung realistisch gestaltet werden kann, sowohl mit Blick auf die nach wie vor herrschende Erweiterungsmüdigkeit in der EU als auch angesichts der Tatsache, dass der Reformprozess in den Kandidatenländern seit 2013 weitgehend stagniert. Ebenso unklar ist, inwiefern man angesichts der ausbleibenden institutionellen Reformen innerhalb der EU der Ukraine, Moldau und Georgien eine realistische Mitgliedschaftsperspektive bieten kann.
An Grafik 1 lässt sich ablesen, dass der Erweiterungsprozess weitgehend reaktiv ist. Obwohl in den Jahren 2018 und 2019 in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates über Erweiterung diskutiert wurde, zeigt sich bei der qualitativen Auswertung der Schlussfolgerungen, dass nur 2022 in realistischer Form von neuen Beitrittsperspektiven die Rede ist. Die Debatten von 2018 und 2019 zeigen, dass die EU den insgesamt mühsamen Erweiterungsprozess zwar wiederbeleben möchte, allerdings nur im Wege von Reformen dieses Prozesses als Instrument, nicht aber durch interne EU-Reformen. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass der Prozess volle vier Jahre kaum vorangekommen ist, da keines der Kandidatenländer signifikante Fortschritte in der Eröffnung neuer Kapitel des EU-Acquis gemacht hat. Die vermeintliche »Wiederbelebung« im Jahr 2018 war daher mehr Schein als Sein. Der in Grafik 1 erkennbare Akzent im Jahr 2022 bedeutet jedoch, dass die EU schnell auf die Veränderung des sicherheitspolitischen Umfelds reagiert und konkrete Schritte unternommen hat, wie etwa die Verleihung des Kandidatenstatus.
Auch die quantitative Analyse der Inhalte der Debatten im Europäischen Rat zeigt, dass ein starker Fokus nicht nur auf der Erweiterung liegt, sondern auch auf den einzelnen Ländern, die sich im EU-Assoziierungs- und Stabilisierungsprozess befinden (siehe Grafik 2).
In den Jahren 2013 und 2014 fanden in den Rats-Schlussfolgerungen Armenien, das heutige Nordmazedonien, Albanien, Kosovo, Serbien, Moldau und die Ukraine Erwähnung – Anlass waren unter anderem das erste Normalisierungsabkommen zwischen Serbien und Kosovo 2013 und Russlands Annexion der Krim 2014. Als das Momentum für die Erweiterung noch gegeben war (vor Kroatiens Beitritt 2013), haben die Staats- und Regierungschef:innen zudem intensiver über den Westbalkan diskutiert, aber auch über Montenegro und Serbien, den zwei damaligen Spitzenkandidatenländern. Nach 2013 rückt der Westbalkan als Thema in den Hintergrund, dagegen gewinnt die Ukraine an Bedeutung (vor allem infolge der Krim-Annexion). Nach einigen Jahren weitgehender Stagnation in den Diskussionen und der Verabschiedung gezielter Maßnahmen gegen die Türkei im Jahr 2019 wegen staatlicher Menschenrechtsverletzungen und illegaler Bohraktivitäten im östlichen Mittelmeer erlebten 2022 sowohl der Westbalkan als auch die Ukraine, Moldau und Georgien als Themen einen Bedeutungszuwachs. Daneben kommt es zu einer Wiederbelebung des Engagements der EU und der USA im von der EU vermittelten Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo, der seit dem ersten Normalisierungsabkommen von 2013 zu keiner neuen nennenswerten Vereinbarung geführt hat. Erst 2023 schlossen Belgrad und Pristina ein zweites bedeutsames Normalisierungsabkommen, das die Implementierung des noch nicht vollständig umgesetzten ersten Abkommens vorsieht.
Ganz offenkundig hat Russlands Angriff auf die Ukraine neuen Schwung in die Erweiterungsdebatten gebracht. Auch die oben erwähnten Debatten über die Reform des Erweiterungsprozesses und die notwendigen internen EU-Reformen deuten auf eine neue Dynamik hin. Allerdings ist immer noch unklar, ob die EU die erforderlichen Reformen in allen Bereichen implementieren kann. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass es in den EU-Mitgliedstaaten bis vor kurzem durchgehend an Unterstützung für eine Erweiterung fehlte, wie die Daten des Eurobarometers aufzeigen (Grafik 3).
In den letzten zehn Jahren war die Unterstützung für die Aufnahme neuer Länder durchweg geringer als der Widerstand gegen eine erneute Erweiterung. Nur 2019 lässt sich im Durchschnitt der Werte aller – damals noch 28 – EU-Länder ein kleiner Anstieg bei der Befürwortung einer Erweiterung feststellen. Danach fällt der Wert auf rund 35 Prozent, ähnlich wie im Jahr 2011. Erst 2022, mit Russlands Angriff auf die Ukraine, steigt er auf EU-Ebene wieder an – auf über 50 Prozent. Der hohe Wert ist in erster Linie auf die Unterstützung der Bürger:innen für die EU-Politik gegenüber der Ukraine zurückzuführen. Allerdings gelten in den Niederlanden und in Frankreich Sonderregeln, wonach für die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten nationale Referenden erforderlich sind, bevor eine Ratifizierung erfolgen kann.13 Im Jahr 2022 unterstützten in Frankreich nur 40 Prozent der Befragten zukünftige Erweiterungen, 46 Prozent lehnten sie ab, was immerhin 12 Prozent unter dem Wert des Vorjahres lag.14 In den Niederlanden sprachen sich im gleichen Jahr 58 Prozent der Befragten für eine zukünftige Erweiterung aus, ein Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. All diese Entwicklungen, insbesondere die trotz allem hohe Ablehnung einer Erweiterung in Frankreich, könnten die tatsächliche Aufnahme neuer Mitgliedstaaten blockieren und eine realistische Mitgliedschaftsperspektive gefährden.
Alte Herausforderungen und neue Anregungen für die Erweiterungspolitik
Die zentrale Problematik des Erweiterungsprozesses besteht darin, dass er seit Jahren nicht mehr als Mittel funktioniert, um Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeitsreformen in den Beitrittsländern zu bewirken. Je länger der Prozess dauert, desto mehr schwankt die Unterstützung für die Mitgliedschaft – sowohl in der EU (»enlargement fatigue«)15 als auch in den Beitrittsländern (»accession fatigue«)16 – und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Rückschritten bei der Reformimplementierung kommt. Der Erweiterungsprozess war ursprünglich nicht darauf angelegt, mehr als zwanzig Jahre lang zu dauern. Schon in den vorangehenden Erweiterungsrunden ließ sich beobachten, dass die Konditionalität am effektivsten war, wenn den Kandidatenländern die Mitgliedschaft besonders glaubhaft in Aussicht gestellt wurde (z. B. kurz vor dem Beitritt).17
Das transformative Potential der EU-Erweiterungspolitik im Westlichen Balkan hat sich jedoch als weitgehend inadäquat erwiesen, um tiefergehende Reformen anzureizen, etwa in den Bereichen Demokratieentwicklung und Rechtsstaatlichkeit.18 Das liegt nicht nur an den Kernproblemen der begrenzten Staatlichkeit und an ungelösten Konflikten in der Region, sondern auch an den zunehmend autoritären Tendenzen in einigen Ländern, beispielsweise in Serbien.19 Der Beitrittsprozess verläuft nicht nur sehr schleppend, in einzelnen Ländern wie Bosnien-Herzegowina stagniert er sogar seit Jahren. Immer wieder flammen Krisen im Westbalkan auf, etwa im Nordkosovo, oder es kommt zu regionalen (sicherheits-) politischen Spannungen, wie etwa zwischen Serbien und Kosovo oder zwischen Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Serbien.
Erschwerend kommt hinzu, dass die EU in ihrer Erweiterungstoolbox bis 2020 nicht die nötigen Instrumente besessen hat, um sich mit Regressionen auseinanderzusetzen, also mit signifikanten Verzögerungen oder gar Rückschritten eines Beitrittskandidaten auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft. So wurde erst 2020 eine revidierte Erweiterungsmethodologie angenommen, die den Mitgliedschaftsprozess auch rückgängig machen und die Nichteinhaltung von EU-Standards sanktionieren kann.20 Jedoch wird sie bisher so gut wie nicht genutzt.
Erweiterung als Mittel politischer Stabilisierung in der Nachbarschaft der EU funktioniert nur, wenn der Beitrittsprozess glaubwürdiger wird.
Erweiterung als ein Mittel zur politischen Stabilisierung der EU-Nachbarschaft funktioniert nur, wenn der Beitrittsprozess selbst eine größere Glaubwürdigkeit gewinnt, also verlässlicher abläuft. Das ließe sich durch Reformen im Erweiterungsprozess erreichen. Einige davon betreffen den Prozess selbst, andere wiederum sind notwendige institutionelle Reformen, die die EU in die Lage versetzen, in einem geostrategischen Umfeld, das sich seit Russlands Angriff auf die Ukraine verändert hat, agiler zu handeln.
Für die Reform des Erweiterungsprozesses gibt es mindestens zwei konkrete Vorschläge, die seit etwa zwei Jahren in der EU intensiver debattiert werden. Der erste ist der sogenannte »schrittweise Beitritt« (staged accession), den zwei Think-Tanks, CEP und CEPS, ausgearbeitet haben.21 Er sieht vier Stufen der Mitgliedschaft vor, die verbunden sind mit einem sukzessiven Anstieg der verfügbaren Mittel aus den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds, je nach Stufe und je nach Fortschritt bei Reformen in Rechtsstaatlichkeit und Demokratieentwicklung. Die dritte Stufe würde eine Mitgliedschaft in allen EU-Institutionen beinhalten, vorbehaltlich des Ausschlusses von Vetorechten im Rat und der Mitgliedschaft in der Kommission. Eine Schengen-, Binnenmarkt- und Eurozonenmitgliedschaft stünde aber offen. Stufe vier entspräche einer vollen Mitgliedschaft ohne Vorbehalte. Dieses Modell würde jedoch voraussetzen, dass die EU tiefgreifende Reformen im Erweiterungsprozess vollzieht, für die aber momentan der politische Wille fehlt, insbesondere nach der revidierten Erweiterungsmethodologie, die erst 2020 verabschiedet wurde.
Der zweite Vorschlag zielt auf die Möglichkeit der Kandidatenstaaten, schon vor einer vollen Mitgliedschaft dem Binnenmarkt beizutreten,22 wie das 1994 Finnland, Schweden und Österreich im Zuge ihrer Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum getan haben. Da es somit einen historischen Präzedenzfall gibt, findet dieses Modell bei den Mitgliedstaaten mehr Akzeptanz. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte Ende Mai 2023 eine mögliche schrittweise Integration des Westbalkans in den Binnenmarkt der EU an.23 Beim Gipfel der Teilnehmer des Berliner Prozesses – eines seit 2013 stattfindenden hochrangigen Treffens und Kooperationsformats zwischen den Westbalkanstaaten und der EU – in Tirana im Oktober 2023 konkretisierte von der Leyen diesen Vorschlag, indem sie einen Wachstumsplan für den Westbalkan vorstellte, dessen erste Säule in der vollständigen Integration des Westbalkans in den Binnenmarkt der EU besteht.24 Um dem Binnenmarkt beizutreten, müssen die EU-Kandidatenstaaten ohnehin signifikante Reformen bei der Rechtsstaatlichkeit (Vergaberecht, Korruptionsbekämpfung etc.) durchführen. Allerdings stellt sich die Frage, ob sie an diesen Reformen dann auch festhalten können und würden. Daher sollte die Mitgliedschaft im Binnenmarkt nur als eine Stufe auf dem Weg zur vollen Mitgliedschaft verstanden werden, die dazu dienen soll, die konsistente Einhaltung von EU-Standards und den Fortschritt bei Reformen auch weiterhin abzusichern. Würde die Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt allerdings als ultimatives Ziel deklariert, würde das aus Sicht der Kandidatenländer abermals die Glaubwürdigkeit der EU infrage stellen und könnte sie zu einer Abkehr vom Reformweg veranlassen. Es würde auch die falschen Signale an die Ukraine und Moldau senden, die beide dezidiert auf eine Vollmitgliedschaft hoffen und nicht bloß auf die Mitgliedschaft im Binnenmarkt. In jedem Fall wäre es wichtig, Mechanismen zu etablieren, die mittels gewisser Strafmaßnahmen eine Stagnation oder gar Rückabwicklung des Reformprozesses erschweren. Denkbar wären etwa die Einbehaltung von Geldern, der Ausschluss aus Entscheidungsgremien oder der Entzug von EU-Unterstützung in außen- oder sicherheitspolitischen Belangen.
Ein wie auch immer gearteter stufenweiser Beitritt würde dem Erweiterungsprozess, der seit etwa zehn Jahren auf der Stelle tritt, eine neue Dynamik verleihen. Es ist jedoch fraglich, ob diese Reformen ausreichen würden, um ihm wieder zu mehr Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit zu verhelfen. Dafür bedarf es zweifellos auch interner EU-Reformen. In diesem Zusammenhang hat eine Debatte über die Möglichkeit einer Verkleinerung der Kommission und der Ausweitung des Parlaments begonnen, bei der es darum geht, die acht (potentiell neun) neuen Mitgliedstaaten strukturell zu integrieren. Dabei dürften die bestehenden Konfliktlinien zwischen kleineren und größeren EU-Ländern einmal mehr deutlich werden. Eine weitere Debatte betrifft die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen im Rat der EU, die das außen- und sicherheitspolitische Handeln der EU stärken würde.25 Eine solche Reform ließe sich über die sogenannte Passerelle-Klausel zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) – Artikel 31 Absatz 3 des EU-Vertrags – beschließen, die nur einen einstimmigen Beschluss des Europäischen Rates und keine Ratifizierung durch die nationalen Parlamente erfordert. Im September 2023 veröffentlichte die sogenannte deutsch-französische Arbeitsgruppe einen Bericht, der sich mit notwendigen institutionellen Reformen in der EU vor einer neuen Erweiterung beschäftigt.26 Unter anderem wird in diesem Bericht vorgeschlagen, dass alle Entscheidungen in der EU nach dem Prinzip qualifizierter Mehrheit getroffen werden sollten. Die Arbeitsgruppe, die Anfang 2023 von der deutschen Staatsministerin Anna Lührmann und ihrer französischen Amtskollegin Laurence Boone ins Leben gerufen wurde, zeigt, dass sich Frankreich und Deutschland in der Frage der Notwendigkeit sowohl von EU-Reformen als auch einer EU-Erweiterung strategisch annähern.
Eine Reform der Entscheidungsprozesse im Rat bei GASP-Fragen würde klare Signale an die Westbalkanstaaten senden, die – etwa im Falle Nordmazedoniens und Albaniens – ungeachtet implementierter Reformen durch eine Reihe nationaler Vetos auf ihrem Weg zum EU-Beitritt ausgebremst wurden. Zunächst hatte Griechenland sein Veto gegen den Beitritt der Republik Mazedonien eingelegt, die schon seit 2005 Beitrittskandidat war. Nachdem sie im Juni 2018 ihren Namen in Nordmazedonien geändert hatte, legten wiederum Frankreich, die Niederlande und Dänemark 2019 ihr Veto gegen die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien (und Albanien) ein. Dem folgte später ein Veto Bulgariens, dem nationalistische Erwägungen der damals gerade neu gewählten Regierung zugrunde lagen. Erst nachdem Nordmazedonien große Zugeständnisse an Bulgarien gemacht hatte, wurde die Blockade aufgehoben.
Eine etwaige Reform der Entscheidungsprozesse im Rat würde darüber hinaus der Ukraine, Moldau und Georgien signalisieren, dass die EU es mit der Erweiterung ernst meint. Weitere Argumente für häufigere Mehrheitsentscheidungen im Rat sind ein wirksameres Handeln der EU im konfrontativen Sicherheitsumfeld in Europa nach Russlands Angriff auf die Ukraine und eine bessere Funktionsfähigkeit einer zukünftigen EU, deren Entscheidungsprozesse durch acht bis neun Vetos, überwiegend von kleineren Staaten, lahmgelegt werden könnten.
Angesichts der Konfliktlinien bei der Debatte über Mehrheitsentscheidungen dürfte eine Reform des Erweiterungsprozesses schwierig bleiben.
Der Weg zu den notwendigen Reformen der Institutionen und Prozesse der EU dürfte in jedem Fall steinig sein, zumal die üblichen Konfliktlinien bei der Debatte über Mehrheitsentscheidungen fortbestehen: Kleinere und mittelgroße Staaten sind überwiegend dagegen, aus Angst, permanent überstimmt zu werden, während große Staaten wie Frankreich oder Deutschland dafür sind, weil sie auf diese Weise die notwendigen Mehrheiten in der Regel sichern können. Gleichwohl kommt diese Debatte durchaus voran: Im Mai 2023 bildete sich ein Verbund aus Staaten, der sich aktiv für häufigere Mehrheitsentscheidungen im Rat einsetzen möchte. Ihm gehören Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Slowenien und Spanien an.27 Noch ist offen, ob es diesem Verbund gelingen kann, seine Agenda auch den restlichen kleineren Staaten in der EU nahezubringen.
Mit Blick auf die Bereitschaft zur Umstrukturierung des Erweiterungsprozesses gibt es Hinweise darauf, dass sich die EU-Kommission dafür einsetzt, den Westbalkanländern, wie bereits erwähnt, noch vor einem EU-Beitritt die Perspektive einer wirtschaftlichen Annäherung an die EU durch eine graduelle Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt zu eröffnen.28 Außerdem haben sich im Juni 2023 weitere Staaten in der Gruppe »Freunde des Westbalkans« zusammengeschlossen,29 die sich für den »schrittweisen und beschleunigten« Beitritt dieser Region in die EU starkmacht. Mitglieder sind Österreich, Griechenland, Italien, Kroatien, die Slowakei, Slowenien und die Tschechische Republik.
Am bislang deutlichsten hat die EU ihre positive Haltung zur Erweiterung auf dem Gipfel von Granada Anfang Oktober 2023 bekundet.30 Laut der Granada-Erklärung des Europäischen Rates stellt die Erweiterung eine geostrategische Priorität der EU dar, die jedoch institutionelle Reformen innerhalb der EU voraussetzt. Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, deutete zudem im August 2023 darauf hin, dass die EU anstrebe, bis 2030 für eine neue Erweiterung bereit zu sein.31 Die Granada-Erklärung bekräftigt, dass die Prozesse der Vertiefung und der Erweiterung der EU bzw. einer Reform innerhalb der EU und von Reformen in den Kandidatenländern parallel laufen müssen, um Sicherheit und Frieden in Europa nachhaltig zu gewährleisten.
Ausblick und Handlungsempfehlung
Die EU hat bei der Erweiterung mit alten und neuen Herausforderungen zu kämpfen. Angesichts anhaltender Skepsis darüber, ob die neue Unterstützung der EU für die Erweiterung wirklich nachhaltig ist, steht die Glaubwürdigkeit neuer Erweiterungsrunden infrage, insbesondere mit Blick auf die Europawahl im Juni 2024, nach der es auch zur Abkehr von der Erweiterung kommen kann. Ob es eine Kontinuität in der befürwortenden Haltung zur Erweiterung in der nächsten Legislaturperiode geben wird oder nicht, wird sich nicht zuletzt daran zeigen, wer das Amt des Kommissars bzw. der Kommissarin für Erweiterung und Europäische Nachbarschaftspolitik übernehmen wird. Dass derzeit ein Repräsentant Ungarns Amtsinhaber ist, hat zu großer Skepsis im Westbalkan beigetragen, vor allem weil Viktor Orbáns Regierung auf fragwürdige, den Werten der EU widersprechende Weise autoritäre Politiker im Westbalkan politisch unterstützt. Hinzu kommen aber auch neue Herausforderungen, wie etwa die Absicherung der Funktionsfähigkeit der EU nach der perspektivischen Aufnahme von acht bis neun weiteren Staaten. Dies erfordert sowohl interne Reformen, wie die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen bei GASP-Fragen im Rat der EU, als auch eine Umstrukturierung der EU-Kommission und des Parlaments.
Die inkonsistente Erweiterungsagenda hat dem Ruf der EU im Westbalkan geschadet, was wiederum Folgen für eine neue Erweiterung um Länder wie die Ukraine, Moldau und Georgien haben kann. Fehler, die zu Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien begangen wurden (etwa die oben erwähnte Vereinnahmung des Erweiterungsprozesses für nationale Interessen von EU-Mitgliedstaaten mittels Vetos), sollten eingestanden werden. Die EU muss daher an Reformen arbeiten, die das Aufkommen ähnlicher Szenarien in Zukunft verhindern sollten. Dies ist besonders dringlich mit Blick auf die schon aufgenommenen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Eine Reform in puncto Mehrheitsentscheidungen wäre auch im Sinne der Funktionsfähigkeit des Erweiterungsprozesses und der EU selbst, sollten die neuen Kandidaten ab 2030 beitreten.
Darüber hinaus sind für den Erweiterungsprozess andere Verfahren erforderlich, etwa der erwähnte schrittweise Beitritt über die graduelle Integration in den Binnenmarkt, der allerdings nicht als Ersatz für eine volle Mitgliedschaft zu einem späteren Zeitpunkt zu verstehen ist und zudem Reformen voraussetzt. Die EU sollte mit Blick auf die nächste Legislaturperiode klare Schritte für die Kandidatenländer ausarbeiten, die den Beitritt in gewisse Bereiche des Binnenmarktes (wie Digitales, SEPA u. Ä.), den vollen Binnenmarktbeitritt und/oder den EU-Beitritt bis 2030 greifbar machen. Benchmarks und Deadlines für jedes einzelne Land wären dabei notwendig. Der sukzessive Anstieg des Zuflusses an Mitteln aus den Struktur- und Investitionsfonds der EU je nach Reformfortschritt sollte gewährleistet werden und als Anreiz für weitere Reformen dienen. Gleichzeitig müssen aber auch klare Konsequenzen für den Fall der Nichteinhaltung von EU-Standards ausformuliert werden. Die EU muss Ihre Konditionalitätsmechanismen also konsequenter einsetzen. Auch der regionale und transregionale Wettbewerb zwischen den östlichen Partnerländern und dem Westbalkan sollte genutzt werden, um Reformen zu stimulieren. Reformen im Erweiterungsprozess müssen nicht zuletzt mit Reformen der EU selbst einhergehen. Nur so kann sich eine neue Dynamik im Prozess entfalten.
Letztlich muss die EU auch mehr Ressourcen für die Kandidatenländer bereitstellen, um deren sozioökonomische Annäherung an die EU zu beschleunigen und den Wiederaufbau der Ukraine zu fördern. Damit würde die EU ein klares Signal aussenden, dass sie eine proaktive Erweiterungspolitik betreibt und die Beitrittsstaaten bereits als Teil der Union mitdenkt – politisch ebenso wie finanziell.
Mittlerweile sprechen sich alle Länder der EU für eine Erweiterung aus. Belege dafür sind die emphatische Unterstützung für den EU-Beitritt der Ukraine in der EU-Bevölkerung und in der Granada-Erklärung des Europäischen Rates. Betrachtet man allerdings den bisherigen Verlauf des Beitrittsprozesses im Westbalkan, muss man wohl zu dem Schluss gelangen, dass sich auch die Ukraine auf einen sehr langen und mühsamen Prozess einstellen muss, zumindest solange territoriale Fragen im Osten des Landes noch nicht geklärt sind (Krim und/oder der Donbass). Die gleichen Probleme könnten auch auf Moldau (Transnistrien) und Georgien (Abchasien und Südossetien) warten. Schließlich trüben unter anderem ungelöste territoriale Fragen seit Jahren auch die Mitgliedschaftsaussichten Serbiens und Kosovos. Daher geht es bei der nächsten Erweiterung nicht zuletzt um die Frage, ob die EU bereit ist, als geostrategische Macht in ihrer Nachbarschaft zu agieren und flexible, kreative Modelle zu finden, mit denen sich die Beitrittskandidaten näher an die EU heranführen lassen. Entscheidend wird außerdem sein, wie schnell sich die EU reformieren kann.
Querschnittsanalysen
Einleitung
Im Zeichen der Polykrise haben sich auch die Machtverhältnisse sowie das Zusammenspiel der Akteure in und zwischen den Institutionen der Europäischen Union verändert. Grundsätzlich blickt diese Sammelstudie mit der Periode seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon auf eine Zeit der institutionellen Stabilität der Union, in der es trotz Krisen keine primärrechtlichen Änderungen an Aufbau, Funktionsweise oder gemeinsamen Verfahren zwischen den EU‑Institutionen gegeben hat. Auf der anderen Seite haben sich unter dem Druck von Krisen sowohl das formelle als auch das informelle Zusammenspiel der EU-Institutionen durchaus temporär oder sogar strukturbildend dauerhaft angepasst. Aufbauend auf den Analysen zu den einzelnen Politikbereichen und politischen Projekten der EU soll hier daher übergreifend zusammengetragen werden, wie sich das Machtgefüge und die Konfliktlinien zwischen den EU‑Institutionen verändert haben.
Die Analyse geht dabei in drei Schritten entlang eines erweiterten Institutionenbegriffs vor. Zunächst gilt es zu analysieren, inwiefern sich die institutionellen Kompetenzen der Union und ihre Ausübung im Hintergrund der Polykrise verändert haben. Zweiter Aspekt der Analyse ist die Frage, welche (Macht-)Verschiebungen es zwischen den Institutionen der Union gegeben hat, insbesondere mit Blick auf die Unterschiede zwischen den supranational organisierten Institutionen Europäisches Parlament (EP) und EU-Kommission sowie Rat der EU bzw. Europäischer Rat. Drittens soll gezeigt werden, dass und wie es im Rahmen der Polykrise zu Veränderungen nicht nur im Zusammenspiel, sondern auch innerhalb der Institutionen gekommen ist, etwa in der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments oder in der Nutzung von Mehrheitsentscheidungen im Rat.
Die doppelte Resilienz des EU-Rahmens
Die Europäische Union war durch die verschiedenen Facetten der Polykrise seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon enormen Fliehkräften und Druck ausgesetzt. Auf der einen Seite wurde dabei in der öffentlichen Debatte der Fortbestand der Union infrage gestellt. So wurde etwa im Rahmen der Eurokrise regelmäßig konstatiert, dass die Eurozone nicht tragfähig und kurz vor dem chaotischen Auseinanderbrechen sei.1 Nach dem Brexit-Referendum im Jahr 2016 wurde zunächst ein Dominoeffekt befürchtet.2 Zu Beginn der Covid-19-Pandemie fiel die EU in eine Schockstarre, und die Mitgliedstaaten entschieden sich zu nationalen Alleingängen, was etwa im besonders stark betroffenen Italien dazu führte, dass die Zahl derjenigen, welche die EU-Mitgliedschaft als nachteilig für das Land ansahen, sprunghaft anstieg – während China Hilfe schickte.3 Die Krisen waren für die EU oder zumindest für ihr öffentliches Ansehen durchaus existentiell.
Auf der anderen Seite werden Krisen in der europäischen Integration gemeinhin als essentielle Triebfeder für weitere Integrationsschritte betrachtet, gemäß dem Brüsseler Sprichwort »Jede Krise ist auch eine Chance«. Auch in den Integrationstheorien gelten Krisen als zentrale Momente, um gemäß einem »failing forward« den politischen Willen der Mitgliedstaaten zusammenzuführen, weitere Souveränitätsrechte in der EU zu bündeln und neue Integrationsschritte zu nehmen.4 Nach der bellizistischen Theorie wiederum können auch Kriege und ihre Folgen maßgeblich zu Staatswerdungs- und Integrationsprozessen beitragen.5 Zwar sind weder die EU noch ihre Mitgliedstaaten selbst Partei im russischen Krieg gegen die Ukraine, aber ihre Bedrohungswahrnehmungen haben sich durch diesen unmittelbar verändert. Vor diesem Hintergrund wären bei der Abfolge an Krisen größere Vertiefungsschritte in der EU zu erwarten.
Die Petrifizierung der Verträge
Auf den ersten Blick sind jedoch die grundsätzlichen institutionellen Strukturen und die Kompetenzordnung der Union von der Polykrise auf primärrechtlicher Ebene unberührt geblieben. So hat die EU weder in einem der untersuchten politischen Projekte noch in einem anderen Bereich seit 2010 formell ihre Kompetenzen erweitert oder ihre grundsätzlichen institutionellen Strukturen geändert. Das war vor dem Vertrag von Lissabon noch anders: Zwischen der Einheitlichen Europäischen Akte (1987 in Kraft getreten) und dem Vertrag von Lissabon (2009) vereinbarten die EU-Mitgliedstaaten im Durchschnitt alle fünfeinhalb Jahre Veränderungen an den institutionellen Strukturen über das EU-Primärrecht. Die letzte große Vertragsänderung dauerte jedoch bereits von der Erklärung von Laeken (Dezember 2001) bis zum Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags (Dezember 2009) fast ein ganzes Jahrzehnt. Dazwischen lagen Konvent, Verfassungsvertrag, die negativen Referenden und die »Denkpause«, schließlich dann die Neuverhandlung in Form des Lissabonner Vertrags und eine schwierige Ratifikationsphase. Unter anderem diese Erfahrung sowie die Befürchtung, bei Vertragsverhandlungen das gesamte Paket der institutionellen Balance der EU neu verhandeln zu müssen und/oder nationale Referenden zu riskieren, dürften dazu beigetragen haben, dass sich in keiner der Krisen der nötige politische Wille fand, Vertragsreformen zu verhandeln.
Einzige Ausnahme war eine vereinfachte Vertragsänderung, mit der 2011 der Artikel 136 AEUV um zwei Sätze mit dem Ziel ergänzt wurde, eine primärrechtliche Basis für den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zu schaffen. Doch auch diese Änderung musste ein etwas mehr als zwei Jahre dauerndes Ratifikationsverfahren durchlaufen und konnte erst im Mai 2013 in Kraft treten. Zusätzlich wurden mit dem Austrittsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) kosmetische Änderungen am EU-Primärrecht vorgenommen, um den Austritt zu vollziehen. Damit gingen aber keine direkten institutionellen oder kompetenzrechtlichen Änderungen einher.
Ungeachtet dessen gab es sehr wohl regelmäßig Forderungen nach einer Reform der Verträge und der Institutionen, von denen bis dahin jedoch keine die erforderliche politische Unterstützung bekommen hat.6 Prinzipiell bleiben die Mitgliedstaaten die »Herren der Verträge«. Die Konferenz zur Zukunft Europas wiederum hat 2022 eine Reihe von Vorschlägen erarbeitet, von denen einige nur über Vertragsänderungen umzusetzen wären.7 Ursprünglich eine Idee des französischen Präsidenten Macron, wurden bei diesem bislang größten partizipativen Verfahren repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger aus der EU zusammengebracht, um Vorschläge für die Weiterentwicklung der EU auszuarbeiten. Anschließend wurden die Vorschläge in einem Abschlussbericht unter Mitwirkung von EU-Institutionen, nationalen Parlamenten und Zivilgesellschaft zusammengeführt. Trotzdem oder gerade deshalb wurde die Zukunftskonferenz von interinstitutionellen Rivalitäten überschattet. Das EP hat den Abschlussbericht zum Anlass genommen, Vertragsänderungen nach Artikel 48 EUV zu fordern.8 Direkt nach der Zukunftskonferenz hat jedoch eine Gruppe von 13 Mitgliedstaaten öffentlich erklärt, institutionelle Debatten seien in der aktuellen Krisensituation fehl am Platze.9 Bis dato hat sich der Rat nicht formell zu der EP-Forderung nach Vertragsänderungen geäußert.
Krisenreaktion im Rahmen der EU-Verträge
Im Kontrast zur immer wieder blockierten Debatte über Vertragsreformen waren die Mitgliedstaaten bereit, zur Bewältigung von Krisen weitgehende neue Instrumente im bestehenden EU-Rahmen zu schaffen, zum Teil mit sehr weitgehender Auslegung des EU-Primärrechts. Instrumente werden in diesem Zusammenhang verstanden als Mittel zur Umsetzung von Politik (z. B. Finanzmittel, Regulierung etc.), Institutionen als im weiteren Sinne formelle und informelle Einrichtungen in der EU bzw. ihren Mitgliedstaaten.
Auffällig ist dabei eine große Divergenz zwischen der Eurokrise und den Krisen nach 2015. So schufen die Mitgliedstaaten der Währungsunion zwischen 2010 und 2015 eine Reihe von Sonderinstitutionen, von denen einige – etwa der Euro-Plus-Pakt, der Fiskalpakt oder Teile der Bankenunion – außerhalb der EU-Verträge angesiedelt waren, auch um EU-Vertragsänderungen zu vermeiden. Zusätzlich wurden mit der Arbeitsgruppe Euro-Gruppe und dem Eurogipfel neue informelle Institutionen in der EU geschaffen, die nur den Euro-Staaten bzw. Staaten offenstanden, die den Euro anstreben.10 Im späteren Verlauf wurden diese Differenzierungsmaßnahmen aber weitgehend zurückgefahren. So werden weder Euro-Plus-Pakt noch Fiskalpakt aktiv genutzt, während der Eurogipfel in der Regel seit dem Brexit im »inklusiven Format« tagt, das heißt unter Beteiligung auch aller Nicht-Eurostaaten.
Beispiele für innerhalb der EU geschaffene neue Instrumente waren darüber hinaus der gemeinsame Ankauf von Impfstoffen, Gas und Munition oder der Wiederaufbaufonds NextGenerationEU (NGEU). Diese Instrumente im EU-Rahmen und mit der Beteiligung aller 27 EU-Staaten aufzubauen war eine durchaus bewusste Entscheidung. So bildeten etwa zu Beginn der Pandemie Deutschland, Frankreich, die Niederlande und Italien eine »Impfallianz« und handelten erste Verträge mit Herstellern aus. Auch um der Befürchtung entgegenzutreten, vier der reichsten EU-Staaten könnten sich zuerst die Impfstoffe sichern, stimmten die vier im Mai/Juni 2020 in kürzester Zeit einer gemeinsamen Impfstoffbeschaffung durch die EU zu; der Kommission fiel dabei die Aufgabe zu, die Verträge für alle EU-27 auszuhandeln.11
Differenzierung in der Umsetzung
Zu beobachten ist auch eine stärkere Nutzung von Flexibilisierungsinstrumenten, an denen sich jeweils nur Gruppen von Mitgliedstaaten beteiligen. Auf der einen Seite sind diese in der Außen- und Sicherheitspolitik zusehends häufiger zur Anwendung gekommen. Das gilt insbesondere für die EU-Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. So haben die EU-Staaten im Interesse der Einigung auf die Sanktionspakete in wirtschaftlich kritischen Sektoren vermehrt temporäre Ausnahmen geschaffen, so etwa für Ungarn und andere ausschließlich auf Pipeline-Öl angewiesene EU-Staaten bei den Sanktionen auf russisches Öl. Auch bei den Entscheidungen, die Europäische Friedensfazilität (EPF) für die Finanzierung von militärischer Hilfe an die Ukraine zu nutzen, haben mit Irland, Malta und Österreich drei bündnisfreie Staaten vom Instrument der »konstruktiven Enthaltung« gemäß Artikel 31 EUV Gebrauch gemacht. Sie haben mithin auf ihr Veto verzichtet, waren aber auch nicht an der Finanzierung oder Umsetzung beteiligt. Ebenfalls zugenommen hat die Nutzung flexibler Zusammenarbeit bei Rüstungskooperationen in Form der Permanenten Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO), die seit 2017 auf mittlerweile 88 Projekte kommt.12
Eine solche Nutzung von Flexibilitätsinstrumenten wie in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) bleibt in anderen Politikbereichen aber weiterhin die Ausnahme. Dabei bietet der Vertrag von Lissabon mit der »Verstärkten Zusammenarbeit« auch in anderen Bereichen ein Instrument an, um in Gruppen von Mitgliedstaaten voranzuschreiten. Dieses Instrument ist 2010 erstmals von zunächst vierzehn EU-Staaten für die Regelung von transeuropäischen Ehescheidungen verwendet worden. Später kamen noch Verstärkte Zusammenarbeiten zum einheitlichen EU-Patent (2011), zu Fragen des gemeinsamen ehelichen Güterstands (2016) und zur Europäischen Staatsanwaltschaft (2017) hinzu. Zu einer breiten Nutzung der Verstärkten Zusammenarbeit ist es, insgesamt gesehen, aber nicht gekommen.13
In Anbetracht des Ausmaßes der Krisen ist die EU im doppelten Sinne resilient geblieben.
In Anbetracht des Ausmaßes der Krisen und Herausforderungen, mit denen die EU seit Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags konfrontiert war bzw. ist, ist ihre grundsätzliche institutionelle Architektur also im doppelten Sinne resilient geblieben – zum einen resilient gegenüber zentrifugalen Kräften, denn trotz Szenarien wie dem eines Auseinanderbrechens der Eurozone während der Eurokrise oder dem einer Dominoreaktion nach dem Brexit-Votum hat die Union zumindest alle bisherigen Krisen überstanden. Zum anderen waren ihre Strukturen aber auch resilient gegenüber Veränderungen, verbunden mit einer hohen Stabilität der Institutionen und einer weitgehenden Ablehnung von Vertragsänderungen. Das mit dem Vertrag von Lissabon verfestigte »institutionelle Gleichgewicht« ist daher auf primärrechtlicher Ebene bestehen geblieben.
Das Janusgesicht der EU: Exekutiv‑dominierte Krisengovernance und Gemeinschaftsmethode
Blickt man auf die Zusammenarbeit und die Machtverhältnisse zwischen den EU-Institutionen, so lassen sich nach den Analysen dieser Sammelstudie unterhalb der primärrechtlichen Ebene Verschiebungen in zwei sehr unterschiedlichen Trends während der Polykrise ausmachen. Auf der einen Seite waren die Krisenreaktionen, einschließlich der Schaffung neuer Instrumente, intergouvernemental-exekutiv dominiert, was mit einer Schlüsselfunktion für den Europäischen Rat und einer zunehmend stärkeren Europäischen Kommission einherging. In anderen Bereichen aber, wo das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zur Anwendung kommt, wurde das Europäische Parlament deutlich gestärkt. Daraus ergibt sich eine EU, die je nach Politikbereich nach sehr unterschiedlichen Logiken funktioniert. Das ist zwar keine neue Entwicklung, eigentlich aber sollte mit dem Vertrag von Lissabon und dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Gemeinschaftsmethode zum Standard in der EU werden. Stattdessen ist es zu einer noch pointierteren Akzentuierung des intergouvernementalen Pfeilers gekommen, und die Trennung zwischen einerseits der EU-Gesetzgebung mit starken supranationalen Institutionen, einschließlich eines voll beteiligten Europäischen Parlaments, und andererseits einer von intergouvernementalen Verhandlungen dominierten Ad-hoc-Krisenpolitik weitgehend ohne EP-Beteiligung ist noch schärfer geworden.14
Intergouvernemental-Exekutive Krisengovernance
Das zentrale Forum für die wichtigsten Entscheidungsprozesse der EU in Krisenzeiten ist der Europäische Rat. Als Gremium der Staats- und Regierungschefs und ‑chefinnen soll er die politischen Leitlinien der EU setzen, hat nach Artikel 15 Absatz 1 EUV formell aber keine eigene Gesetzgebungskompetenz. Die politische Dynamik in Krisen geht aber weit darüber hinaus. So zeigt sich immer wieder das Muster, dass die EU im öffentlichen Diskurs auf einen Krisenmoment zusteuert, die politischen Entscheidungen zur »Chefsache« werden und in teils mehrere Tage dauernden »Gipfeltreffen« Kompromisse gefunden werden müssen.15 Dieses Muster war besonders prägnant bei den Entscheidungen zu den Hilfsprogrammen in der Eurozone, zur Migrationspolitik (2015/16) oder zu den Sanktionen gegen Russland zu erkennen. Dabei hat der Europäische Rat zum Teil tief in die Gesetzgebung eingegriffen, etwa in Bezug auf den Ausbau der Bankenunion.16
Bei den jüngeren Krisenentscheidungen der EU ist eine deutliche Stärkung der Europäischen Kommission zu beobachten.
Bei den jüngeren Krisenentscheidungen der EU ist zudem eine deutliche Stärkung der Europäischen Kommission zu beobachten. So konnte die Kommission mit dem Wiederaufbaufonds NGEU ihren Einfluss auf die wirtschaftliche Steuerung der EU deutlich ausweiten. Sie hat zudem die Verhandlungsführung beim schon erwähnten gemeinsamen Impfstoffkauf ebenso übernommen wie die Umsetzung bei dem (begrenzteren) gemeinsamen Gas- und Munitionskauf.17 Während der Anspruch einer »geopolitischen« Kommission zu Beginn der Legislaturperiode noch wenig glaubwürdig klang, so hatte die Kommission und insbesondere ihre Präsidentin von der Leyen dann in der Tat eine treibende Rolle bei den Sanktionsentscheidungen gegenüber Russland. Mit der neuen Dynamik in der Erweiterungspolitik erlangt zudem ein Bereich neue Priorität, in dem die Kommission traditionell am stärksten in den auswärtigen Beziehungen war.
Ebenfalls gestärkt wurden Exekutivagenturen der EU, wie etwa Frontex bei der Grenzsicherung, Europol im Cyberbereich oder HERA in der Gesundheitspolitik. Diese Agenturen zeichnet aus, dass sie – je nach Rechtsgrundlage – zwar teilweise mit Zustimmung des Parlaments über das ordentliche Gesetzgebungsverfahren begründet und in ihren Kompetenzen begrenzt werden. In ihrer Arbeit werden sie aber jeweils über ein Managementboard bzw. ein Steuerungskomitee kontrolliert, in denen die nationalen Regierungen und zum Teil auch die Kommission vertreten sind.
Demgegenüber blieb das Europäische Parlament bei den Krisenentscheidungen weitgehend außen vor. Ob Eurokrise, Migrationskrise, Pandemie oder Reaktionen auf den Krieg gegen die Ukraine – die zentralen politischen Weichenstellungen in der EU wurden ohne oder mit nur geringer Beteiligung des Europäischen Parlaments getroffen. Bei jüngeren Kriseninstrumenten wie dem gemeinsamen Impfstoff- oder Gaskauf nutzte die EU den »Krisenartikel« 122 AEUV, nach dem der Rat auf Vorschlag der Kommission alleine entscheidet. Auch an Sanktionsentscheidungen ist das EP nicht beteiligt.18 Nicht zuletzt war das EP überall da aus dem Spiel, wo die EU-Staaten in Krisen Sonderhaushalte außerhalb des regulären, vom EP mit verabschiedeten und kontrollierten EU-Haushalts genutzt haben. Dies ist derzeit etwa der Fall bei der EPF-Unterstützung für die Ukraine. Noch mehr als für die nationale Ebene, auf der die Parlamente zumindest kontrollierend beteiligt waren, gilt für die EU-Ebene, dass Krisen die Exekutive stärken.
Gemeinschaftsmethode in der Regulierung
Ganz anders sieht dagegen die institutionelle Machtbalance in jenen untersuchten Bereichen aus, in denen die EU primär über Gesetzgebung regulativ tätig war und/oder den regulären EU-Haushalt genutzt hat. So etwa im Falle des Green Deals, der im Kern aus mehreren Gesetzgebungspaketen besteht, die größtenteils über das ordentliche Gesetzgebungsverfahren verabschiedet wurden bzw. werden sollen. Hier hat das Europäische Parlament volles Mitspracherecht, und die maßgeblichen Verhandlungen fanden im EP, im Rat sowie im Trilog zwischen Rat, Kommission und EP statt. Die Staats- und Regierungschefs und ‑chefinnen im Europäischen Rat haben zum Green Deal zwar in unregelmäßigen Abständen Leitlinien verabschiedet, aber deutlich weniger als in den krisengetriebenen Dossiers. Dasselbe gilt für die regulativen Entscheidungen in der Digitalpolitik, etwa beim Digital Services Act und dem Digital Markets Act.
Auch bei Krisenentscheidungen ist das EP mit ins Spiel gekommen, wenn Instrumente nur mit Rechtsgrundlagen über das ordentliche Gesetzgebungsverfahren oder mit Rekurs auf den EU-Haushalt genutzt wurden. So war das EP beispielsweise beteiligt an den – lange im Rat blockierten – Verhandlungen über die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, den Ausbau von Frontex oder dem Beschluss zur Finanzierung gemeinsamer Munitionskäufe. Dabei hat das EP gezeigt, dass es auch in Krisenzeiten in der Lage ist, relativ kurzfristige Entscheidungen zu treffen.19
Auch ohne eigenes Initiativrecht für das Europäische Parlament funktioniert die EU in diesen Bereichen weitgehend wie ein parlamentarisches System, allerdings mit einem gänzlich anderen institutionellen Gleichgewicht. Hier ist das Europäische Parlament ähnlich einflussreich wie nationale Parlamente. Zum Teil übertrifft es diese sogar in seinen Mitwirkungsrechten, etwa im Falle der sehr weitreichenden Anhörungen bei der Einsetzung und dem Wechsel von Kommissarinnen und Kommissaren. Seit dem Vertrag von Lissabon werden dabei durchschnittlich deutlich mehr als fünfzig Prozent der Gesetzgebungsakte von Rat und Parlament gemeinsam im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren verabschiedet, mit voller Mitsprache des EP.20 Auffällig ist aber auch, dass Rat und EP in der Praxis nahezu ausschließlich – in manchen Jahren zu fast hundert Prozent – das sogenannte Trilog-Verfahren nutzen, bei dem sie schon vor der ersten Lesung in informelle Verhandlungen mit der Kommission eintreten. Das hat die EU-Gesetzgebung effektiver, aber auch deutlich intransparenter gemacht.21
Zwischen Fragmentierung und Drang zur Kohärenz in den Institutionen
Parallel zu den Verschiebungen der Machtbalance zwischen den Institutionen haben sich auch Anpassungen der Arbeitsweise in den Institutionen ergeben. Besonders auffällig ist dabei über die analysierten Bereiche hinweg das Spannungsfeld zwischen einer zunehmenden (partei)politischen Fragmentierung und Politisierung auf der einen Seite und dem Drang zu mehr Kohärenz und Zentralisierung im Dienste der Handlungsfähigkeit auf der anderen Seite:
Drang zum Konsens im Rat und Europäischen Rat
Im Europäischen Rat und im Rat der EU, in denen die Mitgliedstaaten über ihre nationalen Regierungen direkt vertreten sind, wirkt sich die Fragmentierung nationaler Parteiensysteme indirekt aus. Im Laufe der Untersuchungsperiode seit Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags haben in vielen EU-Staaten Parteien außerhalb des traditionellen (west-)europäischen Parteienspektrums an Zustimmung gewonnen und teilweise Regierungsverantwortung übernommen. Blickt man beispielsweise auf die Vertretung im Europäischen Rat, so wurden bei Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags alle sechs großen EU-Staaten von Parteien regiert, die der Europäischen Volkspartei (Deutschland, Frankreich, Italien, Polen) und der Sozialdemokratischen Partei Europas (Spanien, Vereinigtes Königreich) angehörten. Anfang 2024 sind nur noch Deutschland und Spanien von den Sozialdemokraten regiert, in Polen regiert erst seit Ende 2023 mit Donald Tusks PO wieder eine von einer EVP-Partei geführte Koalition, während in Italien mit Giorgia Meloni eine Regierungschefin aus einer Partei der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) amtiert. Aus Frankreich gehört Emmanuel Macrons Partei Renaissance zwar im EU-Parlament der liberalen Fraktion Renew Europe an, ist aber außerhalb des EP nicht Teil der europäischen liberalen ALDE-Partei geworden.
Der Wille der Mitgliedstaaten, in EU-Entscheidungsverfahren Konsens zu erzielen, bleibt weiterhin groß.
Gleichzeitig bleibt der Wille der Mitgliedstaaten, soweit möglich in EU-Entscheidungsverfahren Konsens zu erzielen, weiterhin groß. Im Europäischen Rat wird ohnehin – mit sehr wenigen Ausnahmen22 – im Konsens entschieden. Die Auswertung der öffentlichen Abstimmungsprotokolle im Rat der EU zeigt zudem, dass selbst in jenen Bereichen, in denen rechtlich mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden kann, im Durchschnitt über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg mehr als achtzig Prozent der Beschlüsse im Konsens (also ohne Gegenstimmen) gefasst wurden.23 Dies bedeutet nicht, dass sich die Mitgliedstaaten immer schnell einigen können, sondern, im Gegenteil, dass sie so lange verhandeln, bis möglichst ein für alle tragfähiger Kompromiss gefunden ist.
Entscheidungen wie die von 2015/16 zur Flüchtlingsverteilung, bei der eine große Gruppe von Mitgliedstaaten in einer Frage von hoher politischer Sensibilität überstimmt worden ist, sind dabei die Ausnahme von der Regel geblieben. Auch aufgrund der Tatsache, dass die Umsetzung der Flüchtlingsverteilung nie gelungen ist und anschließend die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) über Jahre blockiert war, haben die Mitgliedstaaten seitdem noch mehr Zurückhaltung bei der Nutzung von Mehrheitsentscheidungen im Rat gezeigt. Doch auch diese Zurückhaltung hat ihre Grenzen. Denn ausgerechnet die Entscheidungen zur Positionierung des Rates zum GEAS-Reformpaket im Jahr 2023 haben die Mitgliedstaaten gegen den Protest der Regierungen Polens und Ungarns per Mehrheitsentscheid getroffen. Ob die Beschlüsse nach einer Grundsatzeinigung mit dem Europäischen Parlament im Trilog noch vor den EP-Wahlen 2024 in Gesetzgebung überführt werden können, ist ebenso offen wie die Frage, ob die Zurückhaltung in puncto Mehrheitsentscheidungen dauerhaft fortbestehen wird.
Nicht zuletzt wird im Rat immer wieder darüber debattiert, mittels Nutzung der sogenannten Passerelle-Klausel den Anwendungsbereich von Mehrheitsentscheidungen auszuweiten, insbesondere in Teilen der GASP. Hierzu und zur Steuerpolitik hat etwa die Juncker-Kommission 2017 Initiativen gestartet, die allerdings ins Leere liefen.24 Im Jahr 2023 haben sich im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine elf Staaten zusammengefunden, die sich für die Nutzung der Passerelle-Klausel in der GASP einsetzen wollen und dazu die »Freundesgruppe für Qualifizierte Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik der EU« gebildet haben.25 Da aber auch die Nutzung der Passerelle-Klausel Einstimmigkeit und zum Teil vertragsänderungsähnliche Verfahren der nationalen Zustimmung erfordert, dürfte eine schnelle Umsetzung schwer zu erreichen sein.26 So bleibt der Rat parteipolitisch fragmentiert, aber in der Regel um Konsens bemüht. Das schafft mehr Legitimität und Effektivität in der Umsetzung von Entscheidungen, da am Ende immer alle zugestimmt haben, geht aber zu Lasten der Handlungsfähigkeit, zumindest der Handlungsgeschwindigkeit.
Fragmentierung im EP
Auch im Europäischen Parlament hat im Verlauf des Untersuchungszeitraums die parteipolitische Fragmentierung deutlich zugenommen. Dies spiegelt sich zum einen im Aufstieg EU-skeptischer und populistischer Parteien wider. Bei den Europawahlen 2009, kurz vor Inkrafttreten des Lissabonner Vertrags, waren nur in zwei EU-Staaten EU-skeptische Parteien stärkste Kraft (Vereinigtes Königreich und Tschechien). EU-weit gewannen Parteien aus der nationalkonservativen EKR sowie anderen Rechtsaußen-Parteien aber auch bereits 2009 knapp 20 Prozent der Sitze im EP. Bei den letzten Europawahlen 2019 stieg ihr Anteil auf knapp 25 Prozent an, 2024 werden weitere deutliche Zuwächse erwartet. Vor allem aber wurden bei den Europawahlen zum Teil hart EU-skeptische Parteien in Gründerstaaten der EU stärkste Kraft, etwa in Frankreich, Italien und Teilen Belgiens. Aufgespalten auf die Fraktionen EKR sowie Identität und Demokratie (ID) plus fraktionslose Abgeordnete, konnten EU-skeptische Parteien inhaltlich im EP bisher allerdings keine eigenen Mehrheiten organisieren.27
Die parteipolitische Fragmentierung im Europäischen Parlament macht die Mehrheitsbeschaffung in der politischen Mitte zu einer immer komplexeren Aufgabe.
Komplexer wurde dadurch aber die Mehrheitsbeschaffung in der politischen Mitte. So verfügten die EVP und die europäischen Sozialdemokraten 2009 gemeinsam noch über 55 Prozent der Sitze und eine eigene Mehrheit für eine europäische »große Koalition«. 2019 ging diese Mehrheit erstmals in der Geschichte der EU verloren, seither waren mindestens drei Fraktionen für die Mehrheitsbildung notwendig. Kommissionspräsidentin von der Leyen (EVP) wurde von einer Koalition aus EVP, Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament (S&D), Liberalen und zum Teil dank Unterstützung aus dem EKR (etwa polnische PiS) mit knapper Mehrheit gewählt. Bei einzelnen Fragen wie in der Klima- oder Sozialpolitik setzen sich jedoch teilweise auch Mehrheiten aus S&D, Renew Europe, Grünen und Europäischer Linken durch, während sich etwa in der Wirtschaftspolitik Mehrheiten aus EVP, S&D und Renew Europe fanden. Zum Ende der Legislaturperiode hat die EVP versucht, gegen Teile der Klimapolitik eine Mehrheit rechts der Mitte mit EKR, Teilen von Renew Europe sowie Stimmen aus der ID-Fraktion zu organisieren, hatte damit aber bislang keinen Erfolg. Diese Fragmentierung hat neben der Krisendynamik dazu beigetragen, dass sich das EP seltener mit seinen Positionen durchsetzen konnte als 2014–2019, etwa bei der Frage der Besetzung der Kommissionsspitze. Hier wählte eine knappe Mehrheit des EP auf Vorschlag des Europäischen Rates Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin, obwohl die Abgeordneten zuvor erklärt hatten, nur jemanden zu wählen, der als Spitzenkandidat bzw. -kandidatin angetreten sei.
Präsidentialisierung in der Kommission
In der Kommission haben sowohl die Präsidenten Juncker als auch von der Leyen die Zentralisierung vorangetrieben. Mit 27 bzw. 28 EU-Staaten, die jeweils ein Kommissionsmitglied nominieren, war das Kollegium zu groß geworden, um sinnvoll und gleichrangig Aufgaben zu verteilen. Jean-Claude Juncker hat daher ein Matrix-Modell eingeführt, bei dem insgesamt sieben Vize-Präsidenten für übergreifende Themenbereiche zuständig waren. Zudem hat er seiner Kommission mit zehn Prioritäten ein klarer definiertes politisches Programm gegeben. Diesen Trend setzte Ursula von der Leyen fort, mit einem Fokus auf sechs Prioritäten sowie einer weiteren Hierarchieebene von nunmehr zwei Exekutiven Vize-Präsidenten (je einer für die S&D- und die Renew-Parteien), dem Hohen Vertreter, vier regulären Vize-Präsidenten und dann 18 regulären Kommissarinnen und Kommissaren. In der Folge ist die Kommission deutlich hierarchischer und präsidentieller geworden, mit sehr viel mehr politischer Steuerung direkt durch die Kommissionspräsidentin.28
Ausblick
Übergreifend zeigt die Analyse, dass die institutionelle Architektur der Union in den zurückliegenden und noch anhaltenden Krisen im doppelten Sinne resilient geblieben ist. Auf der einen Seite hat die EU trotz zum Teil existentiellen Drucks zusammengehalten und ist nach wie vor primärer Handlungsrahmen für ihre Mitgliedstaaten (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs). Auf der anderen Seite ist die politische Scheu vor Vertragsänderungen so groß geblieben, dass alle neuen Instrumente – mit der sehr begrenzten Ausnahme einer minimalen Ergänzung von zwei Sätzen für den ESM – durchweg auf Basis der bestehenden Verträge geschaffen wurden, wenn auch mit zum Teil sehr breiter Auslegung. Alle Initiativen zu Primärrechtsänderungen oder Nutzungen von Brückenklauseln liefen dagegen bis jetzt ins Leere.
Zweitens haben sich in der Machtbalance zwischen den EU-Institutionen zwei nahezu vollständig unterschiedliche politische Systeme der EU entwickelt. In der Krisengovernance dominieren die exekutiv-intergouvernementalen Institutionen, mit dem Europäischen Rat im Zentrum, aber auch einer zusehends gestärkten Europäischen Kommission. Dies gilt insbesondere für die in der Pandemie und in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine neu geschaffenen Instrumente. Hierbei ist das Europäische Parlament fast vollständig außen vor. Demgegenüber fußen die großen regulativen Vorhaben der EU, wie etwa im Green Deal oder der digitalen Agenda, auf der Gemeinschaftsmethode, mit einem deutlich stärkeren Europäischen Parlament, das gleichberechtigt mit dem Rat entscheidet, und einer umfänglichen Nutzung des effektiveren, aber intransparenteren Trilog-Verfahrens.
Innerhalb der Institutionen zeigen sich jeweils die Auswirkungen der fortschreitenden Fragmentierung und (partei-)politischen Polarisierung der europäischen Politik, allerdings mit unterschiedlichen Auswirkungen. Im Rat der EU und im Europäischen Rat hat der Wille zur Konsensfindung eher zu- als abgenommen, auch in Bereichen, wo rein rechtlich Entscheidungen mit Mehrheitsbeschlüssen möglich wären. In der EU-Kommission wiederum hat trotz größerer Fragmentierung der parteipolitischen Herkunft der Kommissionsmitglieder eine Hierarchisierung und Präsidentialisierung stattgefunden. Im Europäischen Parlament schließlich hat die Fragmentierung dazu geführt, dass die europäische »große Koalition« ihre eigene Mehrheit verloren hat, weshalb für eine Mehrheitsbildung in der aktuellen Legislaturperiode mindestens drei Fraktionen notwendig sind. Dies hat dazu beigetragen, dass die Verhandlungen im EP komplexer geworden sind; eine weitere Folge war die Schwächung des EP im interinstitutionellen Gefüge.
Mit Blick auf den kommenden institutionellen Zyklus 2024–2029 dürften sich diese Trends zunächst fortsetzen. Umfragen lassen ein noch stärker fragmentiertes Parlament erwarten.29 Die Nutzung von Instrumenten wie den gemeinsamen Gas- und Munitionskauf in Reaktion auf den Krieg gegen die Ukraine zeigt, dass die Krisengovernance und die neuen, in der Pandemie entwickelten Instrumente »Schule« gemacht haben. Schwerer einzuschätzen ist hingegen, ob sich die Petrifizierung der Verträge auch unter den Vorzeichen einer neuen Dynamik in der Erweiterungspolitik fortschreiten wird. So fordert etwa die deutsche Bundesregierung mit Blick auf die potentiellen Beitritte der Ukraine, der Republik Moldau und der Staaten des Westlichen Balkans sowie möglicherweise Georgiens, dass die EU vorab institutionell reformiert werden soll, was Vertragsänderungen einschließt.30 Nach dem Bericht einer deutsch-französischen Expertengruppe,31 der konkrete Vorschläge für das Zusammenführen von Reform und Erweiterung enthält, hat sich der Europäische Rat zumindest im Grundsatz darauf verständigt, dass die EU in Vorbereitung auf die Erweiterung reformiert werden soll.32 Wie weit diese Reformen gehen werden und ob und in welcher Form die Petrifizierung des institutionellen Gleichgewichts aufgehoben wird, ist daher eng mit der Erweiterungsdebatte in der nächsten Legislaturperiode verknüpft.
Mitgestaltung und Selbstbehauptung im Krisenfunktionalismus. Die Mitgliedstaaten in der Polykrise
Den Mitgliedstaaten der Europäischen Union kommt in der Ära der multiplen Krisen eine prominente Rolle zu. Krisen, Kriege und externe Erschütterungen fordern zwar die EU als Ganze, rufen die Gemeinschaftsinstitutionen auf den Plan, aktivieren bestehende Abläufe und initiieren neue Mechanismen. Doch die unvorhersehbare Dynamik von Krisen, die Eskalationsrisiken und systemischen Bedrohungen erfordern häufig nicht eingeübte Reaktionsformen und neue Maßnahmen des Krisen- und Konfliktmanagements, bei denen die Mitgliedstaaten ins Spiel kommen. Internationale oder gesamteuropäische Notfallsituationen sind zumeist auch der Moment nationaler Exekutiven, sowohl auf staatlicher Ebene als auch im EU-Rahmen. Durch »kurze Drähte«, informelle Abstimmung und rasches Aktivwerden können sie zum Beispiel gegenüber der Europäischen Kommission Handlungsvorsprünge generieren. Die meisten Krisenbearbeitungsmaßnahmen mit europäischer Reichweite müssen von ihnen zwar akzeptiert und berücksichtigt werden, ihr politisches und wirtschaftliches Gewicht ermöglicht es ihnen aber auch, bislang nicht existierende Instrumente zu entwickeln und gegebenenfalls durchzusetzen. Im Zuge der Krisen ließ sich nicht zuletzt eine Zunahme finanzieller Mechanismen wie den »Rettungsschirmen« im Kontext der Finanzkrise, den SURE-Garantien oder dem Aufbau der Europäischen Friedensfazilität (EPF) beobachten, die von den Mitgliedstaaten jenseits des bisherigen vertraglichen Gerüsts etabliert wurden.
Die Mitgliedstaaten und ihre Funktionen im Krisengeschehen
Die Mitgliedstaaten haben in derlei Belastungs- und Stressphasen europäischer Politik weiterhin ein polyvalentes Funktionsprofil. Sie initiieren und ermächtigen, sie verhindern und kontrollieren, sie gestalten und bremsen. Dies alles tun sie auf der Basis ihrer nationalen Parameter: Sie fechten für ihre Belange, sie bringen ihre Vorstellungswelten ein und sie handeln im Rahmen nationaler Prägungen. Interessen, Ideen und Identitäten konstituieren das mitgliedstaatliche Handlungsdispositiv. Damit sorgen die Mitgliedstaaten prinzipiell für ein beachtliches Maß an Heterogenität. Durch ihre Einbindung in Institutionen und das Regelwerk der Gemeinschaft haben sich die Mitglieder der EU indes in eine selbstgewählte Architektur unifizierter und unifizierender Handlungsvorgaben begeben. Auf diese Weise sollen gleichwertige, ja in mancherlei Hinsicht gleiche oder zumindest konvergierende Ausgangsvoraussetzungen für wirtschaftliches, bürgerschaftliches und politisches Handeln geschaffen werden. Das damit angelegte Spannungsverhältnis zwischen Selbstbehauptung und Einfügungszwang ist so alt wie die europäische Integration selbst. Es entwickelt aber häufig neue Brisanz, wenn zusätzliche Domänen dem gemeinschaftlichen Regelungsgefüge zugeführt werden sollen. Gerade in der Periode der Polykrise kommt es zu neuen Zuspitzungen, da Herausforderungen an die EU gestellt werden, die gemeinsames Handeln in Sachgebieten erfordern, welche zum klassischen Zentrum staatlicher Hoheit gehören, so etwa Finanzpolitik, Gesundheitspolitik, innere Sicherheit und Zuwanderung sowie Außen-, Sicherheits- und Finanzpolitik. Zeitgleich mit der Krisenphase differenziert sich auch die neue Rechtsstaatssicherungspolitik der Union aus, die ein Instrumentarium entwickelt hat, mit dem unmittelbar in die innersten Souveränitätssphären der Mitgliedstaaten hineingewirkt werden kann und das Regelungsbereiche wie die Justiz, die öffentliche Verwaltung oder generell den Staatsaufbau betrifft. Obschon ein krisengenerierter Handlungsbedarf neue Segmente der »kernstaatlichen«1 Zuständigkeit dem Zugriff europäischer Regelung öffnen und so innere Grenzen der Integrationstiefe durchbrechen kann, ist bislang keine durchgängige Erosion staatlicher Hoheit zu verzeichnen, denn gleichzeitig ergeben sich auch Gegenbewegungen und Kompetenzsicherungstendenzen. Kurzum: Externe Schocks, Krisen und Kriege können als Treiber für das Zurückdrängen oder Aufbrechen nationaler Souveränitätsbereiche fungieren,2 damit aber auch die Diskussionen in und zwischen Mitgliedstaaten über deren Fähigkeiten verstärken, sich wie bislang in und gegenüber den Institutionen sowie im Verhältnis zu anderen EU-Mitgliedern durchzusetzen.
Zerklüftung und Zusammenwirken
Die innenpolitischen Zerklüftungen in zahlreichen Mitgliedstaaten gehen häufig mit ausgeprägten politikfeldbezogenen Polarisierungen einher, die für größere Pendelschwünge nach Regierungswechseln sorgen können als in der Vergangenheit. Gerade in Ländern, in denen sich wie in Italien, Polen, Ungarn, der Slowakei oder Frankreich, aber auch zu einem gewissen Maß in der Tschechischen Republik oder in Österreich starke integrationsfreundliche und starke europaskeptische Lager gegenüberstehen, haben Machtwechsel spürbare Konsequenzen für die Europapolitik. Im EU-Kontext werden solche Konstellationen dann relevant, wenn auch die Europapolitik Gegenstand der Konfrontation wird und der europa- und außenpolitische Konsens – sofern er bestanden hat – zerbricht. Da mit der in zahlreichen Staaten anzutreffenden Stärkung europakritischer Strömungen und der Erosion des integrationsfreundlichen Spektrums solche Konstellationen häufiger auftreten können, ist künftig mit tendenziell mehr europapolitischen Swing-States in der EU zu rechnen als bislang. Hierbei kann sich sowohl die integrationspolitische Grundausrichtung (»integrationsfreundlich« oder »integrationsavers«) verändern als auch ein grundsätzlicher Schwenk in einzelnen Themenbereichen ergeben (etwa in der Sicherheitspolitik oder in Fragen der Rechtsstaatlichkeit). Derlei Tendenzen können die Berechenbarkeit von Partnern, aber auch die Stabilität von Koalitionen und die Festigkeit von Trennlinien spürbar reduzieren. Daher müssen mehr als bislang die europapolitischen Grundaufstellungen und die innen- und parteipolitischen Rahmenbedingungen in Mitgliedstaaten betrachtet werden.
Im Zusammenwirken von Krisen und langfristigen Politikprozessen hat sich ein Ensemble großer »politisierter« Themenkomplexe herausgebildet, welches das Integrations- und Kooperationsgeschehen weiterhin prägen wird, auch wenn die jeweils relevanten Teilaspekte im Lauf der Zeit variieren können:
-
ein ökonomisch-finanzpolitisches Cluster,
-
Migration und Asyl,
-
Klima- und Energiefragen,
-
geopolitische Positionierungen,
-
Grundfragen der Kompetenzordnung einschließlich der Rechtsstaatspolitik.
-
Hinzu tritt als nicht themengebundene, sondern strukturelle Konfliktdimension die Auseinandersetzung zwischen großen und kleinen Mitgliedstaaten.
Diese basalen Themen sind multidimensional, und die diesbezüglichen Auseinandersetzungen führen in der Regel nicht zu einer dichotomen Gruppenformierung, sondern meist zu differenzierteren Situationen. Während diskursive Zuspitzungen wie Norden gegen Süden bzw. Frugale gegen Großzügige in Haushaltsfragen oder Ost gegen West in Bezug auf das Thema Migration Zweiteilungen suggerieren, die unter anderem durch temporäre Frontstellungen (etwa Showdowns auf Gipfeltreffen) dem Anschein nach bestätigt werden, stellt sich das Bild bei breiterer Betrachtung häufig anders dar.
Denn zum einen sind in einem ausgedehnteren Themenbereich die Interessen nicht immer gleichläufig. Exemplarisch sei auf das ökonomisch-finanzpolitische Feld verwiesen. Hier geht es um wirtschafts-, steuer-, industrie- oder haushaltspolitische Fragen. Fiskalkonservative, »frugale« Mitgliedstaaten, die einer expansiven, flexiblen und »solidarischen« europäischen Haushaltspolitik skeptisch gegenüberstehen und sich damit konträr zu vielen Ländern des »Südens« positionieren, können wiederum in Fragen der Industriepolitik gemeinsam mit diesen Ländern gegen die ihrer Auffassung nach wettbewerbsverzerrende Beihilfenpolitik großer Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich opponieren. Die Forderung nach steuerpolitischer Harmonisierung läuft quer zur Frontbildung in Sachen Haushaltspolitik und wird je nach Blickwinkel als Voraussetzung für einen effektiven Binnenmarkt oder als Einschränkung von Wettbewerb betrachtet. Hier finden sich dann einige Länder des fiskalischen Nordens und Ostens, also »Nettozahler« wie auch »Nettoempfänger«, vereint gegen die Verfechter von mehr steuerlicher Chancengerechtigkeit.
Zum anderen verändern sich auch die Positionen innerhalb der Lager. Der wohl spektakulärste Fall im Laufe der Polykrise ist die Lancierung des Next-Generation-Pakets. Deutschland, das im Gefolge der Finanzkrise in den unnachgiebigen fiskalischen Norden eingereiht wurde, initiierte und unterstützte zusammen mit Frankreich ein Hilfsprogramm,3 das sowohl im Umfang als auch in seiner Konstruktion (Aufnahme von Krediten durch die EU) gerade nicht für Ordo-Liberalismus in restriktiver Ausprägung stand. Dieser Schwenk zeigte, dass im Falle Deutschlands breitere integrationspolitische Gesichtspunkte Dispositionen, die bislang als tief verankert galten, rasch überlagern können. Solche Neupositionierungen können immer wieder auch infolge der oben genannten innenpolitischen Wechsel erfolgen. Gerade dort, wo kein europapolitischer Konsens herrscht, kann es zu Neubewertungen kommen – nicht immer im Sinne eines »Seitenwechsels«, aber oft in Form einer kompromissbereiteren Haltung.
Konfliktlinien zwischen den Mitgliedstaaten sind nicht immer stabil; themenbezogene Lagerbildungen führen oft eher zu losen Gruppen als zu »Blöcken«.
Insgesamt bedeutet dies, dass Konfliktlinien nicht immer stabil sind und dass themenbezogene Lagerbildungen häufig nicht zur Entstehung von »Blöcken«, sondern eher von losen Gruppen führen. Dies gilt nicht nur für themenbasierte Konfliktachsen, sondern auch bei der strukturellen Gegenüberstellung von »Groß« und »Klein«. Länder wie Polen oder die Niederlande befinden sich in einem intermediären Feld. Sie stehen einerseits in der Abgrenzung zur Präponderanz Deutschlands und Frankreichs (bei Polen ideologisch untermauert) und betrachten sich als Sachwalter der kleineren Staaten, etwa wenn es – so im Falle Polens – um die Ablehnung von Mehrheitsentscheidungen in der Außenpolitik geht.4 Andererseits gehören sie mit Blick auf ihre Wirtschaftsleistung oder ihr Bevölkerungspotential zu den gewichtigen Mitgliedstaaten und können prinzipiell an Formaten wie dem Weimarer Dreieck (Deutschland, Frankreich, Polen) oder den Big Five in der Eurozone (Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Spanien)5 mitwirken.
Auch in der Zeit einander überlappender Krisen sind Blockade-Akteure aus dem Kreis der Mitgliedstaaten ein harter Faktor europäischer Politik. Die Entwicklung in einzelnen Politikfeldern sowie die Diskussionen über den institutionellen und prozeduralen Reformbedarf in der EU legen nahe, dass die Krisen und die von außen an die EU herangetragenen Herausforderungen keine unmittelbare Zunahme von Vetohaltungen und offenen Abstimmungen gegen Mehrheiten zur Folge haben.6 Vetodrohungen und Nein-Voten durch Exekutiven haben vermutlich öfter als in der Vergangenheit ideologische Gründe und resultieren nach wie vor aus der Positionierung zu europapolitischen Ordnungs- und Zukunftsfragen (etwa dort, wo es aus Sicht von Mitgliedstaaten implizit oder indirekt um vertikale Kompetenztransfers geht oder bei der Erweiterungspolitik), aus innenpolitischen Motiven (etwa bei sensiblen Fragen wie Migration oder der Erweiterung der Schengen-Zone) oder dem Streben nach Interessendurchsetzung, das Einzelfragen als essentielle nationale Belange betrachtet bzw. diese als Teil einer Logrolling-Strategie auffasst, eines transaktionalen Tauschs. Die zuletzt genannte Strategie, sachfremde Fragen zum eigenen Vorteil miteinander zu verknüpfen, ist nicht neu, wurde aber im Zusammenhang mit Einzelfällen (Zyperns Vetodrohung im Falle von Sanktionen gegen Belarus bei gleichzeitiger Forderung von Strafmaßnahmen gegen die Türkei) oder einer mehrfachen Anwendung bzw. Ankündigung von Blockaden durch Ungarn zu einem Katalysator für die Suche nach Umgehungsstrategien etwa in Form der Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen7 insbesondere in der Außenpolitik, konkret bei Sanktionen.
Der Blick in die Politikfelder zeigt indes, dass Vetoakteure oder Sperrminoritäten in der Regel keine dauerhafte Verhinderung bewirken konnten. Lange Phasen der Stagnation gab es vor allem bei der Erweiterungspolitik8 und in Migrationsfragen. In anderen Bereichen kam es eher zu zusätzlichen Abstimmungsschleifen, länderspezifischen Ausnahmeregelungen oder nationalen Kompensationen im Gegenzug für ein Einlenken. Unnachgiebiger Widerstand einiger Mitgliedstaaten ist allerdings immer dann zu erwarten, wenn es um institutionelle Änderungen geht, die Mechanismen der Blockade aufweichen könnten, indem sie etwa Einstimmigkeitsregeln abschaffen oder Mehrheitsvoten (konkret den QMV-Mechanismus) weniger minderheitenfreundlich ausgestalten. Angesichts der Auseinandersetzungen um die Blockademacht von Regierungen sind in der Diskussion andere Vetomöglichkeiten in den Hintergrund geraten, obschon sie in der Praxis weiterhin relevant sein werden. Parlamente, Verfassungsgerichte oder Referenden können Handlungsspielräume für Exekutiven auch in Zukunft eingrenzen.
Insbesondere bei formalen Ratifizierungserfordernissen, im Einzelfall aber auch bei De-facto-Vertiefungsschritten, werden auch künftig institutionelle oder innenpolitische Restriktionen in Mitgliedstaaten zum Tragen kommen. Im Kontext von Referenden sind hierbei zwei Grundsituationen zu unterscheiden, die beide europapolitische Relevanz haben. Zum einen geht es um Referenden, die im innerstaatlichen Prozess politisch notwendig sind, um europarechtliche Neuregelungen zu ermöglichen. Diese sind teils zwingend, teils fakultativ, bergen aber aus Sicht von »reformwilligen« Exekutiven immer ein hohes Risiko. Zum anderen, und dies ist ein neues Phänomen, geht es um Abstimmungen, die von Regierungen selbst angestoßen werden, um mit direktdemokratischer Legitimation Prozesse auf europäischer Ebene abzubremsen bzw. die eigene Ablehnung zu rechtfertigen. Das in Polen im Zusammenhang mit den Parlamentswahlen 2023 durchgeführte (und am Quorum gescheiterte) Referendum, das auch die europäische Migrationspolitik betraf, sowie das ungarische Referendum vom Oktober 2016 gegen verbindliche Quoten für die Umverteilung von Geflüchteten in der EU (das ebenfalls am Quorum scheiterte) sind Beispiele für derlei Voten. Möglicherweise könnten konfliktbereite Regierungen künftig versuchen, gestützt auf Referenden die Umsetzung von EU-Recht zu vereiteln, also den Bruch mit der Rechtsordnung zu riskieren, indem sie Legitimität gegen Legalität in Stellung bringen.
Permakrise und Krieg haben zweifelsohne eine erhöhte Nachfrage nach mitgliedstaatlichem Engagement generiert. Die konstruktive Zusammenführung der abweichenden nationalen Interessen erfordert allerdings neben Appellen und Angeboten seitens der Kommission, des Europäischen Parlaments oder anderer EU-Institutionen auch Akteure mit Führungs- und Synthetisierungseigenschaften, also solche, die sowohl richtungsgebend handeln als auch abweichende Positionen einbeziehen.
Die Abfolge der großen Krisen zeigt, dass der deutsch-französischen Zusammenarbeit trotz zahlreicher bilateraler Friktionen große Bedeutung zukommt.
Die Abfolge der großen Krisen seit Beginn der letzten Dekade zeigt, dass der deutsch-französischen Zusammenarbeit ungeachtet immer wieder auftretender Friktionen hierbei eine ungebrochen große Bedeutung zukommt. Die Krise, die den Einstieg in die Abfolge der großen Erschütterungen markierte, nämlich die Finanzkrise, stand unter dem Vorzeichen deutsch-französischer Dissonanz und eines zunehmenden Ungleichgewichts zugunsten Deutschlands. Obschon in der Migrationskrise beide Länder im Grundsatz für ein EU-weites Solidarschema eintraten und die wesentliche Konfliktachse zwischen Deutschland und den Visegrád-Staaten bzw. anderen ostmittel- und südosteuropäischen Länder verlief, stellte sich kein deutsch-französischer Gleichklang ein, unter anderem deswegen, weil in Frankreich Migrationspolitik früher und stärker versicherheitlicht war als in Deutschland.
Der Brexit war insofern ein Impuls, der dem Wiedererstarken der deutsch-französischen Beziehungen im EU-Kontext zuträglich war. Das Gewicht des Tandems, das nach der Osterweiterung abgenommen hatte, nahm nun wieder zu. Das Abdriften Polens in europaskeptische und gleichzeitig Berlin- sowie-Paris-kritische Positionen verstärkte diesen Trend. Das Weimarer Dreieck, das auch zuvor kaum einmal europapolitische Prägekraft entwickelt hatte, blieb weiter randständig. Deutschland und Frankreich vergewisserten sich in dieser Lage abermals ihrer europäischen Verantwortung und verfolgten nach dem Ausscheiden eines der Schwergewichte aus der Gemeinschaft eine Agenda des Zusammenhalts der Gemeinschaft. Gestützt auf einen »eingebetteten Bilateralismus«, also der Knüpfung eines Kooperationsgeflechts, das die wechselseitigen Kontakte in einen europapolitischen Kontext einbindet,9 vermochten es Deutschland und Frankreich daher, in der Folgezeit wieder neue Gestaltungsfähigkeit zu entwickeln – in der Pandemie aufgrund ihrer systemischen Stabilisierungsfunktion durch das NextGeneration-Instrument, im Ukraine-Krieg auf Basis der »Zeitenwende« in Deutschland und des französischen Abschieds von Kooperations- und Besänftigungsstrategien gegenüber Moskau.
Es wäre sicherlich unzutreffend, von einer Renaissance der deutsch-französischen Dyade zu sprechen. Nach wie vor stocken Abstimmungsprozesse, unterbleibt Kommunikation und werden Kooperationschancen nicht genutzt. Gleichwohl lässt sich konstatieren, dass Grundsatzfragen der Integration und Schlüsselmomente des Krisenmanagements, in denen eine deutsch-französische Abstimmung notwendig war und ist, neue Relevanz gewonnen haben. Diese speist sich neben dem aktiven beiderseitigen Führungsverständnis auch daraus, dass andere, komplementäre Partnerschaften in der EU fehlen oder abhandengekommen sind. Hierzu gehören die deutsch-polnischen Beziehungen von 2015 bis Herbst 2023, eine fragmentierte Visegrád-Gruppe, ein mit sich selbst beschäftigtes Italien, die ungeachtet integrationsfreundlicher Grundausrichtung in Migrations- und Wirtschaftsfragen stark ihre Eigeninteressen durchsetzenden Niederlande oder die südosteuropäische innere Peripherie der EU.
Dass viele dieser Mitgliedstaaten – und auch andere – in den Krisen eine permissive Haltung gegenüber Deutschland und Frankreich gezeigt haben, darf nicht als neue Akzeptanz fehlgedeutet werden, sondern resultiert vor allem aus dem Fehlen alternativer Führungsangebote, aber durchaus auch aus der Schlüssigkeit der meisten Vorstöße, die beide Länder unternommen haben. Auch wenn die aus Polen bis Herbst 2023 zu vernehmenden Unterstellungen eines deutsch-französischen Hegemonialstrebens ideologisch überzeichnet und als Regierungspolitik ein Einzelfall blieben, lässt sich in vielen anderen, nicht zuletzt kleineren Mitgliedstaaten eine fortbestehende unterschwellige Skepsis feststellen, die eine deutsch-französische Führung auf lange Sicht eingrenzen oder ergänzen möchte. Offenkundig ist daher, dass Deutschland und Frankreich sich um die Einbindung anderer Partner bemühen müssen – sei es, um deren Akzeptanz zu sichern, sei es, um bei deutsch-französischen Reibungen auf einen über das Bilaterale hinausreichenden Abstimmungsrahmen zurückgreifen zu können.
Mehrdeutig ist vor diesem Hintergrund die Rolle minilateraler Kooperationen zwischen Mitgliedstaaten. Sie können nicht zuletzt als Versuch gewertet werden, jenseits der deutschen bzw. deutsch-französischen Koordination alternative Formen des Zusammenwirkens zu etablieren. Für eine betont Deutschland-kritische Ausrichtung solcher Formate, wie dies etwa bei der Dreimeeresinitiative (zunächst zwölf, seit 2023 dreizehn EU-Länder aus Ostmittel- und Südosteuropa) von Teilen des Regierungslagers in Polen erwogen worden war, ergab sich aber bei anderen Partnern nie Unterstützung. Vielmehr ging es zumeist darum, eigene Interessen ohne die dämpfende Vorabstimmung mit Berlin und Paris expliziter zu formulieren, also deutsche oder deutsch-französische Führung zu ergänzen oder abzubremsen. Letzterer Aspekt war vor allem spürbar bei Fragen der Migration, als die vier Visegrád-Länder im Gefolge der Migrationskrise 2015 gemeinsam gegen obligatorische Verteilungsquoten fochten, oder im Kontext der Finanzkrise und bei späteren finanzrelevanten Debatten in der EU und der Eurozone, als sich zunächst ein fiskalkonservativer »Norden« (anfangs noch mit Deutschland) bildete, der sich später auf die »frugalen« Vier (Dänemark, Niederlande, Österreich, Schweden) reduzierte.
Minilaterale Formate haben angesichts wechselnder Konfliktlagen Konjunktur, doch ihr spezifisches europapolitisches Gewicht schwankt.
Minilaterale Formate erleben Konjunkturen, wozu auch die Vielgestaltigkeit und die rasche Abfolge von Krisen beitragen, da sie wechselnde Konfliktlagen in der EU generieren, bei denen ähnlich denkende Staaten schnell in unterschiedlichen Lagern stehen können.10 Die Visegrád-Gruppe etwa differenzierte sich aus und wurde durch abweichende Haltungen zur Rechtsstaatspolitik und zum Krieg in der Ukraine gespalten. Die »neue Hanse« wiederum, ein Zusammenschluss nordwest- und nordeuropäischer Länder mit wirtschaftlichem Fokus, blieb ephemer. Offensichtlich wollten nicht alle Teilnehmer den in Haushaltsfragen restriktiveren Weg der »Frugalen« mitgehen. Minilaterale Formate sind insofern Gebilde, mit denen immer wieder zu rechnen ist, deren spezifisches europapolitisches Gewicht aber schwankt.
Krisenfunktionalismus statt Spillback
Es gibt kein übergreifendes, einheitliches Modell, das die Rolle der Mitgliedstaaten in der Abfolge von Krisen, Kriegen und Schocks der vergangenen Jahre charakterisieren könnte.11 Die in der Finanzkrise ablaufenden Prozesse der Aushandlung finanzieller Solidaritätstiefe zwischen den Mitgliedstaaten verlagerten sich phasenweise in den Europäischen Rat, dessen Agieren Exekutivzüge annahm und – angesichts einer wirtschaftlich und fiskalisch bedingten Machtasymmetrie – die finanz- und wirtschaftspolitische Governance der Krisenbewältigung in einem konsolidierungsorientierten Sinne prägte, indem neue Dialogstrukturen (Troika), Institutionen (ESM) und Regeln (Konditionalitäten für Finanzhilfen) eingeführt oder auf den Weg gebracht wurden (Bankenunion, Fiskalunion). Die Mitgliedstaaten überantworteten die Konsolidierung zwar an die Kommission und andere Einrichtungen (Troika, Quadriga), hielten sich jedoch politische Flexibilisierungsmöglichkeiten offen. Diese wurden in Reaktion auf die Pandemie und den Krieg durch das Auflegen von Sofortprogrammen mit Stabilisierungs-bzw. Unterstützungscharakter deutlich ausgedehnt.
In der seit 2015 andauernden Abfolge von Migrationskrisen12 dominierte mitgliedstaatlicher Dauerzwist, der – innenpolitisch aufgeladen – lange zu Stillstand mit allenfalls partiellen Entlastungseffekten für besonders betroffene Mitgliedstaaten führte. Erst dank eines elastischen Solidarkonzepts (ohne verbindliche Verteilungsquoten und mit der Akzeptanz anderer Formen des solidarischen Engagements) konnte per Mehrheitsentscheidung – und gegen den Willen Polens und Ungarns – ein vorsichtiger Einstieg in eine Kompromissformel zur Lastenteilung gefunden werden. Im Gegensatz zur Finanzkrise und zur Pandemie, als Solidargeber aufgrund systemischer Erwägungen (sprich der Furcht vor unkontrollierbaren wirtschaftlichen Zusammenbrüchen) neue Hilfsformen etablierten und Solidarnehmer diese aufgrund ihrer Verwundbarkeit hinnehmen mussten und dafür Austeritätsmaßnahmen zu akzeptieren hatten, verharrten die Mitgliedstaaten in Sachen Migration und Asyl lange in einer Situation der Blockade, die erst im Schatten des Krieges in der Ukraine in Ansätzen überwunden werden konnte.
Russlands Überfall auf die Ukraine sorgte für ein schnelles, kooperatives Ineinandergreifen von Mitgliedstaaten und Kommission. Während die Politik gegenüber Russland die Mitgliedstaaten in der Vergangenheit tendenziell auseinanderdividierte, fungierte der Angriff auf die Ukraine als Katalysator für ein einheitliches und beschleunigtes Handeln. Trotz grundsätzlicher Kritik aus Ungarn sowie politikfeldspezifischer Partikularinteressen anderer Mitgliedstaaten (etwa im Bereich Energie oder anderer Wirtschaftszweige) leitete die EU Sanktionen ein, erbrachte sie umfangreiche und teils neue Formen der Hilfe für die Ukraine (Finanzhilfen, EPF, Ausbildungsmission) und unterstützte sie die Mitgliedstaaten bei Diversifizierungs- und Resilienzmaßnahmen im Energiesektor (u. a. REPowerEU13). Das Bild, das sich im Laufe des Krieges ergab, war bislang das eines geostrategisch und sicherheitspolitisch motivierten Zusammenwirkens in Form einer Arbeitsteilung zwischen Mitgliedstaaten und Kommission, mit Elementen gegenseitiger Verstärkung (z. B. Refinanzierung von Waffenlieferungen aus Mitgliedstaaten durch die EU) und kompromissermöglichenden Sonderregelungen (z. B. Sanktionsausnahmen oder Beibehaltung sektoraler Kooperation mit Russland in einigen Mitgliedstaaten). Diese kooperative Konstellation ist nicht ohne weiteres generalisierbar, aber Krisenlagen, die ja in einer Vielzahl von Mitgliedstaaten ein Bewusstsein der Dringlichkeit und des Handlungsdrucks erzeugen, dürften ihrem Entstehen prinzipiell zuträglich sein. Nach der Entspannung krisenhafter Dringlichkeitssituationen kann es allerdings in Mitgliedstaaten zu gegenläufigen Entwicklungen kommen, etwa dann, wenn sie befürchten, die Kommission könnte übermäßig Einfluss gewinnen, oder der Meinung sind, die in der Krise angestoßenen neuen Mechanismen seien nicht mehr erforderlich.
In der Gesamtschau hat die Abfolge äußerer Schocks keinen Krisenkonstitutionalismus, sondern eine Art Krisenfunktionalismus hervorgebracht.
In der Gesamtschau hat die Abfolge äußerer Schocks keinen Krisenkonstitutionalismus, sondern eine Art Krisenfunktionalismus hervorgebracht, bei dem Dringlichkeitsimperative und teils systemische Gefährdungseinschätzungen neue Kooperationsverschränkungen und Integrationsimpulse bewirkt haben. Dieser aus dem Zwang zu raschem und effektivem Agieren resultierende Modus der Bewältigung und Bearbeitung von Krisen und Störungen beinhaltete unterschiedliche Varianten. Er umfasste sowohl »vertiefende« und gemeinschaftsfördernde Prozesse als auch interexekutive Koordination sowie Mischformen wie »Staatengemeinschaftszuständigkeiten zur gesamten Hand«.14 Was sowohl der neue Intergouvernementalismus mit seinem »Paradoxon der Integration«15 als auch der neue Supranationalismus mit seiner gemeinschaftsverstärkenden Ermächtigungsthese (Gemeinschaftsinstitutionen erhalten von Mitgliedstaaten den Auftrag, neue Aufgaben abzuarbeiten, die diese Institutionen teils selbst ersonnen haben)16 unterschätzen, sind die Beweggründe, die Mitgliedstaaten dazu bringen, von Zurückhaltung oder Ablehnung gegenüber Kooperations- oder Integrationszunahme abzurücken.
Eine entscheidende Rolle dürfte in diesem Zusammenhang spielen, wie »zögerliche« Mitgliedstaaten das systemische Gefahrenpotential einschätzen. Wenn Mitgliedstaaten zu der Auffassung kommen, dass eine Krise oder eine andere externe Erschütterung die Reproduktion des gesamten Integrationsgeschehens gefährdet, sind sie eher bereit, Stabilisierungs- oder Resilienzpolitiken zuzustimmen, die bislang nicht mit ihren Ordnungsvorstellungen vereinbar waren. Die »Whatever it takes«-Devise kann dann als Türöffner für neue europäische Handlungsformen dienen. Unterschätzt werden hierbei bislang Lerneffekte in als systemisch empfundenen Krisenmomenten. Mit ihnen lässt sich etwa erklären, warum in der Finanzkrise »austeritätsorientierte« Haltungen dominierten, in der Pandemie hingegen die »frugalen« Mitglieder sich nicht mehr durchsetzen konnten. Gleichzeitig wurden – in begrenzter Form und durch die Debatte in Politik und Öffentlichkeiten – im Gefolge der Finanzkrise erste Mechanismen zumindest erörtert und politisch-diskursiv eingeübt, die später die Ausgabe von Gemeinschaftsanleihen ermöglichten.17
Das echte »Mehr« an europäischer Integration, also die unverkennbaren Vergemeinschaftungstendenzen und die Erschließung neuer oder die Intensivierung bestehender Regelungsbereiche, wird nur zum Teil vom Krisenfunktionalismus angetrieben: etwa bei der Klimadauerkrise für die Energie- und Klimapolitik18 oder bei Aspekten der Finanzpolitik,19 nicht aber bei der Rechtsstaatspolitik, die Folge einer normativ inspirierten Binnenpolitik ist. Weil sowohl die kriseninduzierte als auch die normative Europäisierung sensible nationalstaatliche Hoheitsdomänen betrifft, kommt es in der politischen Praxis vermehrt zu Grundsatzkontroversen. In ihnen geht es nicht nur darum, dass die Endpunkte einer föderalen und einer dezentralen Union einander widersprechen, sondern auch darum, dass die Begründungen einer fortschreitenden Integration stark auseinandergehen: Der Forderung nach mehr Handlungsfähigkeit durch mehr Supranationalität wird unterstellt, dass entsprechende Reformen – insbesondere die Stärkung von Majoritätsregeln und Durchgriffsmöglichkeiten durch Gemeinschaftsorgane – ein Instrumentarium für eine straffere Interessenpolitik oder sogar für ein Hegemonialstreben der großen Mitgliedstaaten sei. Abgesehen von weltanschaulichen Motivlagen oder einem dezentral strukturierten europapolitischen Leitbild von Exekutiven scheint aber auch bei ideologisch wenig konturierten Regierungen vor allem in mittelgroßen und kleinen Mitgliedstaaten eine Neuausrichtung stattgefunden zu haben. Sie haben ihre hergebrachte Einschätzung, wonach starke Gemeinschaftsinstitutionen, die effektiv Regeln durchsetzen können, Schutz vor Dominanz durch große Mitgliedstaaten bieten, häufig revidiert, wobei gleichzeitig die Idee des Souveränitätspoolings – des Zusammenfließens von Hoheitssegmenten in einen gemeinschaftlich verfügten Entscheidungsraum – als Form der Mitgestaltung in der EU an Attraktivität verliert. Dies könnte damit zu tun haben, dass die Domestizierungsfähigkeiten supranationaler Strukturen gegenüber der Interessenpolitik von »Schwergewichten« angesichts zunehmender Renationalisierungstendenzen und der Exekutivlastigkeit des Krisenmanagements angezweifelt werden.
Trotz der teils weltanschaulich angereicherten Konflikte um EU-Reformen, vertikale Zuständigkeitsabgrenzungen und generell die Zukunft der EU, trotz mitunter entschlossen formulierter Opposition gegen eine schleichende Kompetenzausweitung (competence creep) und Entsouveränisierung kam es aber nicht zu einer Trendumkehr. Weder ist ein überbordender Spillback zu verzeichnen – eine inverse Tendenz zur Integrationsgenerierung durch funktionale Kooperationsverdichtung –, noch kommt es zum Rückbau (de-ramification) europäischer Verflechtungen. Wenn überhaupt, sind eher Maßnahmen des formalen Status-quo-Erhalts (keine weiteren Vertragsreformen), temporärer Widerstand gegen politische und rechtliche Kompetenztransfers und ‑ausweitungen oder in Einzelfällen die Prüfung selektiver Entflechtung zu verzeichnen (Opt-Outs, die aber zumeist schwer praktikabel sind, zumindest wenn es sich um bereits eingegangene Integrationsverpflichtungen handelt).
Ursächlich hierfür dürften vornehmlich vier Faktoren sein. Erstens lassen sich die krisenbedingt geschaffenen regulativen oder institutionellen Innovationen nicht einfach rückabwickeln. Die Einebnung beschrittener Pfade bedarf teils schwieriger Rücknahme- oder Auflösungsschritte, für die sich keine Mehrheiten finden und die kostenträchtig oder rechtlich nicht leicht zu realisieren wären. Zweitens existieren zumeist gute funktionale Gründe für das Fortbestehen neuer Instrumentarien. Krisen werden häufig nicht gelöst, sondern gehen lediglich in eine latente Phase über. Oft besteht das Risiko, dass sie wiederaufflammen, woraus sich die Notwendigkeit ergibt, Bearbeitungsmechanismen im Sinne einer Resilienzpolitik vorzuhalten. Drittens akzeptieren Mitgliedstaaten, die ansonsten prinzipiell weitere Vergemeinschaftlichungen ablehnen, oftmals kurzfristige Nutzengewinne durch neue supranationale Arrangements. Auch viele europaskeptische Regierungen, die das NextGenerationEU-Instrument aufgrund ihrer weltanschaulichen Überzeugungen ablehnen müssten, haben sich nicht gegen eine Konstruktion gesperrt, die als weitreichender »Hamilton-Moment« dargestellt wurde: als gemeinschafts-, ja sogar föderalisierungsfördernder Mechanismus zur politischen Vertiefung durch finanzielle Verschmelzung. Sie konnten nämlich mit finanziellen Transfers rechnen. Und viertens ist das Lager der entschlossenen Gegner von Souveränitätspooling und Supranationalismus unter den Mitgliedstaaten trotz der Zunahme europaskeptischer Strömungen mit dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU schwächer geworden.
Die Mitgliedstaaten werden das Integrationsgeschehen auch künftig entscheidend prägen – als Antrieb und retardierende Faktoren, als Impulsgeber und Korrektive.
Insofern lassen sich zumeist nur vereinzelte Spill-Stop-Versuche von Mitgliedstaaten beobachten, also Schritte, die darauf abzielen, ein weiteres integrationspolitisches »Überschießen« zu verhindern, das durch den Aufbau neuer oder den Ausbau bestehender Sachkooperationen entstehen könnte. Sollten künftig europäische Durchsetzungsmöglichkeiten aufgewertet werden und der Rekurs auf Mehrheitsabstimmungen zunehmen, könnte insbesondere dort, wo es um innenpolitisch relevante Themen oder souveränitätspolitisch besetzte Fragen geht und wo intergouvernementalistisch-nationalstaatlich orientierte Regierungen Verantwortung haben, die Umsetzung von EU-Recht unterlaufen werden.
Schlussfolgerungen aus deutscher Sicht
Die Mitgliedstaaten werden auch künftig in entscheidender Weise Tempo und Richtung, Tiefe und Breite des Integrationsgeschehens prägen. Sie werden als Antrieb und retardierende Faktoren, als Impulsgeber und Korrektive fungieren. Obschon es weiterhin den gemeinsamen Nenner der Verteidigung basaler nationaler Kompetenzbesitzstände gibt, werden die Mitgliedstaaten in der Regel nicht als geschlossener Verband etwa gegen die Kommission oder das Parlament agieren. Angesichts innenpolitisch und weltanschaulich bedingter Divergenzen über die Zukunft der Gemeinschaft ist eher davon auszugehen, dass es immer wieder zu Bündnissen integrationistisch orientierter Mitgliedstaaten mit supranationalen Institutionen gegen die mitgliedstaatlichen Verfechter intergouvernementaler Kooperation kommt. Dabei treten Unterschiede im Rollenverständnis der Kontrollausübung als »Herren der Verträge« zutage: Manche Mitgliedstaaten sehen ihre Rolle darin, gerade auch in kritischen Momenten oder infolge ihrer strategischen bzw. integrationspolitischen Einschätzung Weichenstellungen für eine weitere Amalgamierung von Souveränität vorzunehmen, die es dann gemeinschaftlichen Institutionen ermöglicht, derlei Ermächtigungen inhaltlich zu füllen (oder sogar inkremental weiterzutreiben). Andere sehen sich indes in einer ihnen an sich nicht zugedachten Rolle als »Hüter der Verträge«, indem sie den nach vorne strebenden Institutionen Grenzen vorgeben und »schleichenden« Kompetenzerweiterungen entgegenarbeiten.
Insgesamt legt dies die Schlussfolgerung nahe, dass weder das institutionelle Kräfteverhältnis in der EU sich eindeutig in eine Richtung verschiebt noch die Triebkräfte der Integration als dominant gemeinschafts- oder staatsgetrieben bezeichnet werden können. Diese Entwicklung wurde nicht durch den Lissabon-Vertrag verursacht, aber er hat sie sicherlich begünstigt.20 Zwischen einer (neo-)supranationalistischen und einer (neo-)intergouvernementalistischen Perspektive bedarf es daher eines Ansatzes, der den kooperativen Interdependenzen zwischen Gemeinschaftlichkeit und Etatismus und ihrer stets neuen Ausbalancierung Rechnung trägt.21
Deutschland ist in Anbetracht dieser Gemengelage gefordert, sich in mitgliedstaatliches Handeln aktiv einzubringen, Potentiale zu nutzen, Fronstellungen abzubauen und zwischenstaatliche Kooperation integrationsfreundlich auszugestalten, insbesondere indem diese an Gemeinschaftsorgane angebunden wird. Wenn legitime Eigeninteressen zur Geltung gebracht werden sollen, so sind diese offen zu markieren, um den Vorwurf der Scheinheiligkeit zu entkräften. Im Einzelnen können hierbei folgende Aspekte berücksichtigt werden:
-
Deutschland kann durch die Stärkung seiner bilateralen Beziehungsgeflechte und durch das Engagement in bestehenden und neuen mitgliedstaatlichen Gruppen EU-weite Reformprozesse begleiten, neue Initiativkraft mit Partnern entwickeln, die Einbindung von Mitgliedstaaten und die Bearbeitung variierender Interessenlagen verbessern und in Einzelfällen durch Koalitionen von handlungsbereiten Mitgliedstaaten die Effektivität europäischer Politik unterstützen. Dabei ist stets darauf zu achten, dass derlei Aktivitäten integrationskonform angelegt sind, also nicht zu einem Ausfransen, sondern zur komplementären Stärkung der EU führen.
-
Die deutsch-französischen Beziehungen, so bedeutsam sie nach wie vor sind, müssen auf Dauer ergänzt und neu eingebettet werden. Formate wie das Weimarer Dreieck oder Big Five können die deutsch-französische Kooperation nicht ersetzen, ihr aber zu mehr Akzeptanz und inhaltlicher Breite verhelfen. Angesichts der geopolitischen Herausforderungen der EU, aber auch aufgrund einer neuen, proaktiven Rolle Polens am Ostrand der Gemeinschaft und der Nato sowie mit Blick auf ein beachtliches Potential für Dissonanzen zwischen Deutschland und Frankeich kann speziell das Weimarer Dreieck hilfreich sein, um als Klammer, Initiativforum und Führungstrio zu wirken. Sicherheitspolitische Abstimmung und Klärungen zu inneren Reformnotwendigkeiten und zur EU-Erweiterungspolitik drängen sich als Felder der trilateralen Kooperation geradezu auf.
-
Die Belange kleinerer oder peripherer Mitgliedstaaten sollten durch die Pflege bilateraler Beziehungen, den Kontakt mit minilateralen Verbünden und die Einbindung in Themengruppen, wie etwa »Friends-of«-Koalitionen, offensiv aufgenommen werden. Hierdurch kann die Legitimität der von Deutschland betriebenen Europapolitik befördert und dem oben beschriebenen Trend einer Abkehr vieler kleiner Staaten von der Gemeinschaftsmethode entgegengewirkt werden. Vor allem aber wäre dies ein Ansatz, mit dem verhindert werden könnte, dass sich der Gegensatz zwischen »Groß« und »Klein« zu einer intensivierten Konfliktdimension verhärtet.
Wird sich die EU als Ganzes oder werden sich Teilensembles der EU öfter als bislang auf den Weg von Mehrheitsentscheidungen begeben, so wird das politische System der EU weniger kompromissbasiert und ihr Entscheidungsprozess, zumindest in der Tendenz, stärker majorzdemokratisch ausgestaltet. Ein solches Modell, das die EU als postkonsensuale Gemeinschaft konstruiert, riskiert indes Legitimitätsverluste oder Entfremdungstendenzen. Insbesondere dann, wenn es Mitgliedstaaten gibt, die sich in einer anhaltenden Oppositionssituation oder in einer Lage wiederholter Minorität ohne ausreichende Mitgestaltungschancen sehen, könnten sich im Extremfall Strategien der stillen Umgehung von Mehrheitsvoten ergeben. Um dies zu vermeiden, sind weiterhin Konsenszwänge erforderlich, »[d]enn eine majoritäre europäische Verfassung müsste ja, gerade wenn sie nicht auf eine belastbare kollektive Identität gestützt werden soll, auf jeden Fall auch die generellen demokratietheoretischen Grenzen legitimer Mehrheitsherrschaft respektieren« (Fritz Scharpf).22 Für Deutschland heißt es in beiden Fällen, Inklusions-, Sondierungs- und Akzeptanzfähigkeiten auszuweiten, also proaktiv gerade auch mit Mitgliedstaaten umzugehen, die integrationspolitische Zurückhaltung üben oder in einzelnen Politikfeldern profilierte Interessen haben. Sowohl mit prospektiven Vetoakteuren im Konsenssystem als auch mit Verlierern im Majorzmodell sollten Kommunikationskanäle gepflegt werden.
Schlussfolgerungen: Vom Stand zur Zukunft der europäischen Integration
Die vorliegende Sammelstudie hat die Komplexität der EU-Integration in zentralen Politikfeldern und politischen Projekten ausgeleuchtet. Von der Energiepolitik über die Digitalisierung bis hin zur Erweiterungspolitik ergibt sich ein widersprüchliches Bild aus substanzieller Vertiefung, strukturellen Blockaden, flexibler Kooperation und politischen Spannungen. Es lässt sich kein eindeutiges Narrativ ableiten; dieses variiert je nach Bewertungsrahmen.
Von offizieller Seite wird vielfach betont, dass die EU die schwerwiegenden Krisen der vergangenen fünfzehn Jahre besser als gedacht bewältigt habe. Aus dieser Perspektive sind vor allem zwei Befunde entscheidend: Erstens hat die EU seit dem Brexit keine weiteren Desintegrationsschritte vollzogen. Schwerwiegende Schocks wie die Corona-Pandemie führten letztlich zu einer Bekräftigung der gemeinsamen Institutionen und von wesentlichen Errungenschaften der Integration wie Binnenmarkt und Personenfreizügigkeit. Zweitens wurde diese Resilienz der EU durch pragmatisches und entschiedenes Handeln ermöglicht. Die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten haben zur Krisenbewältigung neue Instrumente und politische Projekte vorangebracht, mit denen der Kompetenzrahmen der EU nach Bedarf flexibel ausgelegt und erweitert wurde. Man denke etwa an die Dynamisierung der EU-Gesundheitspolitik, die Bereitstellung erheblicher neuer Finanzmittel und ‑hilfen oder an die Entwicklung weitreichender Projekte zur Regulierung und Transformation zentraler wirtschafts- und technologischer Felder, die sich nicht unmittelbar aus den EU-Verträgen herauslesen lassen, wie im Bereich der Digital- oder Klimapolitik.
Emotionale oder historische Appelle, die europäische Einigung voranzutreiben, verhallen dagegen unbeachtet. Entscheidender ist der konkrete Mehrwert der Integration. Die Grundstrukturen und zentralen Verfahren der EU werden immer seltener in Zweifel gezogen,1 stattdessen je nach parteipolitischen Präferenzen und nationalen Interessen ausgelegt und genutzt. Fundamental euroskeptische Positionen haben an Bedeutung verloren, nicht zuletzt nach den britischen Schwierigkeiten mit dem Brexit; eher werden sie im Sinne partieller Renationalisierung von Kompetenzen umgedeutet.2 Daraus ist zwar kein neuer »permissiver Konsens« erwachsen, aber eine solide Grundlage für den Fortgang der Integration. Sofern es funktional und strategisch zwingend notwendig sein sollte, kann es wie in der Vergangenheit zu weiteren punktuellen Kompetenzausweitungen kommen. »Failing forward«3 in Krisen ist und bleibt ein hinreichender, wenngleich unübersichtlicher Prozess der Anpassung an konkrete Herausforderungen. Gerade die EU-Politik versteht sich als die Kunst des Möglichen und schwieriger Kompromisse. In diesem Sinne argumentierten beispielsweise dreizehn Mitgliedstaaten, die nach der Konferenz zur Zukunft Europas in einem »Non-paper« neue institutionelle Debatten ablehnten. Aus ihrer Sicht würden grundlegende Diskussionen über die »Finalität« der Integration nur von den eigentlichen Herausforderungen ablenken.4
Gegen diese Lesart kann eine Vielzahl an Einwänden erhoben werden. Die längerfristige Betrachtung zentraler Politikfelder und Projekte der EU wie in dieser Sammelstudie zeigt erheblich Lücken und Ungleichgewichte auf, die in dem primär reaktiven und krisengetriebenen Integrationsprozess bislang nicht überwunden oder korrigiert werden konnten. So einigte sich die Union zwar auf ambitionierte Rechtsetzung zum Green Deal und zur Energiepolitik im Kontext des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die strukturellen Divergenzen in den Energiemixen der Mitgliedstaaten und die geopolitischen wie ökologischen Herausforderungen der europäischen Energiewende haben aber in vielen Belangen weiterhin Bestand. In der Pandemie hat die EU trotz begrenzter Kompetenzen essentielle Güter für die Krisenreaktion organisieren können. Eine europäische Gesundheitsunion im Sinne einer nachhaltigen Verbesserung und Konvergenz der medizinischen Versorgung in allen Mitgliedstaaten wurde jedoch nicht verankert.
Im Rahmen der EU-Sicherheitsunion wurden EU-Agenturen gestärkt, Datenbanken aufgebaut und zahlreiche Rechtsakte zur Kooperation von Sicherheitsbehörden verabschiedet. Bis Ende der aktuellen Legislaturperiode steht außerdem eine umfassende Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems in Aussicht. Ob hiermit ein belastbares und menschenwürdigeres System zum Umgang mit den Themenkomplexen Migration und Asyl geschaffen und die Schengen-Zone nachhaltig stabilisiert werden kann, ist allerdings nach wie vor äußerst zweifelhaft. Beide Themen, der Green Deal und die Migrationspolitik, bleiben unter den Bürgerinnen und Bürgern der EU umstritten, und die EU-Beschlüsse werden längst nicht einheitlich bewertet.
Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie die Verteidigungspolitik (GSVP) der EU verzeichnen seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, etwa mit Blick auf Sanktionen oder neue Rüstungsbeschaffungsmaßnahmen, erhebliche Fortschritte. Die altbekannten strukturellen Hürden, nämlich die Einstimmigkeit und das Fehlen einer gemeinsamen strategischen Kultur, wurden indes nicht überwunden. Die Kakophonie der Reaktionen auf den Angriff der Hamas auf Israel und dessen Gegenreaktion hat erneut verdeutlicht, wie wenig die vertraglichen Grundlagen und institutionellen Strukturen geeignet sind, fundamentale außenpolitische Divergenzen zwischen den EU-Mitgliedstaaten und zwischen verschiedenen EU-Institutionen auszugleichen.
Die Erweiterungspolitik wurde vor dem Hintergrund des verschärften geostrategischen Wettbewerbs neu belebt. Dies erhöht die Notwendigkeit grundlegender Reformen des Beitrittsprozesses und der EU‑Förderpolitik. Dabei geht es sowohl darum, die Annäherung an die EU zu beschleunigen, als auch darum, die Glaubwürdigkeit des Erweiterungsprozesses und der dazugehörigen Transformation der Beitrittskandidaten aufrechtzuerhalten.
Eine längerfristige Analyse der Eurozone und der europäischen Wirtschaftspolitik lässt erkennen, dass die Krisen zu Beginn der 2010er Jahre in vielerlei Hinsicht nachwirken. Trotz des ausgebauten Instrumentenkastens für die fiskalische und wirtschaftspolitische Koordination sind umfassendere Reformen erforderlich, insbesondere mit Blick auf Wettbewerbsfähigkeit und Risikoteilung. Die Debatte um eine zunehmend sicherheitspolitisch überformte Wirtschaftspolitik und um angemessene Strategien für europäische Versorgungssicherheit wird in den kommenden Jahren noch an Schärfe gewinnen.
Das bestehende institutionelle Gefüge der EU ist demnach in vielen Bereichen weiterzuentwickeln. Einerseits gilt es, die in den letzten zehn Jahren erfolgten krisengetriebenen Anpassungen der EU-Entscheidungsprozesse und Steuerungsinstrumente in die vertragsrechtliche Ordnung von 2009 zu integrieren. Andererseits steht die Handlungsfähigkeit der EU angesichts fortschreitender politischer Fragmentierung sowie möglicher neuer Mitgliedstaaten langfristig auf dem Spiel. Die jeweils nur themen- und krisenspezifische Bereitschaft der Mitgliedstaaten für neue Handlungsinstrumente und Solidarleistungen im Rahmen der EU bietet dafür kein belastbares Modell, das sich einfach fortschreiben ließe. Die potentielle Erweiterung auf dreißig oder mehr Mitglieder verlangt der EU vielmehr eine Neubewertung der Frage ab, welche Reformen notwendig sind, um die eigene Handlungsfähigkeit nicht nur zu erhalten, sondern auch auszubauen.
Analytische Ergebnisse im Querschnitt
Aus wissenschaftlicher Perspektive lässt sich das vielschichtige Bild zum Stand der Integration, das sich aus den Beiträgen zu dieser Studie ergibt, weiter aufschlüsseln. Die in der englischsprachigen Literatur klassische Unterscheidung in politics, policy und polity ist für eine analytische Einordnung hilfreich. Unter »Politics« versteht man die politischen Dynamiken und Muster eines Gemeinwesens, zum Beispiel Parteien- und Konfliktlinien, »Policy« fokussiert sich auf Entwicklungen und Ergebnisse in inhaltlich ausdifferenzierten Politikfeldern und »Polity« schließlich auf die langfristige Veränderung von Institutionen und politischen Strukturen.
Politics: wachsende politische Responsivität und anhaltende Konsensnorm
Die Beiträge dieses Sammelbands liefern weitere Belege dafür, dass die EU trotz regelmäßiger Krisen und einer damit verbundenen Zunahme an Politisierung insgesamt nicht in ein »post-funktionalistisches« Muster verfallen ist.5 Gemäß dieser Theorie oder Denkschule würden identitätszentrierte und symbolische Konflikte immer weiter aufgeladen und das politische System der EU weitgehend lahmlegen. Demnach könnte die EU als politisches System die breitere politische Mobilisierung der Wählerschaft kaum konstruktiv handhaben. Die Lösung funktioneller Probleme träte gegenüber der Betonung nationaler oder sonstiger kultureller Unterschiede immer weiter in den Hintergrund.
Tatsächlich zeigt sich in dem Untersuchungszeitraum seit dem Vertrag von Lissabon und in den Einzelbeiträgen dieser Studie eine deutliche Korrelation der EU-Agenda mit der öffentlichen Wahrnehmung der Bürger, die meist durch Krisen und inhaltliche Herausforderungen bestimmt wird. Diese bereits vorher konstatierte Verschiebung von öffentlichem Desinteresse hin zu einer regelmäßig ausgeprägten Politisierung der EU kann zwar nicht direkt mit einer »Demokratisierung« der Integration gleichgesetzt werden.6 Starke transnationale Parteien stehen nach wie vor aus, und die Rückbindung der EU-Institutionen an demokratische Wahlen erfolgt nur indirekt. Unterschiedliche Positionen von Mitgliedstaaten und Parteien zu zahlreichen europapolitischen Themen kommen aber jenseits einer allgemeinen pro-europäischen oder europaskeptischen Positionierung immer deutlicher und differenzierter zum Ausdruck.7
Diese breitere Politisierung der EU-Politik hat sich bisher als beherrschbar erwiesen. Im Querschnitt der quantitativen Erhebungen, die im Rahmen mehrerer Einzelbeiträge dieser Sammelstudie diskutiert wurden, hat die Anzahl an verbindlichen Entscheidungen und abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahren von Legislaturperiode zu Legislaturperiode leicht abgenommen, während die hohe Anzahl an Konsensentscheidungen weitgehend stabil geblieben ist. Dass einzelne Mitgliedstaaten regelmäßig überstimmt würden, zeigt sich in dieser Gesamtschau nicht, insbesondere nach Vollzug des Brexits. Die These von dauerhaften und weitreichenden Konfliktlinien bzw. klar umrissenen Lagern für oder gegen eine Vertiefung der europäischen Integration steht empirisch auch dann auf wackligen Füßen, wenn man nach geographischen Gruppen sucht. Nord- oder südeuropäische bzw. west- oder osteuropäische Mitgliedstaaten vertreten zwar wiederholt je nach Themenfeld unterschiedliche Interessen, es ergeben sich aber auch regelmäßig neue Koalitionen oder Interessendivergenzen innerhalb dieser mutmaßlichen Lager sowie quer dazu. Ungarn unter Viktor Orbán bewegt sich allerdings in Richtung eines Sonderfalls.
Die relative Kontinuität in der EU-Gesetzgebungsaktivität und die anhaltend hohe Zahl von Konsensentscheidungen lassen sich jedoch auch kritisch sehen. Bereits seit dem Vertrag von Maastricht wird die EU von einigen wissenschaftlichen Kommentatoren als teilweise dysfunktionales politisches System dargestellt, das eine immer weiter verzweigte »Politikverflechtungsfalle« aufbaue.8 Demnach würden auf nationaler Ebene Handlungsoptionen (aufgrund rechtlicher wie funktionaler Zwänge) entfallen, auf EU-Ebene aber nicht ausgeglichen, da entsprechend weitreichende Maßnahmen aufgrund unzureichender Entscheidungsverfahren kaum oder nicht in gebotenem Maße vereinbart würden. Dies zeige sich beispielsweise in der Wirtschafts- und Währungsunion, bei der die Integration der Geldpolitik nicht durch eine vergleichbar starke europäische Fiskalpolitik ausbalanciert werde. Der formale Konsens in Gesetzgebungsverfahren könnte also den Umstand überdecken, dass es sich vielfach um Vereinbarungen über einen »kleinsten gemeinsamen Nenner« handelt und einige politisch entscheidende Fragestellungen nicht auf die Agenda genommen werden. Die Mitgliedstaaten seien also gefangen in einer primär »negativen«, liberalisierenden, sprich: staatliche Regulierung abbauenden Dynamik und wegen vorherrschender Konsenszwänge zu markanten Änderungen am bestehenden EU-Gefüge unfähig – sei es in Richtung »positiver«, also standardsetzender Integration, etwa in der Sozialpolitik, sei es hin zu einer bewussten Re-Nationalisierung von Kompetenzen, um Handlungsspielräume beispielsweise in Fragen der Grenzsicherung und Asylpolitik zurückzugewinnen.
Diese Kritik bleibt insbesondere dort relevant, wo – wie bei der gemeinsamen Außenpolitik nach dem Vertrag von Lissabon – weiterhin Einstimmigkeit gilt. Die Autor:innen dieser Sammelstudie haben auf weitere Bereiche hingewiesen, in denen die Notwendigkeit zu tiefgreifendem politischem Konsens besteht – oder dieser vertieft werden müsste, um die EU-Politik effektiver zu gestalten und gemeinsame öffentliche Güter zu generieren. Das gilt zum Beispiel für die europäische Wirtschaftspolitik. Mit Blick auf die Europawahlen 2024 und den nächsten institutionellen Zyklus ist jedenfalls mit einem Politisierungsgrad von Europapolitik zu rechnen, der das konsensorientierte EU-System weiter herausfordern wird. Die zentralen Beschlüsse der Union in der vergangenen Legislaturperiode – die Aktivitäten in der Covid-Pandemie einschließlich der Impfstoffbeschaffung, die militärische wie finanzielle Unterstützung der Ukraine, die umfassende Gesetzgebung in der Klimapolitik und das kommende Asyl- und Migrationspaket – berühren sensible Bereiche der nationalen Souveränität oder umfassen hochumstrittene Werturteile. Es steht daher zu erwarten, dass die Mobilisierung für die EU-Wahl und deren Ergebnisse deutlich politischer, polarisierender und potentiell populistischer als bislang ausfallen werden. Umfragen deuten dabei gleichzeitig an, dass der Anteil jener Parteien zunehmen wird, welche die EU-Politik in diesen Bereichen ablehnen, was wiederum die Fragmentierung des EU-Parlaments vorantreiben wird.
Policy: unscharfe Grenzen der Integration in Bereichen der Kernstaatlichkeit
Inhaltlich zeigt sich in der Gesamtschau der verschiedenen Politikfelder zwar, wie erwähnt, kein einheitliches Bild, aber im Durchschnitt ein höheres Maß an Dynamik, als eine strikte Lesart der EU-Kompetenzen nahelegen würde. Krisenentscheidungen seit 2009, die zunächst in improvisierter Form oder jenseits der Verträge getroffen werden, ließen sich vielfach, wenn auch nicht umfassend, in neue verbindliche EU-Rechtsakte, reguläre Verfahren oder nichtverbindliche Governance-Instrumente mit anhaltender Wirkung übersetzen. Beispiele hierfür sind das Europäische Semester, die Mobilisierung neuer finanzieller Ressourcen während Pandemie und Ukraine-Krieg oder die EU-Gesundheitsunion. Unvollständige EU-Politikansätze folgen einer klassischen Verhandlungs- oder Spill-over-Logik und führen zu einer nachholenden Integration. Es gibt aber auch Bereiche, in denen die EU auch ohne eine unmittelbare Krisensituation den Ansatz struktureller Veränderung und Regulierung in den letzten Jahren vorangebracht hat. So könnte etwa mit Bezug auf den Green Deal oder Teile der europäischen Digitalpolitik argumentiert werden.
Seit dem Vertrag von Lissabon ist der Fortgang oder die Blockade der Integration in Bereichen der sogenannten Kernstaatlichkeit von besonderer Bedeutung.9 Dieser Begriff wirft vor allem die Frage auf, ob das klassische (regulative) Modell der Integration, bei der die EU sich vorrangig auf Gesetzgebung verlässt und Umsetzungs- sowie Exekutivkapazitäten bei den Mitgliedstaaten verbleiben, gegenüber einem Ausbau von zentralen fiskalischen, administrativen und womöglich auch hoheitlichen Kapazitäten auf EU-Ebene zurücktritt.
Eine wachsende Rolle der Kernstaatlichkeit zeigt sich beispielsweise in der EU-Außen- und Sicherheitspolitik seit dem Ukraine-Krieg oder eben der Mobilisierung neuer Ressourcen in und nach der Corona-Pandemie. Aktuell setzt sich diese Diskussion mit Blick auf den geopolitischen Wettbewerb und die breite Versorgungslage der europäischen Wirtschaft fort.10 Bei der Bewertung dieser Integrationsschritte ist derzeit noch umstritten, ob etwa eine grundlegende Wende in Richtung gemeinsamer Verschuldung stattgefunden hat oder nur zeitlich sowie auf den spezifischen Notfall der Pandemie begrenzte Eigen- und Zwangsmittel auf EU-Ebene geschaffen wurden.11 Weder die öffentliche Meinung noch die Positionen der Mitgliedstaaten lassen sich eindeutig in pro-europäische und europa-skeptische Lager sortieren, nimmt man die Auswirkung verschiedener Politikfelder auf ein allgemeines Konzept der Kernstaatlichkeit zum Maßstab.12
Deshalb kann es zielführender sein, anstelle einer binären Unterscheidung zwischen »normalen« und »kernstaatlichen« Bereichen der Integration auf klassische Politikfeld-Typen zurückzugreifen, wie sie auch für Nationalstaaten gelten. Dann geht es eher um regulative, distributive, redistributive und konstitutive (bzw. konstitutionelle) Themenfelder.13 Aus dieser Perspektive ist es kaum überraschend, wenn auf nationaler wie europäischer Ebene redistributive (und konstitutive) Themen dauerhaft besonders politisiert sind, unabhängig von der letztlichen Finalität der Integration.
Grundsätzlich ist es notwendig, für die Zunahme an Ressourcen und exekutiven Instrumenten der EU, sei es im Grenzschutz oder bei der Schuldenaufnahme, einen rechtlich und demokratisch tragfähigen Unterbau zu schaffen.14 Darum wird gerungen. Die Corona-Hilfen bleiben bisher eine einmalige Ausnahme; gleichwohl haben sie – zusammen mit den erforderlichen Unterstützungsleistungen für die Ukraine – die Perspektive auf weitere, krisenbedingte Sondervermögen und ‑fonds sowie auf eine deutliche Flexibilisierung der Verwendung von EU-Mitteln eröffnet. Die Notwendigkeit einer grundlegenden Debatte über die Zukunft der EU-Finanzmittel wird durch die perspektivisch hinzukommenden finanziellen Bedarfe einer EU-Erweiterung in den 2030er Jahren noch unterstrichen.
Polity: Exekutiv-Dominanz in den Krisen
Die Möglichkeiten und Grenzen der Integration in einzelnen Politikbereichen sind für die EU immer mit konstitutionellen Fragen verbunden, also ihrer »Polity«. In Hinblick auf das Verhältnis zwischen den verschiedenen EU-Institutionen ist im Querschnitt der Politikfelder eine Schwerpunktverlagerung auf die Exekutive zu verzeichnen – auch wenn eine genuin politische europäische Exekutive nur kollektiv im Europäischen Rat in Erscheinung tritt.15 Die Kontrolle neuer Instrumente der EU-Krisengovernance muss durch parlamentarische, administrative oder justizielle Institutionen mit Nachdruck verfolgt werden. Das Europäische Parlament konnte angesichts der internen Fragmentierung sowie des hohen Krisendrucks in den vergangenen Jahren kaum gegensteuern.16 Nur in längerfristigen Gesetzgebungsprozessen gelang es den Abgeordneten, eigene Akzente gegenüber der Exekutive zu setzen. Ebenso ist zu überprüfen, inwiefern eine politisierte Kommission ihre Rolle als Hüterin der Verträge erfüllt. In der Gesamtschau verschiedener Politikfelder tritt sie primär als Taktgeberin der Integration oder Partnerin der Mitgliedstaaten bei der Krisengovernance auf. Ihre Rolle bei der Überwachung dessen, wie EU-Recht umgesetzt wird, ist dagegen in den Hintergrund gerückt und verliert gegenüber den Mitgliedstaaten zunehmend an Glaubwürdigkeit.17
Die faktisch vollzogenen krisenbedingten Integrationsschritte seit 2009 und die veränderte geostrategische Lage werfen die Frage der Vertragsrevision und damit auch der institutionellen Beziehungen neu auf.18 Die Konferenz zur Zukunft Europas sollte ursprünglich substanzielle Reformvorschläge generieren und so die demokratische Beteiligung an den damit verbundenen Reformprozessen erweitern und deren Legitimitätsgrad erhöhen. Die politische Rezeption des Abschlussberichts blieb jedoch verhalten. Überschattet von interinstitutionellen Konflikten, sind die größeren institutionellen Vorhaben der Zukunftskonferenz nur vom Europäischen Parlament aufgegriffen worden, während die meisten Mitgliedstaaten schon deren Diskussion ablehnten. Die Kommission fokussierte sich hingegen nur auf Policy-Vorschläge der Konferenz, die ohne erkennbare strategische Kursänderungen in das reguläre Arbeitsprogramm aufgenommen wurden.19
Die Neubelebung des Erweiterungsprozesses der EU im Zuge des Ukraine-Kriegs und der geostrategischen Verschiebungen in Europa erzeugt einen womöglich gewichtigeren Antrieb für Vertragsrevisionen. Die im politischen Diskurs dominante Sichtweise lautet, dass eine Erweiterung der EU um die Ukraine, Moldau, um weitere Staaten des Westbalkans sowie potentiell Georgien Veränderungen in Abstimmungsverfahren, der Ausstattung der Union mit finanziellen Mitteln und bei deren Verteilung verlangt.20 Ergänzt werden soll dieser Reformprozess durch neue Verfahren und Abstufungen im Beitrittsprozess. In Fragen der konkreten Ausgestaltung – also ob Vertragsänderungen notwendig sind, Mehrheitsentscheidungen ausgeweitet werden sollen oder wie vorbereitende Beitrittsschritte im Detail aussehen könnten – sind die Mitgliedstaaten jedoch weit von einem Konsens entfernt.
Derzeit können bestenfalls einige Optionen eingegrenzt oder ausgeschlossen werden. Eine dauerhafte Differenzierung der Mitgliedschaft oder der Politikbereiche ist nicht anzuraten und steht dem Trend der vergangenen Jahre entgegen.21 Abgesehen von der relativ stabilen Trennung in Staaten der Eurozone und andere EU-Mitglieder ist eine deutliche Entwicklung hin zu mehr Einheitlichkeit des europäischen Gemeinwesens festzustellen. Im Juni 2022 beendete Dänemark sein Opt-out aus der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. In der Außen- und Sicherheitspolitik wird Flexibilisierung weiter in der operativen Umsetzung genutzt, etwa in Form von Sonderregeln bei Sanktionen, Projekten im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) oder durch Nutzung der »konstruktiven Enthaltung« bei Militärhilfen für die Ukraine. Auf strategischer Ebene ist aber der Anspruch wichtiger denn je, gemeinsam als EU-27 zu agieren.
Schließlich ist mehr als deutlich geworden, dass die Sicherung der Rechtsstaatlichkeit eine konstitutionelle Bedeutung für die gesamte EU erlangt hat. Weit über themen- oder länderspezifische Dispute hinaus, etwa über den Umgang mit Ungarn, hat sich eine grundsätzliche Debatte über den Vorrang des EU-Rechts entwickelt.22 Es geht also nicht nur um Sanktionsmittel gegenüber einzelnen Mitgliedstaaten, sondern auch darum, ob die finale Entscheidungskompetenz der europäischen Rechtsordnung deutlicher als bisher legitimiert werden muss. Die Konfrontation zwischen nationalen Verfassungsgerichten und dem Europäischen Gerichtshof wurde nur vordergründig beendet. Es gibt gute Argumente für grundlegende Reformen, etwa die Einrichtung einer zusätzlichen gemischten Kammer des EuGH, die nationale Verfassungsrichter einschließt und über Kompetenzkonflikte entscheiden könnte.23 Gleichzeitig beeinträchtigen Defizite der Rechtsstaatlichkeit die Handlungsfähigkeit der EU in zunehmenden Maße, wenn verbindlich getroffene Entscheidungen nicht umgesetzt werden oder nationale Regierungen aufgrund von Differenzen über dieses Thema alle verfügbaren Veto-Punkte in Brüssel ausreizen. Die in Polen mit dem Amtsantritt von Donald Tusk angestoßenen Reformen zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Justiz und Freiheit der Medien geben zwar Anlass zur Hoffnung, sind aber für sich genommen nicht ausreichend, um die Rechtsstaatlichkeitskrise in der gesamten EU aufzulösen.
Die Aussicht auf eine fortschreitende EU-Erweiterung verschärft die Notwendigkeit, die primärrechtlichen Verpflichtungen, die jeder Mitgliedstaat eingeht, weiter zu explizieren. Eine klare Linie zur gemeinsamen Rechtsordnung kann nur dann konsequent aufgezeigt werden, wenn die liberale Verankerung der EU nicht in Zweifel gezogen werden darf und sich kein Mitgliedstaat von den eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen lossagt. Die EU muss als Garantin der Grundrechte aller ihrer Bürger:innen gelten, notfalls gegenüber Mehrheiten auf nationaler Ebene. Zusätzlich sollte die EU das vertraglich festgelegte Ziel ihres Beitritts zur Europäischen Menschenrechtskonvention weiterverfolgen.24
In Krisen der vergangenen Jahre hat sich die EU als resilient und flexibel erwiesen, mit der Exekutiv-Dominanz aber auch ein »neues demokratisches Defizit« entwickelt. Insbesondere dann, wenn die EU mehr politische Verantwortung für öffentliche Güter übernimmt, neben Regulierung vermehrt distributive Politiken beschließt und in Bereiche der Kernstaatlichkeit hineinreicht, wachsen die Anforderungen an ihre demokratische Legitimation. EU-Reformdebatten sollten sich daher nicht ausschließlich auf geopolitische Handlungsfähigkeit und Erweiterung konzentrieren, sondern ebenso darauf zielen, die demokratische Anbindung und Partizipationsmöglichkeiten ihrer Bürger:innen auszubauen.25
Ausblick: Vier strukturelle Herausforderungen für die EU in der kommenden Legislaturperiode
Die kommende Legislaturperiode bis 2029 wird voraussichtlich durch vier strukturelle Herausforderungen geprägt werden, die über den derzeitigen Stand der Integration hinausweisen. Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs und die zunehmend militärisch ausgetragenen Konflikte in der europäischen Nachbarschaft (Armenien–Aserbaidschan, Israel–Hamas, militärische Drohungen zwischen Serbien und Kosovo) unterstreichen die Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit mit der Nato, des Wiederaufbaus militärischer Kapazitäten der EU/Nato-Staaten und einer Neuausrichtung der europäischen Sicherheitsordnung. Dabei muss die EU ihre Unterstützung für die Ukraine sowohl in Bezug auf Wiederaufbauhilfen als auch auf militärische Lieferungen bekräftigen. Die GSVP und die EU-Sicherheitspolitik können aller Voraussicht nach in den bestehenden Verfahren und Strukturen nicht ausreichend gestärkt werden. Zusätzlich zur Frage der Mehrheitsentscheidungen geht es unter anderem um eine neue und tragfähige Verankerung der rüstungspolitischen Kooperation, einschließlich der Exportpolitik, um die effektive Durchsetzung und strategisch sinnvolle Nutzung von Sanktionen und um die Notwendigkeit einer engeren Kooperation bei der nachrichtendienstlichen Unterstützung der EU-Politik. Alle derartigen Schritte werden angesichts der potentiellen Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, mindestens aber eines zunehmend isolationistischen US-Kongresses immer dringlicher.
Zweitens bedarf die Erweiterung und Reform der EU aufgrund überaus unsicherer Perspektiven eines außergewöhnlich großen wie ausdauernden Einsatzes von politischem Kapital. Den Beitrittskandidaten muss eine glaubwürdige Perspektive geboten werden, um sie zu Reformen zu motivieren und ein geopolitisches Abdriften in den Einflusskreis Russlands zu verhindern. Die EU ist gefordert, nicht nur wichtige Sachfragen zu klären, insbesondere die Neuordnung der Agrar- und Strukturhilfen, sondern vor allem daran zu arbeiten, die Bedeutung und Dauerhaftigkeit der Erweiterungspolitik strategisch zu verankern. Die aktuellen politischen Treiber, insbesondere der Angriffskrieg gegen die Ukraine, werden allein nicht ausreichen, um den Konsens für die Dauer des Erweiterungs- und Reformprozesses von wohl mindestens einer Dekade aufrechtzuerhalten.
Drittens ist die Handlungsfähigkeit der EU jenseits der Erweiterungsfrage zu unterfüttern. Bisherige Krisenmechanismen, Finanzkapazitäten und formelle EU-Entscheidungsregeln sind neu zu ordnen und auszubauen. Konkret geht es um Themen wie Wirtschaftspolitik, Asyl- und Migrationspolitik sowie sicherheitspolitische Fragen. Gemeinsame Transformationsaufgaben stehen hier zunehmend fragmentierten politischen Systemen gegenüber – sowohl auf EU-Ebene in Rat und Europäischem Parlament als auch auf nationaler Ebene nehmen die politischen Widerstände gegen die EU-Klimapolitik, die Migrationspolitik und die wirtschaftspolitische Grundausrichtung der EU zu. Es gilt deshalb, neue Anstrengungen für politischen Zusammenhalt zu unternehmen.
Viertens bleibt die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit eine Daueraufgabe von strategischer Bedeutung. Finanzielle wie politische Sanktionen sollten seitens der EU ausgesprochen und aufrechterhalten werden, solange strukturelle Einschränkungen der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit der Justiz wie im Falle Ungarns bestehen bleiben. Die EU selbst sollte außerdem selbstkritischer auf die eigenen rechtsstaatlichen Grundlagen achten – selbst wenn dies zur Folge hätte, dass ihre Handlungsfähigkeit in Krisen beschnitten wird und vereinzelt Handlungen der Institutionen oder EU-Agenturen zurückgenommen werden müssen, etwa in der Asyl- und Grenzsicherungspolitik oder bei der Aufnahme von Schulden.
Insgesamt betrachtet befindet sich die EU als politisches Gemeinwesen womöglich in einer längeren, kritischen Übergangsphase. Eine »EU-Verfassung« bleibt politisch sensibel und demokratisch schwer zu legitimieren. Die Mitgliedstaaten sind nach wie vor die »Herren der Verträge«, was auch die Möglichkeit des Austritts einschließt, wie es im Falle Großbritanniens mit aller Konsequenz durchexerziert wurde. Allerdings ist der Wunsch, der EU-Integration klare und letztgültige Befugnisgrenzen zu setzen, immer weniger haltbar. Zahlreiche Krisen- und Notfallentscheidungen, die kollektiv im Europäischen Rat und mit weiteren EU-Institutionen getroffen wurden, deuten letztlich auf eine »Kompetenz-Kompetenz« auch jenseits formeller Vertragsänderungen hin. Zugespitzt könnte also argumentiert werden, dass sich die EU in einem ständigen Prozess der konstitutionellen Neuordnung befindet, selbst wenn dieser weniger formalisiert und offen stattfindet als in einem Konvent.
Die zunehmende Exekutivlastigkeit der EU seit dem Vertrag von Lissabon sollte vor diesem Hintergrund nachdrücklich hinterfragt werden. Es bedarf einer Rückkehr zu Gemeinschaftsinstrumenten mit Beteiligung des Europäischen Parlaments. Wie sich die Bürger:innen darüber hinaus, auch mit kreativen Instrumenten, in die Entscheidungsfindung in der EU einbinden lassen, sollte trotz des Fehlschlags Zukunftskonferenz künftig weiter ausgelotet werden.
Anhang
Abkürzungen
|
AEUV |
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
|
AI |
Artificial Intelligence (siehe KI) |
|
ALDE |
Alliance of Liberals and Democrats for Europe (Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa) |
|
ARF |
Aufbau- und Resilienzfazilität |
|
CARD |
Coordinated Annual Review on Defence |
|
CBAM |
Carbon Border Adjustment Mechanism (CO2-Grenzausgleichssystem) |
|
CEP |
Centra za evropske politike/European Policy Centre (Belgrad) |
|
CEPA |
Center for European Policy Analysis (Washington, D.C.) |
|
CEPS |
Centre for European Policy Studies (Brüssel) |
|
CER |
Critical Entities Resilience |
|
CFSP |
Common Foreign and Security Policy |
|
CSR |
Country Specific Recommendations (Länderspezifische Empfehlungen) |
|
DCI |
Development Cooperation Instrument (Instrument der Entwicklungszusammenarbeit) |
|
DEFIS |
Directorate-General for Defence Industry and Space |
|
DGAP |
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (Berlin) |
|
DMA |
Digital Markets Act (EU) |
|
DSA |
Digital Services Act (EU) |
|
DSGVO |
Datenschutzgrundverordnung |
|
EAD |
Europäischer Auswärtiger Dienst |
|
ECDC |
European Centre for Disease Prevention and Control (Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten) |
|
ECOFIN |
Economic and Financial Affairs Council (Rat Wirtschaft und Finanzen) |
|
EDA |
European Defense Agency (Europäische Verteidigungsagentur) |
|
EDIRPA |
European defence industry reinforcement through common procurement act |
|
EEF |
Europäischer Entwicklungsfonds |
|
EER |
Erneuerbare-Energien-Richtlinie |
|
EFSF |
European Financial Stability Facility (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität) |
|
EFSM |
European Financial Stabilisation Mechanism (Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus) |
|
EGKS |
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl |
|
EGU |
Europäische Gesundheitsunion |
|
EGV |
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft |
|
EHDS |
European Health Data Space |
|
EHS |
Emissionshandelssystem |
|
EHS II |
Emissionshandelssystem für Emissionen aus dem Straßenverkehr und Gebäuden |
|
EIB |
Europäische Investitionsbank |
|
EIDHR |
European Instrument for Democracy and Human Rights |
|
EIF |
Europäische Investitionsfonds |
|
EK |
Europäische Kommission |
|
EKR |
Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer |
|
EMA |
European Medicines Agency |
|
ENI |
European Neighbourhood Instrument (Europäisches Nachbarschaftsinstrument) |
|
ENISA |
European Union Agency for Cybersecurity (Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit) |
|
EP |
European Parliament |
|
EPF |
European Peace Facility |
|
EPG |
Europäische Politische Gemeinschaft |
|
EPSCO |
Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz) |
|
ESI-Fonds |
Europäische Struktur- und Investitionsfonds |
|
ESM |
Europäischer Stabilitätsmechanismus |
|
ESR |
Effort Sharing Regulation (Lastenverteilungsverordnung) |
|
ESVP |
Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik |
|
ETS |
Emissions Trading System (siehe EHS) |
|
ETS2 |
Emissions Trading System 2 |
|
EU |
Europäische Union |
|
EuGH |
Europäischer Gerichtshof |
|
EUMAM |
EU Military Assistance Mission |
|
EuSta |
Europäische Staatsanwaltschaft |
|
EUV |
Vertrag über die Europäische Union |
|
EVF |
Europäischer Verteidigungsfonds |
|
EVP |
Europäische Volkspartei |
|
EZB |
Europäische Zentralbank |
|
FPI |
Service for Foreign Policy Instruments |
|
Frontex |
European Border and Coast Guard Agency (Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache) |
|
FuE |
Forschung und Entwicklung |
|
GASP |
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik |
|
GEAS |
Gemeinsames Europäisches Asylsystem |
|
GLF |
Greek Loan Facility (Griechische Kreditfazilität) |
|
GSVP |
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik |
|
HERA |
Health Emergency Preparedness and Response Authority (Behörde für die Krisenvorsorge und ‑reaktion bei gesundheitlichen Notlagen) |
|
HV/VP |
Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik/Vizepräsident der Kommission |
|
IcSP |
Instrument contributing to Stability and Peace |
|
ID |
Fraktion Identität und Demokratie |
|
IKT |
Informations- und Kommunikationstechnologien |
|
INSC |
Instrument for Nuclear Safety Cooperation |
|
IPCEI |
Important Projects of Common European Interest |
|
IPA II |
Instrument for Pre-accession Assistance II |
|
KI |
Künstliche Intelligenz |
|
LNG |
Liquefied Natural Gas (Flüssigerdgas) |
|
LSE |
länderspezifische Empfehlungen |
|
LULUCF |
Land Use, Land-Use Change and Forestry (Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft) |
|
MFR |
mehrjähriger Finanzrahmen |
|
Nato |
North Atlantic Treaty Organization |
|
NDICI |
Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (Instrument für Nachbarschaft, Entwicklung und internationale Kooperation) |
|
NGEU |
NextGenerationEU |
|
NRP |
Nationales Reformprogramm |
|
OCTs |
Overseas countries and territories |
|
OMT |
Outright Monetary Transactions |
|
PEPP |
Pandemic Emergency Purchase Programme |
|
PESCO |
Permanent Structured Cooperation (siehe SSZ) |
|
PI |
Partnership instrument for cooperation with third countries |
|
PSPP |
Public Sector Purchase Programme |
|
QE |
Quantitative Easing |
|
QMV |
Qualified Majority Voting |
|
RFSR |
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts |
|
RRF |
Recovery and Resilience Facility |
|
S&D |
Socialist and Democrats |
|
SIS |
Schengener Informationssystem |
|
SMP |
Securities Markets Program |
|
SPV |
Special Purpose Vehicle |
|
SSZ |
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit |
|
STEP |
Strategic Technologies for Europe Platform |
|
SURE |
European instrument for temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency |
|
TPI |
Transmission Protection Instrument |
|
UN |
United Nations (Vereinte Nationen) |
|
UNFCCC |
United Nations Framework Convention on Climate Change (Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen) |
|
USA |
United States of America |
|
VR |
Volksrepublik |
Die Autorinnen und Autoren
Dr. Michael Bayerlein
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. Peter Becker
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. habil. Annegret Bendiek
Senior Fellow in der Forschungsgruppe EU / Europa
Lasse Michael Böhm
Gastautor und Referatsleiter Wirtschaftspolitik, wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS)
Dr. Raphael Bossong
Stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. habil. Markus Kaim
Senior Fellow in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik
Dr. Kai-Olaf Lang
Senior Fellow in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. Nicolai von Ondarza
Leiter der Forschungsgruppe EU / Europa
Dominik Rehbaum
Department für Politik- und Sozialwissenschaften, Europäisches Hochschulinstitut Florenz und ehemaliger Forschungsassistent der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. Felix Schenuit
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe EU / Europa
Isabella Stürzer
Studentische Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. Paweł Tokarski
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. Marina Vulović
Akademische Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Internationale Beziehungen der Universität Potsdam und Gastwissenschaftlerin der Forschungsgruppe EU / Europa
Endnoten
- 1
-
Jean Monnet, Erinnerungen eines Europäers, München 1980, S. 528.
- 2
-
Siehe »European Integration (Theory) in Times of Crisis. A Comparison of the Euro and Schengen Crises«, in: Journal of European Public Policy, 25 (2018) 7, S. 969–989, doi: 10.1080/13501763.2017.1421252.
- 3
-
Erik Jones/R. Daniel Kelemen/Sophie Meunier, »Failing Forward? Crises and Patterns of European Integration«, in: Journal of European Public Policy, 28 (2021) 10, S. 1519–1536, doi: 10.1080/13501763.2021.1954068; Shawn Donnelly, »Failing outward: Power Politics, Regime Complexity, and Failing Forward under Deadlock«, in: Journal of European Public Policy, 28 (2021) 10, S. 1573–1591, doi: 10.1080/13501763. 2021.1954062.
- 4
-
R. Daniel Kelemen/Kathleen R. McNamara, »State-Building and the European Union: Markets, War, and Europe’s Uneven Political Development«, in: Comparative Political Studies, 55 (2022) 6, S. 963–991, doi: 10.1177/001041402 11047393.
- 5
-
Iskander De Bruycker, »Democratically Deficient, Yet Responsive? How Politicization Facilitates Responsiveness in the European Union«, in: Journal of European Public Policy, 27 (2020) 6, S. 834–852, doi: 10.1080/13501763.2019.1622587; Sara B. Hobolt/Christopher Wratil, »Contestation and Responsiveness in EU Council Deliberations«, in: Journal of European Public Policy, 27 (2020) 3, S. 362–381, doi: 10.1080/13501763.2020.1712454.
- 6
-
Bei Abstimmungen in der UN-Generalversammlung zur Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe in Gaza etwa votierten die 27 EU-Staaten nicht geschlossen, sondern mit Ja, Nein oder Enthaltung. Siehe Vereinte Nationen, »UN General Assembly Votes by Large Majority for Immediate Humanitarian Ceasefire during Emergency Session«, 12.12.2023, <https://news.un.org/en/story/2023/12/1144717> (eingesehen am 8.1.2024).
- 7
-
Cas Mudde, »The 2019 EU Elections: Moving the Center«, in: Journal of Democracy, 30 (2019) 4, S. 20–34, <https://muse. jhu.edu/article/735456> (eingesehen am 24.10.2023).
- 8
-
Nicolai von Ondarza/Minna Ålander, Von der Zukunftskonferenz zur Reform der EU, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Juli 2022 (SWP-Aktuell 44/2022), doi: 10.18449/ 2022A44.
- 9
-
Europäisches Parlament, Report on Proposals of the European Parliament for the Amendment of the Treaties (2022/2051(INL)), 7.11.2023, <https://www.europarl.europa.eu/doceo/docu ment/A-9-2023-0337_EN.html> (eingesehen am 8.1.2024).
- 10
-
Non-paper by Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Slovenia, and Sweden on the Outcome of and Follow-up to the Conference on the Future of Europe, 9.5.2022, <https://www.movimentoeuropeo.it/images/Documenti/Non_-paper_9.5.2022.pdf> (eingesehen am 24.10.2023).
- 11
-
Jonathan White, »Constitutionalizing the EU in an Age of Emergencies«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 61 (2022) 3, S. 781–796, doi: 10.1111/jcms.13415.
- 12
-
Die Bundesregierung, »Rede von Bundeskanzler Scholz an der Karls-Universität am 29. August 2022 in Prag«, Prag, 29.8.2022, <https://www.bundesregierung.de/breg-de/ aktuelles/rede-von-bundeskanzler-scholz-an-der-karls-universitaet-am-29-august-2022-in-prag-2079534> (eingesehen am 14.8.2023).
- 13
-
Europäischer Rat, »Tagung des Europäischen Rates (14. und 15. Dezember 2023) – Schlussfolgerungen«, 15.12.2023, <https://www.consilium.europa.eu/media/68982/ europeancouncilconclusions-14-15-12-2023-de.pdf> (eingesehen am 8.1.2023).
- 14
-
Olivier Costa u. a., Unterwegs auf hoher See: Die EU für das 21. Jahrhundert reformieren und erweitern, Berlin/Paris, September 2023, <https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2627316/ 386102116ff34689169fb8df7ef63ec5/230919-deu-fra-bericht-data.pdf> (eingesehen am 24.10.2023).
- 15
-
Luuk van Middelaar, Das europäische Pandämonium: Was die Pandemie über den Zustand der EU enthüllt, Berlin 2021.
- 16
-
Europäischer Rat, »Eine neue Strategische Agenda 2019–2024«, Pressemitteilung, 20.6.2019, <https://www. consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/> (eingesehen am 14.8.2023).
- 17
-
Die Prioritäten der Europäischen Kommission 2019–2024, o. D., <https://germany.representation.ec.europa.eu/strategie-und-prioritaten/die-prioritaten-der-europaischen-kommission-2019-2024_de> (eingesehen am 14.8.2023).
- 1
-
Siehe auch den Beitrag von Paweł Tokarski, S. 25ff.
- 2
-
Peter A. Hall/David Soskice (Hg.), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford/ New York 2001; Peter A. Hall, »Varieties of Capitalism and the Euro Crisis«, in: West European Politics, 37 (2014) 6, S. 1223–1243; ders., »The Economics and Politics of the Euro Crisis«, in: German Politics, 21 (2012) 4, S. 355–371.
- 3
-
Europäischer Rat, Erklärung der führenden Vertreter von 27 Mitgliedstaaten und des Europäischen Rates, des Europäischen Parlaments and der Europäischen Kommission. Erklärung von Rom, 25.3.2017.
- 4
-
Ursula von der Leyen, Eine Union, die mehr erreichen will. Meine Agenda für Europa. Politische Leitlinien für die künftige Europäische Kommission 2019–2024, 16.7.2019.
- 5
-
Jean-Claude Juncker, Ein neuer Start für Europa: Meine Agenda für Jobs, Wachstum, Fairness und demokratischen Wandel. Politische Leitlinien für die nächste Europäische Kommission, 15.7.2014.
- 6
-
Rutger Claassen u. a., »Four Models of Protecting Citizenship and Social Rights in Europe: Conclusions to the Special Issue ›Rethinking the European Social Market Economy‹«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 57 (2019) 1, S. 159–174; Florian Rödl, »Europäisches Verfassungsziel ›soziale Marktwirtschaft‹ – kritische Anmerkungen zu einem populären Modell«, in: Integration, 28 (2005) 2, S. 150–161.
- 7
-
Peter Becker, Wirtschaftspolitische Koordinierung in der Europäischen Union. Europäisierung ohne Souveränitätsverlust, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2014 (SWP-Studie 19/2014).
- 8
-
Siehe auch den Beitrag von Paweł Tokarski, S. 25ff.
- 9
-
Viorica Viță, »Revisiting the Dominant Discourse on Conditionality in the EU: The Case of EU Spending Conditionality«, in: Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 19 (2017), S. 116–143 (120).
- 10
-
Europäische Kommission, Langfristige Wettbewerbsfähigkeit der EU: Blick über 2030 hinaus, COM(2023) 168 final, Brüssel, 16.3.2023; Europäische Kommission,, Jahresbericht 2024 über den Binnenmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit, COM(2024) 77 final, Brüssel, 14.2.2024.
- 11
-
Europäischer Rat 2020, Außerordentliche Tagung des Europäischen Rates (17., 18., 19., 20. und 21. Juli 2020) – Schlussfolgerungen, EUCO 10/20.
- 12
-
Diesen Ausdruck benutzte der damalige Bundesfinanzminister Olaf Scholz in einem Interview, in Anspielung auf den ersten US-Finanzminister Alexander Hamilton, der 1790 finanzpolitisch die Entwicklung des Staatenbundes zum Bundesstaat vorangetrieben hatte. Peter Dausend/Mark Schieritz, »›Jemand muss vorangehen‹«, in: Die Zeit, 20.5.2020.
- 13
-
Rat der EU, Gutachten des Juristischen Dienstes, Dok. 9062/20, 24.6.2020, Ziffer 7.
- 14
-
Bundesverfassungsgericht, Urteil des Zweiten Senats vom 6. Dezember 2022, 2 BvR 547/21, 2 BvR 798/21.
- 15
-
Siehe auch den Beitrag von Felix Schenuit, S. 43ff.
- 16
-
Siehe Europäische Kommission, Cohesion 2021–2027: Forging an Ever-stronger Union. Report on the Outcome of 2021–2027 Cohesion Policy Programming, SWD (2023) 134 final, Teil 1 und 2, Brüssel, 28.4.2023.
- 17
-
Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Ökosystems der Fertigung von Netto-Null-Technologieprodukten (Netto-Null-Industrie-Verordnung), COM(2023) 161 final, Brüssel 16.3.2023.
- 18
-
Europäische Kommission, »Kriterien für die Würdigung der Vereinbarkeit von staatlichen Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse mit dem Binnenmarkt«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (30.12.2021) C 528, S. 10–18.
- 19
-
Siehe <https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/strategic-technologies-europe-platform_en> (eingesehen am 5.3.2024).
- 20
-
Europäische Kommission und Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Europäische Strategie für wirtschaftliche Sicherheit, JOIN(2023) 20 final, Brüssel, 20.6.2023.
- 21
-
Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems (Chip-Gesetz), COM(2022) 46 final, Brüssel, 8.2.2022; Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für Künstliche Intelligenz (Gesetz über Künstliche Intelligenz) und zur Änderung bestimmter Rechtsakte der Union, COM(2021) 206 final, Brüssel, 21.4.2021; Europäische Kommission, »Verordnung über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31 EG (Gesetz über digitale Dienste)«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (27.10.2022) L 277, S. 1–102.
- 1
-
Europäische Zentralbank (EZB), The International Role of the Euro, Frankfurt a. M., Juni 2023; Paweł Tokarski, Der Euro angesichts der Dollar-Dominanz. Zwischen strategischer Autonomie und struktureller Schwäche, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Oktober 2023 (SWP-Studie 11/2023), doi: 10.18449/ 2023S11.
- 2
-
Richard A. Musgrave/Peggy B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, Tokio 1973, S. 607f.
- 3
-
EZB, »Decision of the European Central Bank of 14 May 2010 Establishing a Securities Markets Programme (ECB/2010/5)«, in: Official Journal of the European Union, (20.5.2010) L 124, S. 8f.
- 4
-
EZB, »Decision of the European Central Bank of 29 July 2014 on Measures Relating to Targeted Longer-term Refinancing Operations (ECB/2014/34)«, in: Official Journal of the European Union, (29.8.2014) L 258, S. 11–29.
- 5
-
EZB, »Decision (EU) 2015/774 of the European Central Bank of 4 March 2015 on a Secondary Markets Public Sector Asset Purchase Programme (ECB/2015/10)«, in: Official Journal of the European Union, (14.5.2015) L 121, S. 20–24.
- 6
-
EZB, »Decision (EU) 2020/440 of the European Central Bank of 24 March 2020 on a Temporary Pandemic Emergency Purchase Programme (ECB/2020/17)«, in: Official Journal of the European Union, (25.3.2020) L 91, S. 1–4.
- 7
-
EZB, »The Transmission Protection Instrument«, Pressemitteilung, 21.7.2022.
- 8
-
Siehe z. B. Neil Irwin, Die Alchemisten. Die geheime Welt der Zentralbanker, Berlin 2013; Dermot Hodson, Governing the Euro Area in Good Times and Bad, Oxford u. a. 2011.
- 9
-
Siehe z. B. Thomas Lehner/Fabio Wasserfallen, »Political Conflict in the Reform of the Eurozone«, in: European Union Politics, 20 (2019) 1, S. 45–64; Jeffry Frieden/Stefanie Walter, »Understanding the Political Economy of the Eurozone Crisis«, in: Annual Review of Political Science, 20 (Mai 2017), S. 371–390.
- 10
-
Paweł Tokarski, Die Europäische Zentralbank als politischer Akteur in der Eurokrise. Mandat, Stellung und Handeln der EZB in einer unvollständigen Währungsunion, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Juli 2016 (SWP-Studie 14/2016).
- 11
-
Paweł Tokarski, »The European Parliament’s Assessment of the Troika: Good Points, Bad Timing«, in: Bulletin PISM, (28.3.2014) 45.
- 12
-
Siehe z. B. C-62/14 – Gauweiler and Others, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 16 June 2015.
- 13
-
Die Art und Weise der Risikoteilung in der Bankenunion ist jedoch schwer zu quantifizieren und zu bewerten, da die Bankenunion noch unvollständig ist. Es fehlt z. B. ein einheitliches Einlagensicherungssystem, und bei der Umstrukturierung von Banken kommt bisher ausschließlich nationales Recht zur Anwendung. Aus diesem Grund und um den Text nicht ausufern zu lassen, wird hier auf weitere Ausführungen zum Thema verzichtet.
- 14
-
Siehe EZB, Capital Subscription, <https://www.ecb. europa.eu/ecb/orga/capital/html/index.en.html> (eingesehen am 5.10.2023).
- 15
-
ESM, What Is the ESM’s Lending Capacity?, <https://www. esm.europa.eu/content/what-esm%E2%80%99s-lending-capacity> (eingesehen am 6.10.2023).
- 16
-
Der Europäische Rat verabschiedete den Beschluss 2011/199/EU zur Änderung von Artikel 136 AEUV in Bezug auf einen Stabilitätsmechanismus für Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, und fügte den folgenden Absatz (3) hinzu: »Die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, können einen Stabilitätsmechanismus einrichten, der aktiviert wird, wenn dies unabdingbar ist, um die Stabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt zu wahren. Die Gewährung aller erforderlichen Finanzhilfen im Rahmen des Mechanismus wird strengen Auflagen unterliegen.« Europäischer Rat, »Beschluss des Europäischen Rates vom 25. März 2011 zur Änderung des Artikels 136 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union hinsichtlich eines Stabilitätsmechanismus für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (2011/199/EU)«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (6.4.2011) L 91, S. 1–2 (2).
- 17
-
Europäische Kommission, Proposal for a Council Regulation on the Establishment of the European Monetary Fund, COM (2017) 827, 6.12.2017.
- 18
-
Jim Brunsden/Mehreen Khan, »Hawkish European Capitals Lobby to Beef up Eurozone Bailout Fund«, in: Financial Times, 2.11.2018.
- 19
-
Die Frage einer stärkeren Beteiligung des Privatsektors an der Risikoteilung von Rettungsmaßnahmen oder der Übernahme von Verlusten war in den Debatten über Finanzhilfepakete stets präsent – beispielsweise bei den Versuchen, die griechischen Schulden umzustrukturieren, oder beim Hilfspaket für Zypern im Jahr 2013, das neben anderem einen »Haircut« für private Investoren vorsah. Damit war unter anderem der Verfall von Bankeinlagen über 100.000 Euro gemeint.
- 20
-
Anfang 2024 war Italien das einzige Land, das die ESM-Reformen nicht ratifiziert hat.
- 21
-
Das Eurosystem besteht aus der EZB und den Zentralbanken der Euroraum-Staaten.
- 22
-
EZB, »Details on Securities Holdings Acquired under the Securities Markets Programme«, Pressemitteilung, 21.2.2013.
- 23
-
EZB, »ECB Announces Expanded Asset Purchase Programme«, Pressemitteilung, 15.1.2015.
- 24
-
EZB, »ECB Announces € 750 Billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)«, Pressemitteilung, 18.3.2020.
- 25
-
EZB, »Consolidated Balance Sheet of the Eurosystem as at 31 December 2023«, Frankfurt a. M. 2024.
- 26
-
EZB, »ECB Announces Expanded Asset Purchase Programme« [wie Fn. 23].
- 27
-
»Decision (EU) 2020/440 of the European Central Bank of 24 March 2020 on a Temporary Pandemic Emergency Purchase Programme (ECB/2020/17)«, in: Official Journal of the European Union, (25.3.2020) L 91/1, S. 1–4.
- 28
-
EZB, »Monetary Policy during the Pandemic: The Role of the PEPP«, Rede von Philip R. Lane, Mitglied des EZB-Direktoriums, vor dem Fachbereich Internationale Makroökonomie, Lehrstuhl der Banque de France – Paris School of Economics, Paris, 31.3.2022; Paweł Tokarski/Alexander Wiedmann, Das Corona-Schuldenproblem in der Eurozone: Grenzen der Stabilisierung durch die Geldpolitik und die Suche nach Alternativen, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, März 2021 (SWP-Aktuell 24/2021), doi: 10.18449/2021A24.
- 29
-
EZB, »Financial Statements of the ECB for 2023«, Pressemitteilung, 22.2.2024.
- 30
-
Bundesbank, »Finanzpuffer ermöglichen ausgeglichenes Bilanzergebnis der Bundesbank«, Pressenotiz, 23.2.2024.
- 31
-
Frederik Ducrozet/Thomas Costerg/Nadia Gharbi, »Do Central Bank’s Losses Matter?«, Pictet Wealth Management, 5.12.2022.
- 32
-
Es wurden vier detaillierte Bedingungen für die Auslösung des Ankaufs von Vermögenswerten durch das TPI bekannt gegeben: 1) Einhaltung des finanzpolitischen Rahmens der EU, 2) Vermeidung schwerwiegender makroökonomischer Ungleichgewichte, 3) fiskalische Nachhaltigkeit, 4) eine solide und nachhaltige makroökonomische Politik. Der Schwerpunkt liegt auf der Einhaltung der Verpflichtungen, die in den Konjunktur- und Resilienzplänen für die Konjunktur- und Resilienzfazilität und in den länderspezifischen Empfehlungen der Europäischen Kommission für den fiskalischen Bereich im Rahmen des Europäischen Semesters enthalten sind. Siehe EZB, »The Transmission Protection Instrument« [wie Fn. 7].
- 33
-
European instrument for temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency.
- 34
-
Tolek Petch, Legal Implications of the Euro Zone Crisis: Debt Restructuring, Sovereign Default and Euro Zone Exit, Alphen aan den Rijn 2014, S. 81f.
- 35
-
»Changes to the Operational Framework for Implementing Monetary Policy«, Erklärung des EZB-Rats, Frankfurt a. M., 13.3.2024.
- *
-
Dieser Text stellt die persönliche Meinung des Autors dar.
- 1
-
Alle Zahlen: Eurostat, EU Imports of Energy Products – Latest Developments, September 2023, <https://ec.europa.eu/eurostat/ statistics-explained/index.php?title=EU_imports_of_energy_ products_-_latest_developments#Main_suppliers_of_natural_ gas_and_petroleum_oils_to_the_EU> (eingesehen am 10.11.2023).
- 2
-
European Union, Special Eurobarometer 538 Climate Change – Report, Juli 2023, S. 70, <https://europa.eu/eurobaro meter/surveys/detail/2954> (eingesehen am 31.7.2023).
- 3
-
Ebd., S. 48.
- 4
-
Konferenz zur Zukunft Europas. Bericht über das endgültige Ergebnis, Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Mai 2022, S. 47, 3. Vorschlag, <https://op. europa.eu/de/publication-detail/-/publication/06619e05-eaee-11ed-a05c-01aa75ed71a1> (eingesehen am 31.5.2023).
- 5
-
Jean-Claude Juncker, Erklärung des Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission, Europäisches Parlament, 15.7.2014, <https://www.europarl.europa.eu/doceo/ document/CRE-8-2014-07-15-ITM-005_DE.html> (eingesehen am 31.7.2023).
- 6
-
»Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2017 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (28.10.2017) L 280, S. 1–56, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX %3A32017R1938> (eingesehen am 31.7.2023).
- 7
-
»Richtlinie (EU) 2023/2413 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2018/2001, der Verordnung (EU) 2018/1999 und der Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/652 des Rates«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (31.10.2023), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32023L2413> (eingesehen am 10.11.2023).
- 8
-
»Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Energieeffizienz und zur Änderung der Verordnung (EU) 2023/955 (Neufassung)«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (20.9.2023) L 231, S. 1–111, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ TXT/?uri=CELEX %3A32023L1791> (eingesehen am 10.11.2023).
- 9
-
»Verordnung (EU) 2023/955 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur Einrichtung eines Klima-Sozialfonds und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/1060«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (16.5.2023) L 130, S. 1–51, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ TXT/?uri=CELEX %3A32023R0955> (eingesehen am 10.8.2023).
- 10
-
»Verordnung (EU) 2022/2576 des Rates vom 19. Dezember 2022 über mehr Solidarität durch eine bessere Koordinierung der Gasbeschaffung, zuverlässige Preis-Referenzwerte und den grenzüberschreitenden Austausch von Gas«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (29.12.2022) L 335, S. 1–35, hier S. 2: Erwägungsgrund 5, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2576&qid= 1691836547788> (eingesehen am 12.8.2023).
- 11
-
Europäische Kommission, EU Energy Platform: Joint Gas Purchasing to Increase Energy Security in Europe, Juli 2023, <https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-07/ENE%20-%20Joint%20gas%20purchasing%20_FS_final.pdf> (eingesehen am 12.8.2023).
- 12
-
Zum Gesamtaufkommen des Gaskonsums der EU-27 im Jahr 2021: Rat der Europäischen Union, Infographic – Where Does the EU’s Gas Come from?, letzte Überarbeitung am 7.2.2023, <https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/ eu-gas-supply/> (eingesehen am 12.8.2023).
- 13
-
Siehe auch Nicolai von Ondarza, Die Krisengovernance der Europäischen Union: Mehr Verantwortung braucht mehr demokratische Legitimation, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, April 2023 (SWP-Studie 4/2023), doi: 10.18449/2023S04.
- 14
-
Europäische Kommission, »EU Energy Platform: EU’s Second Joint Gas Purchasing Round Enables Another Positive Matchmaking between European Companies and Gas Suppliers«, 13.7.2023, <https://energy.ec.europa.eu/news/eu-energy-platform-eus-second-joint-gas-purchasing-round-enables-another-positive-matchmaking-2023-07-13_en> (eingesehen am 12.8.2023).
- 1
-
Europäischer Rat, A New Strategic Agenda: 2019–2024, Brüssel 2019, <https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf> (eingesehen am 5.3.2024).
- 2
-
Siehe Einleitung, Grafik 1, S. 8.
- 3
-
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: 20 20 by 2020 – Europe’s Climate Change Opportunity, COM(2008) 30 final, Brüssel, 23.1.2008, <https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 52008DC0030> (eingesehen am 5.3.2024).
- 4
-
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Policy Framework for Climate and Energy in the Period from 2020 to 2030, 22.1.2014, <https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 52014DC0015> (eingesehen am 5.3.2024).
- 5
-
Als Überblick der laufenden und abgeschlossenen Projekte siehe Europäisches Parlament, Legislative Train Schedule: A European Green Deal, o. D., <https://www.europarl.europa.eu/ legislative-train/theme-a-european-green-deal> (eingesehen am 5.3.2024).
- 6
-
Paul Tobin/Diarmuid Torney/Katja Biedenkopf, »EU Climate Leadership: Domestic and Global Dimensions«, in: Tim Rayner u. a. (Hg.), Handbook on European Union Climate Change Policy and Politics, Cheltenham, 14.7.2023, S. 187–200, doi: 10.4337/9781789906981.00025.
- 7
-
Jon Birger Skjærseth, »The Commission’s Shifting Climate Leadership: From Emissions Trading to Energy Union«, in: Rüdiger Wurzel/James Connelly/Duncan Liefferink (Hg.), The European Union in International Climate Change Politics: Still Taking a Lead?, London/New York 2017, S. 37–51; Andrew Jordan/ Tim Rayner, »The Evolution of Climate Policy in the European Union: An Historical Overview«, in: Andrew Jordan u. a. (Hg), Climate Change Policy in the European Union: Confronting the Dilemmas of Mitigation and Adaptation, Cambridge 2011, S. 52–80, doi: 10.1017/CBO9781139042772.005.
- 8
-
Siehe auch den Beitrag von Lasse Michael Böhm, S. 35ff.
- 9
-
Sebastian Oberthür/Lisanne Groen, »The European Union and the Paris Agreement: Leader, Mediator, or Bystander?«, in: Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 8 (2017) 1, doi: 10.1002/wcc.445.
- 10
-
Grischa Perino u. a., »Closing the Implementation Gap: Obstacles in Reaching Net-Zero Pledges in the EU and Germany«, in: Politics and Governance, 10 (2022) 3, S. 213–225, doi: 10.17645/pag.v10i3.5326.
- 11
-
Europäische Kommission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Framework for Achieving Climate Neutrality and Amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law), COM/2020/80 final, Brüssel, 4.3.2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=CELEX%3A52020PC0080> (eingesehen am 5.3.2024).
- 12
-
Siehe auch den Beitrag von Lasse Michael Böhm, S. 35ff.
- 13
-
Siehe auch ebd.
- 14
-
Ingmar von Hohmeyer/Sebastian Oberthür/Claire Dupont, »Implementing the European Green Deal during the Evolving Energy Crisis«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 60 (2022) 51, S. 125–136, doi: 10.1111/jcms.13397; Jon Birger Skjærseth, »Towards a European Green Deal: The Evolution of EU Climate and Energy Policy Mixes«, in: International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 21 (2021) 1, S. 25–41, doi: 10.1007/s10784-021-09529-4.
- 15
-
Rüdiger K. W. Wurzel/Maurizio Di Lullo/Duncan Liefferink, »The European Council, Council and Member States: Jostling for Influence«, in: Rayner u. a. (Hg.), Handbook [wie Fn. 6], S. 38–52, doi: 10.4337/9781789906981.00014.
- 16
-
Kacper Szulecki u. a., »Shaping the ›Energy Union‹: Between National Positions and Governance Innovation in EU Energy and Climate Policy«, in: Climate Policy, 16 (2016) 5, S. 548–567, doi: 10.1080/14693062.2015.1135100.
- 17
-
Skjærseth, »The Commission’s Shifting Climate Leadership« [wie Fn. 7].
- 18
-
Aleksandra Krzysztoszek/Aneta Zachová, »Czech Minister Would Support Poland’s Call for Suspension of EU ETS«, Euractiv (online), 13.12.2021, <https://www.euractiv.com/ section/politics/short_news/czech-minister-would-support-polands-call-for-suspension-of-eu-ets/> (eingesehen am 5.3.2024).
- 19
-
Felix Schenuit/Oliver Geden, Die nächste Phase europäischer Klimapolitik: das 2040-Ziel als Auftakt, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, März 2024 (SWP-Aktuell 17/2024), doi: 10.18449/2024A17.
- 20
-
Aron Buzogány/Stefan Ćetković, »Fractionalized but Ambitious? Voting on Energy and Climate Policy in the European Parliament«, in: Journal of European Public Policy, 28 (2021) 7, S. 1038–1056, doi: 10.1080/13501763.2021. 1918220.
- 21
-
Luise Guillot, »Parliament Backs New EU Nature Law in Blow to Conservatives«, Politico, 12.7.2023.
- 22
-
Frédéric Simon, »Divided Parliament Votes Down EU Carbon Market Reform«, Euractiv, 8.6.2022.
- 1
-
Europäische Kommission, »Building a European Health Union: Stronger Crisis Preparedness and Response for Europe«, Pressemitteilung, Brüssel, 11.11.2020, <https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/en/ip_20_2041> (eingesehen am 13.6.2023).
- 2
-
Europäischer Rat, »Tagung des Europäischen Rates (10. und 11. Dezember 2020)«, Schlussfolgerung, Brüssel, 11.12.2020, <https://www.consilium.europa.eu/media/47346/ 1011-12-20-euco-conclusions-de.pdf> (eingesehen am 24.7.2023).
- 3
-
Europäische Kommission, Eurobarometer 93.1, 2020. GESIS, Köln. ZA7649 Datenfile Version 2.0.0, Brüssel, 2.10.2022, doi: 10.4232/1.13866; Europäische Kommission, Eurobarometer 95.3, 2021. GESIS, Köln. ZA7783 Datenfile Version 1.0.0, 3.3.2022, doi: 10.4232/1.13826.
- 4
-
Europäische Kommission, »European Health Union. Protecting Our Health Together«, <https://commission.europa. eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_en> (eingesehen am 20.6.2023).
- 5
-
Denis Horgan, »Health as an EU Competence – The Way Forward?«, in: Eureporter (online), 18.5.2022, <https:// www.eureporter.co/health/personalised-medicine/european-alliance-for-personalised-medicine-personalised-medicine/ 2022/05/18/health-as-an-eu-competence-the-way-forward/> (eingesehen am 13.6.2023); S&D-Fraktion, A European Health Union. Increasing EU Competence in Health. Coping with COVID19 and Looking to the Future, Brüssel, 12.5.2020 (Positionspapier), <https://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/2020-05/european_health_union_sd_position_30512_2.pdf> (eingesehen am 13.6.2023); Amalie Holmgaard Mersh, »COVID-19 Could Be Incentive to Give EU More Health Powers«, Euractiv (online), 3.3.2022, <https://www.euractiv.com/ section/health-consumers/news/covid-19-could-be-incentive-to-give-eu-more-health-powers/>.
- 6
-
Eleanor Brooks et al., »EU Health Policy in the Aftermath of COVID-19: Neofunctionalism and Crisis-driven Integration«, in: Journal of European Public Policy, 30 (2023) 4, S. 721–739.
- 7
-
Vincent Delhomme, »Emancipating Health from the Internal Market: For a Stronger EU (Legislative) Competence in Public Health«, in: European Journal of Risk Regulation, 11 (2020) 4, S. 747–756.
- 8
-
Scott L. Greer et al., Everything You Always Wanted to Know about European Union Health Policy But Were Afraid to Ask, 3. Aufl., Kopenhagen 2022.
- 9
-
»Regulation (EU) No 1175/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic policies«, in: Official Journal of the European Union, (23.11.2011) L 306, S. 12–24, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011 R1175> (eingesehen am 20.6.2023).
- 10
-
Rat der Europäischen Union, »European Semester in 2020«, <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/ european-semester/previous-semesters/2020> (eingesehen am 20.6.2023).
- 11
-
Mary Guy, »Towards a European Health Union: What Role for Member States?«, in: European Journal of Risk Regulation, 11 (2020) 4, S. 757–765.
- 12
-
Anniek de Ruijter, EU Health Law & Policy. The Expansion of EU Power in Public Health and Health Care, Oxford 2019.
- 13
-
»Richtlinie 98/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Werbung und Sponsoring zugunsten von Tabakerzeugnissen«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (30.7.1998) L 213, S. 9–12, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri= CELEX:31998L0043&from=ES> (eingesehen am 20.6.2023).
- 14
-
»Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (4.4.2011) L 88, S. 45–65, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri= OJ:L:2011:088:0045:0065:DE:PDF> (eingesehen am 20.6.2023).
- 15
-
Nicolai von Ondarza/Paul Bochtler, Public Voting Data of the Council of the EU. Datenfile Version 2.0.0, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2023, doi: 10.7802/2560. Zu beachten ist, dass die Daten keine Aufschlüsselung für Abstimmungen zum Thema Gesundheit zulassen, sondern alle EPSCO-Formationen beinhalten.
- 16
-
Nicolai von Ondarza, Die Krisengovernance der Europäischen Union. Mehr Verantwortung braucht mehr demokratische Legitimation, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, April 2023 (SWP-Studie 4/2023), doi: 10.18449/2023S04.
- 17
-
Greer et al., Everything You Always Wanted to Know about European Union Health Policy [wie Fn. 8].
- 18
-
Europäische Kommission, Vertretung in Deutschland, »Reform der EU-Arzneimittelregeln: Medikamente sollen leichter zugänglich, erschwinglicher und innovativer werden«, Pressemitteilung, Berlin, 26.4.2023, <https://germany. representation.ec.europa.eu/news/reform-der-eu-arznei mittelregeln-medikamente-sollen-leichter-zuganglich-erschwinglicher-und-2023-04-26_de> (eingesehen am 20.6.2023).
- 19
-
Für eine detaillierte Darstellung siehe Mary Guy/Wolf Sauter, »Chapter 1: The History and Scope of EU Health Law and Policy«, in: Tamara K. Hervey/Calum A. Young/Louise E. Bishop (Hg.), Research Handbook on EU Health Law and Policy, Cheltenham/Northampton, MA, 2017, S. 17–35.
- 20
-
Consolidated text: Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, 1.7.2022, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002R0178-20220701> (eingesehen am 20.6.2023).
- 21
-
»Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use«, in: Official Journal of the European Union, (28.11.2001) L 311, S. 67–128, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri= CELEX%3A32001L0083> (eingesehen am 20.6.2023); »Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency (Text with EEA relevance)«, in: Official Journal of the European Union, (30.4.2004) L 136, S. 1–33, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/ ?uri=CELEX%3A32004R0726> (eingesehen am 20.6.2023).
- 22
-
Europäisches Parlament/Rat der Europäischen Union, »Council Directive of 21 December 1988 relating to the transparency of measures regulating the prices of medicinal products for human use and their inclusion in the scope of national health insurance systems, 89/105/EEC«, in: Official Journal of the European Communities, (11.2.1989) L 40, S. 8–11, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX %3A31989L0105> (eingesehen am 20.6.2023).
- 23
-
Europäisches Parlament/Rat der Europäischen Union, »Council Directive of 20 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to active implantable medical devices, 90/385/EEC«, in: Official Journal of the European Communities, (20.7.1990) L 189, S. 17–36, <https://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:31990L0385> (eingesehen am 20.6.2023).
- 24
-
Europäische Kommission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on standards of quality and safety for substances of human origin intended for human application and repealing Directives 2002/98/EC and 2004/23/EC, 14.7.2022, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX: 52022PC0338> (eingesehen am 20.6.2023).
- 25
-
Europäisches Parlament/Rat der Europäischen Union, »Council Directive of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work, 89/391/EEC«, in: Official Journal of the European Communities, (29.6.1989) L 183, S. 1–8, <https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A31989 L0391> (eingesehen am 20.6.2023).
- 26
-
Europäisches Parlament/Rat der Europäischen Union, »Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare«, in: Official Journal of the European Union, (4.4.2011) L 88, S. 45–65, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011 L0024> (eingesehen am 20.6.2023).
- 27
-
Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC), »Infection prevention and control measures for Ebola virus disease – Entry and exit screening measures«, Technischer Bericht, Stockholm, 12.10.2014, <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/ media/en/publications/Publications/Ebola-outbreak-technicalreport-exit-entry-screening-13Oct2014.pdf> (eingesehen 27.7.2023).
- 28
-
»Verordnung (EU) 2022/2371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. November 2022 zu schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1082/2013/EU (Text von Bedeuung für den EWR)«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (6.12.2022) L 314, S. 26–63, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32022R2371> (eingesehen am 20.6.2023).
- 29
-
»Verordnung (EU) 2022/2370 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. November 2022 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 851/2004 zur Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (6.12.2022) L 314, S. 1–25, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2370> (eingesehen am 20.6.2023).
- 30
-
Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zu einer verstärkten Rolle der Europäischen Arzneimittel-Agentur bei der Krisenvorsorge und dem Krisenmanagement in Bezug auf Arzneimittel und Medizinprodukte, 11.11.2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0725> (eingesehen am 20.6.2023).
- 31
-
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. HERA: die neue Europäische Behörde für Krisenvorsorge und ‑reaktion bei gesundheitlichen Notlagen – der nächste Schritt zur Vollendung der europäischen Gesundheitsunion, Brüssel, 16.9.2021, <https://eur-lex.europa.eu/resource.html? uri=cellar:5cba81f5-16f8-11ec-b4fe-01aa75ed71a1.0021.02/ DOC_1&format=PDF> (eingesehen am 20.6.2023).
- 32
-
»Verordnung (EU) 2021/522 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. März 2021 zur Einrichtung eines Aktionsprogramms der Union im Bereich der Gesundheit (›EU4Health-Programm‹) für den Zeitraum 2021–2027 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 282/2014 (Text von Bedeutung für den EWR)«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (26.3.2021) L 107, S. 1–29, <https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0522> (eingesehen am 20.6.2023).
- 33
-
Europäische Kommission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Union procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human use and establishing rules governing the European Medicines Agency, amending Regulation (EC) No 1394/2007 and Regulation (EU) No 536/2014 and repealing Regulation (EC) No 726/2004, Regulation (EC) No 141/2000 and Regulation (EC) No 1901/2006, 26.4.2023, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=CELEX:52023PC0193> (eingesehen am 20.6.2023).
- 34
-
Europäische Kommission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council the Union code relating to medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/83/EC and Directive 2009/35/EC, 26.4.2023, <https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bfcb9e00-e437-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF (eingesehen am 20.6.2023).
- 35
-
Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den europäischen Raum für Gesundheitsdaten, 3.5.2022, <https://eur-lex.europa. eu/resource.html?uri=cellar:dbfd8974-cb79-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF> (eingesehen am 20.6.2023).
- 36
-
Brooks et al., »EU Health Policy in the Aftermath of COVID-19« [wie Fn. 6].
- 37
-
Michael Bayerlein, Offene strategische Autonomie der EU im Bereich Arzneimittel: Überwindung von Importabhängigkeiten bei Antibiotika durch EU-Behörde HERA, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Dezember 2022 (SWP-Aktuell 75/2022), doi: 10.18449/2022A75.
- 38
-
Saskia Hirsch/Seon Jae Crystal Choi, »National resistance to joint medical procurement: fractures in the European Health Union?«, Global Counsel, Health and Life Sciences, 30.8.2022, <https://www.global-counsel.com/insights/ research/national-resistance-joint-medical-procurement-fractures-european-health-union> (eingesehen am 26.7.2023).
- 39
-
Brooks et al., »EU Health Policy in the Aftermath of COVID-19« [wie Fn. 6].
- 40
-
Delhomme, »Emancipating Health from the Internal Market« [wie Fn. 7].
- 41
-
Im Detail müsste Artikel 6 lit. a AEUV durch lit. k des Artikels 4 AEUV Absatz 2 AEUV ersetzt und die nur unterstützende Zuständigkeit in Absatz 1, 4 und 5 des Artikels 168 AEUV gestrichen werden.
- 42
-
Vincent Delhomme, »Smoke-free Environments: The Missing Link in EU Anti-tobacco Policy«, Brügge: College of Europe, Mai 2018 (Policy Brief), <https://www.coleurope.eu/ sites/default/files/research-paper/delhomme_cepob_8-18_0. pdf> (eingesehen am 7.3.2024).
- 43
-
Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, Fachbereich Europa, »Kompetenzen der Europäischen Union bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren«, Ausarbeitung PE 6 – 3000 – 115/20, 19.2.2021, <https:// www.bundestag.de/resource/blob/827926/9e44db0750522410f49cb5a8f17d1845/PE-6-115-20-pdf-data.pdf> (eingesehen 26.7.2023).
- 44
-
Johan P. Mackenbach/Marina Karanikolos/Martin McKee, »The Unequal Health of Europeans: Successes and Failures of Policies«, in: The Lancet, 381 (2013) 9872, S. 1125–1134.
- 45
-
Chiara Burlin/Andrés Rodríguez-Pose, »Inequality, Poverty, Deprivation and the Uneven Spread of COVID-19 in Europe«, in: Regional Studies, (2023), S. 1–22.
- 46
-
Bundesministerium für Gesundheit (BMG), »EU4Health – Aktionsprogramm der Europäischen Union im Bereich der Gesundheit«, 19.12.2022, Bonn, <https://www.bundesgesund heitsministerium.de/themen/internationale-gesundheits politik/europa/eu4health.html> (eingesehen 4.7.2023).
- 47
-
Michael Bayerlein, Regionale Gesundheitsversorgung in der EU. ESI-Fonds als Mittel zum Aufbau der Europäischen Gesundheitsunion, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2023 (SWP-Studie 15/2023), doi: 10.18449/2023S15.
- 48
-
»The European Semester – A Tool to Embed Health, Equity, and Wellbeing across the EU«, Brüssel: EuroHealthNet, April 2023 (Report), <https://eurohealth net.eu/wp-content/ uploads/publications/2023/2305_report_european_semester_ a_roundtable_discussion.pdf> (eingesehen am 20.6.2023).
- 49
-
Giandomenico Majone, »The European Community between Social Policy and Social Regulation«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 31 (1993) 2, S. 153–170.
- 1
-
Vgl. Annegret Bendiek/Christoph Berlich/Tobias Metzger, Die digitale Selbstbehauptung der EU, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, August 2015 (SWP-Aktuell 71/2015), <https://www.swp-berlin.org/publikation/die-digitale-selbstbehauptung-der-eu> (eingesehen am 12.7.2023).
- 2
-
Vgl. Think-Tank des Europäischen Parlaments, The von der Leyen Commission’s Priorities for 2019–2024, Brüssel, 28.1.2020, <https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/ EPRS_BRI(2020)646148> (eingesehen am 13.7.2023).
- 3
-
Vgl. Europäisches Parlament, The Six Policy Priorities of the von der Leyen Commission, Brüssel, September 2021, <https:// www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/696205/EPRS_IDA(2021)696205_EN.pdf> (eingesehen am 13.7.2023).
- 4
-
Vgl. Europäisches Parlament, Digital Agenda for Europe, Brüssel, April 2023, <https://www.europarl.europa.eu/ factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe> (eingesehen am 12.7.2023).
- 5
-
Vgl. »Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau der Union«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (27.12.2022) L 333, S. 80–152.
- 6
-
Vgl. »The EU Wants to Set the Rules for the World of Technology«, in: The Economist (online), 20.2.2020, <https:// www.economist.com/business/2020/02/20/the-eu-wants-to-set-the-rules-for-the-world-of-technology> (eingesehen am 13.7.2023).
- 7
-
Vgl. Milton Mueller, »Against Sovereignty in Cyberspace«, in: International Studies Review, 22 (2020) 4, S. 779–801 (783f).
- 8
-
Vgl. Annegret Bendiek/Ben Wagner, »Die Verfassung des Internets«, in: Internationale Politik, (2012) 6, S. 85–92.
- 9
-
Vgl. John Strand, Ban Huawei? Not Europe, Washington, D.C.: Center for European Policy Analysis (CEPA), 12.1.2023, <https://cepa.org/article/ban-huawei-not-europe/> (eingesehen am 13.7.2023).
- 10
-
Vgl. »CETIN Chooses Ericsson for 5G Network«, Reuters (online), 19.10.2022, <https://www.reuters.com/article/czech-telecoms-5g-idUKL8N2HA380> (eingesehen am 13.7.2023).
- 11
-
Vgl. Supantha Mukherjee, »Swedish Court Upholds Ban on Huawei Sale of 5G Gear«, Reuters (online), 22.6.2022, <https://www.reuters.com/business/media-telecom/swedish-court-upholds-ban-huawei-sale-5g-gear-2022-06-22/> (eingesehen am 13.7.2023).
- 12
-
Vgl. Marcel Rosenbach/Wolf Wiedmann-Schmidt, »Behörden nehmen Huawei-Software ins Visier«, in: Der Spiegel (online), 16.6.2023, <https://www.spiegel.de/panorama/ 5g-mobilfunknetz-in-deutschland-behoerden-koennten-einsatz-von-huawei-technik-untersagen-a-c5657fae-515d-48fc-aabd-fa3f657adf71> (eingesehen am 13.7.2023); Jan Vollmer, »5G: So lange braucht Vodafone, um Huawei-Komponenten wieder auszubauen«, t3n (online), 7.2.2020, <https://t3n.de/news/5g-lange-vodafone-um-auszubauen-1250011/> (eingesehen am 13.7.2023).
- 13
-
Vgl. Laurens Cerulus, »EU Nudges Germany to Cut Down on Huawei«, Politico (online), 10.11.2022, <https://www. politico.eu/article/eu-nudges-germany-to-cut-down-on-huawei/> (eingesehen am 14.9.2023).
- 14
-
Vgl. Javier Espinoza, »EU Considers Mandatory Ban on Using Huawei to Build 5G«, in: Financial Times, 7.62023, <https://www.ft.com/content/a6900b0f-08d5-433d-bfb0-f57b6041e381> (eingesehen am 14.9.2023).
- 15
-
Vgl. Annegret Bendiek/Isabella Stuerzer, »The Brussels Effect, European Regulatory Power and Political Capital«, in: Digital Society, 2 (2023) 5, doi: 10.1007/s44206-022-00031-1.
- 16
-
Vgl. Mukherjee, »Swedish Court Upholds Ban« [wie Fn. 11].
- 17
-
Vgl. Iris Deng, »Huawei Says Proposed EU Ban on Its 5G Equipment Is Unlawful, Will ›Distort‹ the Market«, in: South China Morning Post, 8.6.2023, <https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3223444/huawei-says-proposed-eu-ban-its-5g-equipment-unlawful-will-distort-market> (eingesehen am 14.9.2023).
- 18
-
Vgl. Michael Sauga, »Start frei für einen Wettlauf, den alle vermeiden wollen«, in: Der Spiegel (online), 11.3.2023, <https://www.spiegel.de/wirtschaft/von-der-leyen-trifft-biden-start-frei-zum-subventionswettlauf-a-fb754c5d-e44f-41c7-8015-472f31c72da3> (eingesehen am 13.7.2023).
- 19
-
Vgl. »EU-Gericht bestätigt Milliardenstrafe gegen Google«, in: Der Spiegel (online), 14.9.2022, <https://www. spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/kartellrecht-eu-gericht-bestaetigt-milliardenstrafe-gegen-google-a-59ddfed2-b493-421c-895c-3f256aba1ed8> (eingesehen am 13.7.2023).
- 20
-
Vgl. Raimund Schesswendter, »Google: Sundar Pichai verabredet Zusammenarbeit mit der EU beim ›KI-Pakt‹«, t3n (online), 25.5.2023, <https://t3n.de/news/google-eu-sundar-pichai-thierry-breton-ki-pakt-gesetz-richtlinien-1554912/> (eingesehen am 13.7.2023).
- 21
-
Vgl. Gerichtshof der Europäischen Union, »Der Gerichtshof erklärt die Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Daten für ungültig«, Pressemitteilung, Luxemburg, 8.4.2014, <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/ 2014-04/cp140054de.pdf> (eingesehen am 13.7.2023).
- 22
-
Vgl. Christian Tretbar, »EuGH zu Safe Harbor: Der erste Erfolg für Edward Snowden«, in: Tagesspiegel (online), 6.10.2015, <https://www.tagesspiegel.de/politik/der-erste-erfolg-fur-edward-snowden-4858441.html> (eingesehen am 13.7.2023).
- 23
-
Vgl. Annegret Bendiek/Isabella Stürzer, Die digitale Souveränität der EU ist umstritten, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, April 2022 (SWP-Aktuell 30/2022), doi: 10.18449/ 2022A30.
- 24
-
Vgl. »Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (4.5.2016) L 119, S. 1–88.
- 25
-
Vgl. Bendiek/Stürzer, »The Brussels Effect« [wie Fn. 15].
- 26
-
Vgl. »Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (12.10.2022) L 265, S. 1–66; »Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (27.10.2022) L 277, S. 1–102.
- 27
-
Vgl. »Verordnung (EU) 2019/881 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die über die ENISA (Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit) und über die Zertifizierung der Cybersicherheit von Informations- und Kommunikationstechnik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 (Rechtsakt zur Cybersicherheit)«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (7.6.2019) L 151, S. 15–69.
- 28
-
Vgl. Annegret Bendiek/Martin Schallbruch, Europas dritter Weg im Cyberraum, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2019 (SWP-Aktuell 60/2019), doi: 10.18449/2019A60.
- 29
-
Vgl. NIS Cooperation Group, Cybersecurity of 5G Networks: EU Toolbox of Risk Mitigating Measures, Brüssel, 23.1.2020, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/cybersecurity-5g-networks-eu-toolbox-risk-mitigating-measures> (eingesehen am 13.7.2023).
- 30
-
Vgl. Europäischer Rat/Rat der Europäischen Union, »Cyber Posture: Council Approves Conclusions«, Pressemitteilung, Brüssel, 23.5.2022, <https://www.consilium.europa.eu/de/ press/press-releases/2022/05/23/cyber-posture-council-approves-conclusions> (eingesehen am 13.7.2023).
- 31
-
Vgl. Annegret Bendiek/Raphael Bossong/Matthias Schulze, Die erneuerte Strategie der EU zur Cybersicherheit, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Oktober 2017 (SWP-Aktuell 72/2017), <https://www.swp-berlin.org/publikation/ die-erneuerte-strategie-der-eu-zur-cybersicherheit> (eingesehen am 13.7.2023).
- 32
-
Vgl. »Richtlinie (EU) 2022/2557 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über die Resilienz kritischer Einrichtungen«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (27.12.2022) L 333, S. 164–198.
- 33
-
Vgl. »Richtlinie (EU) 2022/2555 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau der Union« [wie Fn. 5].
- 34
-
Vgl. Europäisches Parlament, EU AI Act: First Regulation on Artificial Intelligence, Brüssel, 14.6.2023, <https://www. europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601 STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence> (eingesehen am 13.7.2023).
- 35
-
Vgl. Europäische Kommission, European Approach to Artificial Intelligence, Brüssel, 9.12.2023, <https://digital-strategy. ec.europa.eu/en/policies/european-approach-artificial-intelligence> (eingesehen am 8.1.2024); Europäisches Parlament, »Artificial Intelligence Act: MEPs Adopt Landmark Law«, Presseerklärung, Brüssel, 13.3.2024, <https://www. europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19015/ artificial-intelligence-act-meps-adopt-landmark-law> (eingesehen am 15.3.2024).
- 36
-
Vgl. Gian Volpicelli, »ChatGPT Broke the EU Plan to Regulate AI«, Politico (online), 3.3.2023, <https://www.politico. eu/article/eu-plan-regulate-chatgpt-openai-artificial-intelli gence-act/> (eingesehen am 13.7.2023); Rat der Europäischen Union, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence, 5662/24, Brüssel, 26.1.2024.
- 37
-
Vgl. Europäische Kommission, Europäisches Chip-Gesetz, Brüssel 2023, <https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_de> (eingesehen am 13.7.2023).
- 38
-
»Kultivierter Spill-over« bezeichnet eine eher orchestrierte denn aus unvorhersehbaren Dynamiken entstandene Variante des Spill-over, die von supranationalen Institutionen vorangetrieben wird, um die eigene Autorität und Legitimität zu stärken. Vgl. Ernst B. Haas, The Uniting of Europe, Notre Dame, IN, 1958, S. 291ff, und Jeppe Tranholm-Mikkelsen, »Neo-functionalism: Obstinate or Obsolete?«, in: Millennium, 20 (1991) 1, S. 1–22 (6f).
- 39
-
Vgl. Annegret Bendiek/Jakob Bund, Paradigmenwechsel in der europäischen Cyberabwehr, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Juli 2023 (SWP-Aktuell 49/2023), doi: 10.18449/ 2023A49.
- 40
-
Vgl. Laurens Cerulus, »Germany Is (Still) a Huawei Hotspot in Europe«, Politico, 14.12.2022, <https://www.politico. eu/article/germany-is-still-a-huawei-hotspot-in-europe-5g-telecoms-network/> (eingesehen am 18.9.2023).
- 41
-
Vgl. Werner Hoyer, Untangling the Polycrisis, Luxemburg: Europäische Investitionsbank, 19.1.2023, <https://www.eib. org/en/stories/polycrisis-investment-davos> (eingesehen am 13.7.2023).
- 42
-
Vgl. Europäische Kommission, Europäischer Aufbauplan, Brüssel 2023, <https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe_de> (eingesehen am 13.7.2023).
- 43
-
Vgl. Mikko Huotari/Grzegorz Stec, »Six Priorities for ›De-risking‹ EU Relations with China«, in: Internationale Politik Quarterly, 24.3.2023, <https://ip-quarterly.com/en/six-priorities-de-risking-eu-relations-china> (eingesehen am 13.7.2023).
- 44
-
Vgl. Laurens Cerulus/Jacopo Barigazzi, »France Eyes Control over Chip Agenda in EU-US Tech Alliance«, Politico (online), 29.11.2021, <https://www.politico.eu/article/france-eu-chips-strategy-control/> (eingesehen am 13.7.2023).
- 45
-
Vgl. Hosuk Lee-Makiyama/Robin Baker, Loosening China’s Grip on Telecommunications, Washington, D.C.: CEPA, 31.3.2022, <https://cepa.org/loosening-chinas-grip-on-telecommunicationshttps://cepa.org/loosening-chinas-grip-on-telecommunications/> (eingesehen am 13.7.2023).
- 46
-
Vgl. Annegret Bendiek, Deutsche Cybersicherheit in Europa, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Januar 2023 (SWP Arbeitspapier FG EU/Europa), <https://www.swp-berlin.org/ publications/products/arbeitspapiere/Deutsche_Cyber sicherheit_in_Europa_BT20012023_Bendiek_AP.pdf> (eingesehen am 13.7.2023).
- 1
-
Swen Hutter/Hanspeter Kriesi, »Politicising Immigration in Times of Crisis«, in: Journal of Ethnic and Migration Studies, 48 (2022) 2, S. 342–365, doi: 10.1080/1369183X.2020.1853902; Sarah Léonard/Christian Kaunert, Refugees, Security and the European Union, London: Routledge, 2019. Die Auswirkungen terroristischer Anschläge auf Wahlen im Allgemeinen und EU-Zustimmungen im Besonderen sind aber uneindeutig und zeitlich deutlich beschränkter als die Migrationsthematik, vgl. Erik Gahner Larsen/David Cutts/Matthew J. Goodwin, »Do Terrorist Attacks Feed Populist Eurosceptics? Evidence from Two Comparative Quasi-experiments«, in: European Journal of Political Research, 59 (2019) 1, S. 182–205, doi: 10.1111/ 1475-6765.12342.
- 2
-
Europäische Kommission, »Rede zur Lage der Union: Hin zu einem besseren Europa – Einem Europa, das schützt, stärkt und verteidigt«, Pressemitteilung, 14.9.2016, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ SPEECH_16_3043> (eingesehen am 12.4.2024).
- 3
-
»Zwei Jahre Sicherheitsunion«, Pressemitteilung, 8.11.2016, <https://commission.europa.eu/system/files/2016-11/2-years-on-security-union_de.pdf> (eingesehen am 6.7.2023).
- 4
-
»Erklärung von Bratislava«, Pressemitteilung, 16.9.2016, <https://www.consilium.europa.eu/media/21232/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-de.pdf> (eingesehen am 6.7.2023).
- 5
-
Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission. EU‑Strategie für eine Sicherheitsunion, COM(2020) 605 final, 24.7.2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/ HTML/?uri=CELEX:52020DC0605> (eingesehen am 6.7.2023).
- 6
-
Hermann-Josef Blanke/Sebastian R. Bunse, »Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts – ein Integrationswert?«, in: Peter Nitschke (Hg.), Gemeinsame Werte in Europa?, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2019, S. 51–110.
- 7
-
Europäische Kommission, »Feuerwaffen: Aktualisierte Vorschriften«, Pressemitteilung, 27.10.2022, <https://ec. europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_6427> (eingesehen am 12.4.2024).
- 8
-
Europäische Kommission, »EU-Vorschriften für Eigenherstellung von Explosivstoffen und Terrorismusfinanzierung«, Pressemitteilung, 14.6.2019, <https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/de/IP_19_3003> (eingesehen am 14.2.2024).
- 9
-
Florian Trauner/Ariadna Ripoll Servent, »Justice and Home Affairs in the European Union«, in: Oxford Research Encyclopedia of Politics, 2020, doi: 10.1093/acrefore/ 9780190228637.013.1084.
- 10
-
Zudem gilt eine »Notbremse« in der strafrechtlichen Zusammenarbeit, falls ein Mehrheitsentscheid zentralen Interessen und Eigenheiten eines Mitgliedstaats widerspricht (Art. 82 & 83 [3] AEUV). Dieser Vorbehalt hat in der Praxis bislang aber kaum eine Rolle gespielt.
- 11
-
Sara I. Sánchez/Maribel G. Pascual, Fundamental Rights in the EU Area of Freedom, Security, and Justice, Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- 12
-
Ester Herlin-Karnell, The European Court of Justice as a Game Changer: Fiduciary Obligations in the Area of »Freedom, Security and Justice«, 2016, doi: 10.2139/ssrn.2980735.
- 13
-
Jorg Monar, »The Dynamics of Justice and Home Affairs: Laboratories, Driving Factors and Costs«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 39 (2001) 4, S. 747–764.
- 14
-
Raphael Bossong/Mark Rhinard, Theorizing Internal Security in the European Union, Oxford: Oxford University Press, 2016.
- 15
-
Florian Trauner/Ariadna Ripoll Servent, »The Communitarization of the Area of Freedom, Security and Justice: Why Institutional Change Does Not Translate into Policy Change«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 54 (2016) 6, S. 1417–1432.
- 16
-
Gemäß den Verträgen sollte die strategische Steuerung des RFSR langfristig im Europäischen Rat festgelegt werden (Art. 68 AEUV). Diese Leitlinien haben jedoch praktisch kaum Relevanz entfaltet. Vielmehr befasst sich der Europäische Rat vorrangig anlass- und krisenbedingt mit innenpolitischen Themen.
- 17
-
Zwischen 2010 und 2023 gab es nur sieben Abstimmungen mit mehr als einer Gegenstimme und 15 mit einer einzigen Gegenstimme. In 52 weiteren Abstimmungen waren die Voten einstimmig, und in 20 weiteren Fällen gab es mindestens eine Enthaltung im Rat. Siehe auch Christian Kaunert, »The Area of Freedom, Security and Justice in the Lisbon Treaty: Commission Policy Entrepreneurship?«, in: European Security, 19 (2010) 2, S. 169–189.
- 18
-
Christof Roos, »Opposition or Consensus in the Justice and Home Affairs Council? The How and Why of Increasing Member State Contestation over EU Policy«, in: Journal of European Integration, 41 (2019) 5, S. 569–586.
- 19
-
Raphael Bossong, Die Weiterentwicklung von Schengen und der europäischen Migrations- und Asylpolitik, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, März 2022 (SWP-Studie 3/2022), doi: 10.18449/2022S03.
- 20
-
Europäische Union, »Rahmenbeschluss des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten«, in: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, (18.7.2002) L 190, S. 1–20, <https://eur-lex. europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri= OJ:L:2002:190: FULL> (eingesehen am 6.7.2023).
- 21
-
Wolfgang Wagner, »Negative and Positive Integration in EU Criminal Law Co-operation«, in: European Integration online Papers (EIoP), 15 (2011) 3, doi: 10.1695/2011003.
- 22
-
Christian Freudlsperger u. a., »Opening Pandora’s Box? Joint Sovereignty and the Rise of EU Agencies with Operational Tasks«, in: Comparative Political Studies, 55 (2022) 12, S. 1983–2014.
- 23
-
Rocco Bellanova/Georgios Glouftsios, »Formatting European Security Integration through Database Interoperability«, in: European Security, 31 (2022) 3, S. 454–474.
- 24
-
Philipp Genschel/Markus Jachtenfuchs, »From Market Integration to Core State Powers: The Eurozone Crisis, the Refugee Crisis and Integration Theory«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 56 (2018) 1, S. 178–196.
- 25
-
Vgl. dazu den Beitrag von Nicolai von Ondarza, S. 115ff.
- 26
-
Ariadna Ripoll Servent, Institutional and Policy Change in the European Parliament: Deciding on Freedom, Security and Justice, London: Palgrave Macmillan, 2015, doi: 10.1057/9781137410 559.
- 27
-
Monika Zalnieriute, »A Struggle for Competence: National Security, Surveillance and the Scope of EU Law at the Court of Justice of European Union«, in: The Modern Law Review, 85 (2022) 1, S. 198–218.
- 28
-
Pola Cebulak, »Schengen Restored«, Verfassungsblog (5.5.2022), doi: 10.17176/20220505-182415-0.
- 29
-
European Parliament, »Discharge: MEPs Delay Signing Off on Accounts of EU Border Control Agency Frontex«, Pressemitteilung, 4.5.2022, <https://www.europarl.europa.eu/ news/en/press-room/20220429IPR28235/discharge-meps-delay-signing-off-on-accounts-of-frontex> (eingesehen am 23.8.2023).
- 30
-
Marco Scipioni, »Failing Forward in EU Migration Policy? EU Integration after the 2015 Asylum and Migration Crisis«, in: Journal of European Public Policy, 25 (2018) 9, S. 1357–1375.
- 31
-
Marcello Di Filippo, »The Allocation of Competence in Asylum Procedures under EU Law: The Need to Take the Dublin Bull by the Horns«, in: Revista de Derecho Comunitario Europeo, (2018) 59, S. 41–95.
- 32
-
Das sogenannte Stockholm-Programm, das unter schwedischer Ratspräsidentschaft verabschiedet wurde. Zuvor gab es zwei Vorläufer-Programme zur grundlegenden Entwicklung des RFSR von 1999 bis 2004 (Tampere) und von 2005 bis 2009 (Den Haag). Elspeth Guild/Sergio Carrera, Towards the Next Phase of the EU’s Area of Freedom, Security and Justice: The EC’s Proposals for the Stockholm Programme, Brüssel: Centre for European Policy Studies (CEPS), 20.8.2009 (CEPS Policy Brief), <https://ssrn.com/abstract=1513272> (eingesehen am 14.2.2024).
- 33
-
Natascha Zaun, »Why EU Asylum Standards Exceed the Lowest Common Denominator: The Role of Regulatory Expertise in EU Decision-Making«, in: Journal of European Public Policy, 23 (2016) 1, S. 136–154.
- 34
-
Raphael Bossong, »The EU’s Fight against Terrorism since the 2015 Paris Attacks: Strategic Trends and Persistent Limitations«, in: Raphael Bossong (Hg.), Terrorismus als Herausforderung der Europäischen Union, Nomos Verlagsgesellschaft, 2019, S. 11–38, doi: 10.5771/9783748903581-11.
- 35
-
Raphael Bossong, Der Ausbau von Frontex, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2019 (SWP-Aktuell 66/2019), doi: 10.18449/2019A66.
- 36
-
Raphael Bossong, Intelligente Grenzen und interoperable Datenbanken für die innere Sicherheit der EU. Umsetzungsrisiken und rechtsstaatliche Anforderungen, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, April 2018 (SWP-Studie 4/2018), <https:// www.swp-berlin.org/publikation/intelligente-grenzen-und-interoperable-datenbanken-fuer-die-innere-sicherheit-der-eu> (eingesehen am 6.7.2023); Niovi Vavoula, Immigration and Privacy in the Law of the European Union. The Case of Information Systems, Boston: Brill, 2022.
- 37
-
Dazu kam ein neues elektronisches System für den Austausch von Vorstrafeninformationen von Drittstaatsangehörigen.
- 38
-
Dieser Deliktbereich wurde mit einer gesonderten Richtlinie ausgestaltet: »Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtetem Betrug«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (28.7.2017) L 198, S. 29–41, <https://eur-lex. europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:198: FULL> (eingesehen am 27.10.2023). Der Vorschlag, die Zuständigkeit der EuSta zügig auf die Terrorismusbekämpfung auszuweiten, fand keinen Anklang; vgl. Jannika Thomas, »Die Europäische Staatsanwaltschaft – Ein Ausblick«, in: Kriminalpolitische Zeitschrift, (2021) 2, S. 106–114, <https:// kripoz.de/2021/03/26/ die-europaeische-staatsanwaltschaft-ein-ausblick/> (eingesehen am 21.8.2023).
- 39
-
European Public Prosecutor’s Office, Annual Report 2022, Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2023, <https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2023-02/EPPO_2022_Annual_Report_EN_WEB.pdf> (eingesehen am 14.2.2024).
- 40
-
Laura Schmeer, »The Establishment of the European Public Prosecutor’s Office: Integration with Limited Supranationalisation?«, in: Journal of European Integration, 45 (2023) 6, S. 845–869, doi: 10.1080/07036337.2023.2196069.
- 41
-
Patrícia Godinho Silva, »Recent Developments in EU Legislation on Anti-money Laundering and Terrorist Financing«, in: New Journal of European Criminal Law, 10 (2019) 1, doi: 10.1177/2032284419840442. Ergänzend wurden eine Richtlinie zur Betrugsbekämpfung bei elektronischen Zahlungsmitteln und weitere Maßnahmen zur verbesserten Zusammenarbeit oder gegenseitigen Anerkennung von Beschlagnahmungen und Vermögenseinziehungen eingeführt.
- 42
-
Rat der Europäischen Union, »Bekämpfung von Geldwäsche: Rat und Parlament vereinbaren Schaffung einer neuen Behörde«, Pressemitteilung, 13.12.2023, <https://www. consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2023/12/13/anti-money-laundering-council-and-parliament-agree-to-create-new-authority/> (eingesehen am 14.2.2024).
- 43
-
Tomas Rudl, »E-Evidence: Elektronische Beweismittel stellen den Rechtsstaat auf die Probe« (online), Netzpolitik.org, 14.6.2023, <https://netzpolitik.org/2023/e-evidence-elek tronische-beweismittel-stellen-den-rechtsstaat-auf-die-probe/> (eingesehen am 6.7.2023).
- 44
-
Steffen Angenendt/Nadine Biehler/Raphael Bossong/ David Kipp/Anne Koch, Endspurt bei der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten für die deutsche und europäische Asylpolitik, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, September 2023 (SWP-Aktuell 55/2023), doi: 10.18449/2023A55.
- 45
-
Daniel Thym, Stellungnahme für die Öffentliche Anhörung des Innenausschusses des Deutschen Bundestags am Montag, den 27. März 2023 über Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, 27.3.2023, <https://www.bundestag.de/resource/blob/ 939830/8fccfba33bb2e47eaa26e8e24f8c3487/20-4-197-A-data.pdf> (eingesehen am 6.7.2023).
- 46
-
Arne Niemann/Natascha Zaun, »Introduction: EU External Migration Policy and EU Migration Governance: Introduction«, in: Journal of Ethnic and Migration Studies, 49 (2023) 12, S. 2965–2985. Zusätzlich schreiten zum Stand Februar 2024 nationale Vorhaben für eine Auslagerung von Asylverfahren in die europäische Nachbarschaft voran, wobei insbesondere ein neues Abkommen zwischen Italien und Albanien eine Vorreiterrolle einnehmen könnte.
- 47
-
Marie de Somer, »Schengen: Quo Vadis?«, in: European Journal of Migration and Law, 22 (2020) 2, S. 178–197.
- 48
-
»2023 State of Schengen: Achievements and Key Priorities«, Pressemitteilung, 31.5.2023, <https://home-affairs.ec. europa.eu/news/2023-state-schengen-achievements-and-key-priorities-2023-05-31_en> (eingesehen am 6.7.2023).
- 1
-
Annegret Bendiek/Minna Ålander/Paul Bochtler, GASP: Von der Ergebnis- zur Symbolpolitik. Eine datengestützte Analyse, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2020 (SWP-Aktuell 86/2020), doi: 10.18449/2020A86.
- 2
-
Winfried Nachtwei, »Lehren aus deutschen Krisenengagements gibt es reichlich – aber auch Lernfortschritte?«, in: SIRIUS – Zeitschrift für Strategische Analysen, 3 (2019) 4, S. 362–377, doi: 10.1515/sirius-2019-4004.
- 3
-
Im März 2023 zum Beispiel traf der ungarische Präsident Viktor Orbán den russischen Präsidenten Wladimir Putin als erster Staats- und Regierungschef der EU, seit Putin vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen angeklagt ist. Orbán untergräbt somit die Russland-Politik der EU. Gleichzeitig erschweren propalästinensische linke Kräfte in Spanien, aber auch in Frankreich, eine einheitliche europäische Position zum Krieg zwischen Israel und der Hamas.
- 4
-
European External Action Service, Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, 14.11.2016, <https:// www.eeas.europa.eu/eeas/global-strategy-european-unions-foreign-and-security-policy_en> (eingesehen am 4.11.2023).
- 5
-
Andreas Rinke/Jörn Poltz, »EU-Politiker fordern – Europa muss ›weltpolitik-fähig‹ werden«, Reuters, 18.2.2018, <https:// www.reuters.com/article/deutschland-sicherheitskonferenz-eu-idDEKCN1G20D9> (eingesehen am 30.6.2023).
- 6
-
Bettina Klein, »Außenpolitik der neuen EU-Kommission, Von der Leyen will mehr Europa in der Welt«, Deutschlandfunk, 2.12.2019, <https://www.deutschlandfunk.de/ aussenpolitik-der-neuen-eu-kommission-von-der-leyen-will-100.html> (eingesehen am 4.11.2023).
- 7
-
Ursula von der Leyen, State of the Union 2023, Brüssel: Europäische Kommission, 13.9.2023, <https://ec-europa-eu.eui.idm.oclc.org/commission/presscorner/detail/ov/speech_23_4426> (eingesehen am 4.11.2023).
- 8
-
European Council, A New Strategic Agenda 2019–2024, 20.6.2019, <https://www.consilium.europa.eu/de/european-council/role-setting-eu-political-agenda/> (eingesehen am 30.6.2023).
- 9
-
»Die Akteure der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU (GASP)«, Auswärtiges Amt (online), 2.5.2023, <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/europa/ aussenpolitik/gasp/-/201784> (eingesehen am 30.6.2023).
- 10
-
Nach Artikel 21 Absatz 1 sowie Artikel 24 EUV beschließt der Europäische Rat einstimmig auf Empfehlung des Rats in der GASP.
- 11
-
Siehe dazu den Beitrag von Markus Kaim, S. 93ff.
- 12
-
Riccardo Alcaro, The Constraints on the EU Foreign and Security Policy, Rom: Istituto Affari Internazionali, 2021, <https://www.iai.it/sites/default/files/joint_b_1.pdf> (eingesehen am 5.11.2023).
- 13
-
Eurobarometer survey commissioned by the European Parliament, Directorate-General for Communication, Public Opinion Monitoring Unit, Delivering on Europe. Citizen’s Views on Current and Future EU Action. Eurobarometer Survey 89.2 of the European Parliament. A Public Opinion Monitoring Study, Mai 2018, P E 621.866, <https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_ europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/ report.pdf> (eingesehen am 5.11.2023).
- 14
-
Annegret Bendiek/Minna Ålander/Paul Bochtler, Datenerhebung zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2020 (SWP-Arbeitspapier FG EU/Europa 02/2020), doi: 10.18449/2020AP02.
- 15
-
European Commission, Strategic Plan 2020–2024: Foreign Policy Instruments, Brüssel 2020, <https://commission.europa. eu/system/files/2020-10/fpi_sp_2020_2024_en.pdf> (eingesehen am 5.11.2023).
- 16
-
Christophe Hillion/Steven Blockmans, From Self-Doubt to Self-Assurance: The European External Action Service as the Indispensable Support for a Geopolitical EU, Brüssel: Centre for European Policy Studies (CEPS), Januar 2021 (CEPS Task Force Report), <https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/01/ TFR_EEAS-2_0-From-self-doubt-to-self-assurance.pdf> (eingesehen am 5.11.2023).
- 17
-
Stefan Lehne, Making EU Foreign Policy Fit for a Geopolitical World, Brüssel: Carnegie Europe, 14.4.2022, <https://carnegie europe.eu/2022/04/14/making-eu-foreign-policy-fit-for-geopolitical-world-pub-86886> (eingesehen am 5.11.2023).
- 18
-
Velina Lilyanova, Understanding EU Financing for External Action, Brüssel: European Parliamentary Research Service, Februar 2021, <https://www.europarl.europa.eu/RegData/ etudes/IDAN/2021/679101/EPRS_IDA(2021)679101_EN.pdf> (eingesehen am 5.11.2023).
- 19
-
European Commission, Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) – »Global Europe«, 9.6.2021, <https://international-partnerships.ec.europa.eu/ system/files/2021-07/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_en.pdf> (eingesehen am 5.11.2023).
- 20
-
»Definitive Adoption (EU, Euratom) 2022/182 of the European Union’s General Budget for the Financial Year 2022«, in: Official Journal of the European Union, (24.2.2022) L 45, S. 1–2039, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022B0182> (eingesehen am 5.11.2023).
- 21
-
Michal Malovec, EU-Außenpolitik: Ziele, Mechanismen und Ergebnisse, Europäisches Parlament, Oktober 2023, <https:// www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/158/eu-au %C3%9Fenpolitik-ziele-mechanismen-und-ergebnisse> (eingesehen am 5.11.2023).
- 22
-
Holger Romann, »Aus für ›Sophia‹, Marine-Operation ohne Schiffe«, Tagesschau, 27.3.2019, <https://www.tages schau.de/ausland/sophia-operation-101.html> (eingesehen am 5.11.2023).
- 23
-
Malovec, EU-Außenpolitik [wie Fn. 21].
- 24
-
European Parliament, Functioning of the EEAS and a Stronger EU in the World, P9_TA(2023)0077, 15.3.2023, <https:// www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0077_ EN.pdf> (eingesehen am 5.11.2023).
- 25
-
Vgl. EU Sanctions Map, <https://www.sanctionsmap.eu>, sowie Bendiek/Ålander/Bochtler, Datenerhebung zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union [wie Fn. 14].
- 26
-
Siehe den Beitrag von Markus Kaim, S. 96.
- 27
-
Annegret Bendiek/Ronja Kempin/Nicolai von Ondarza, Mehrheitsentscheidungen und Flexibilisierung in der GASP. Ein kritischer Blick auf Instrumente für eine effektivere EU-Außen- und Sicherheitspolitik, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Mai 2018 (SWP-Aktuell 31/2018).
- 28
-
Annalena Baerbock/Hadja Lahbib/Jean Asselborn/Wopke Hoekstra/Bogdan Aurescu/Tanja Fajon/José Manuel Albares Bueno, »It’s Time for More Majority Decision-making in EU Foreign Policy«, Politico (online), 12.6.2023, <https://www. politico.eu/article/eu-foreign-policy-ukraine-russia-war-its-time-for-more-majority-decision-making/> (eingesehen am 30.6.2023).
- 29
-
Bendiek/Kempin/von Ondarza, Mehrheitsentscheidungen und Flexibilisierung in der GASP [wie Fn. 27].
- 30
-
Nicole König, Towards QMV in EU Foreign Policy, Different Paths at Multiple Speeds, Berlin: Jacques Delors Centre, Oktober 2022 (Policy Brief), <https://www.delorscentre.eu/fileadmin/ 2_Research/1_About_our_research/2_Research_centres/6_ Jacques_Delors_Centre/Publications/20221014_Koenig_QMV_V1.pdf> (eingesehen am 5.11.2023).
- 31
-
Ebd.
- 32
-
Max Becker/Nicolai von Ondarza, Geostrategie von rechts außen: Wie sich EU-Gegner und Rechtsaußenparteien außen- und sicherheitspolitisch positionieren, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, März 2024 (SWP-Aktuell 8/2024), doi: 10.18449/ 2024A08.
- 33
-
Auswärtiges Amt, Gemeinsame Mitteilung der Außenministerien zum Start der Freundesgruppe für Qualifizierte Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, Berlin, Mai 2023, <https://www.auswaertiges-amt.de/ de/newsroom/-/2595302> (eingesehen am 4.3.2024).
- 1
-
European Council, A New Strategic Agenda 2019–2014, <https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf> (Übersetzung des Autors).
- 2
-
Vgl. Jasper Kamradt, »Was wird aus der Beistandsklausel der EU? Zum Stand der EU-Beistandsklausel nach dem NATO‑Beitritt Finnlands und Schweden«, in: Völkerrechtsblog, 8.8.2022, <https://voelkerrechtsblog.org/was-wird-aus-der-beistandsklausel-der-eu/>; vgl. auch Jana Puglierin, »Alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung«. Die EU-Beistandsklausel als Testfall für die europäische Verteidigung, Berlin: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), 2016 (DGAP Kompakt, Nr. 18), <https://dgap.org/system/files/ article_pdfs/2016-18-puglierin_die_eu-beistandsklausel_ als_testfall_fuer_die_europaeische_verteidigung.pdf>.
- 3
-
Tatsächlich findet sich die Zuschreibung »ESVU« in verschiedenen Initiativen und Papieren. So wurde und wird zum Teil die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit im Rahmen der GSVP als ESVU bezeichnet. Dabei sind solche Formulierungen jedoch vor allem politisch zu lesen. Analytisch sind sie bedeutungslos, denn ohne eine ernst gemeinte Vergemeinschaftungsperspektive im Sinne der Währungsunion ist die Nutzung des Begriffs »Union« sinnlos.
- 4
-
Vgl. dazu ausführlich Daniel Thym, »The Intergovernmental Constitution of the EU’s Foreign, Security & Defence Executive«, in: European Constitutional Law Review, 7 (2011) 3, S. 453–481.
- 5
-
Artikel 42 Absatz 4 EUV: »Beschlüsse zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, einschließlich der Beschlüsse über die Einleitung einer Mission nach diesem Artikel, werden vom Rat einstimmig auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik oder auf Initiative eines Mitgliedstaats erlassen.«
- 6
-
Vgl. dazu Bernhard Rinke, »Formen differenzierter Integration und ihre Konsequenzen in der GASP/GSVP«, in: Eckart D. Stratenschulte (Hg.), Der Anfang vom Ende? Formen differenzierter Integration und ihre Konsequenzen, Baden-Baden 2015, S. 165–185.
- 7
-
Bundesverfassungsgerichtsentscheidung (BVerfGE) 123, 267 Rn. 381.
- 8
-
Siehe zuletzt Flash Eurobarometer 506, EU’s Response to the War in Ukraine, Mai 2022. <https://europa.eu/eurobarometer/ surveys/detail/2772>.
- 9
-
Vgl. dazu die Beiträge in: Barbara Lippert/Nicolai von Ondarza/Volker Perthes (Hg.), Strategische Autonomie Europas. Akteure, Handlungsfelder, Zielkonflikte, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Februar 2019 (SWP-Studie 2/2019), doi: 10.18449/2019S02.
- 10
-
Vgl. Jolyon Howorth, »The EU’s Security and Defence Policy: A New Leap Forward?«, in: Christopher Hill/Michael Smith/Sophie Vanhoonacker (Hg.), International Relations and the European Union, 4. Aufl., Oxford 2023, S. 305–326 (323f).
- 11
-
Vgl. Jonathan Swan/Charlie Savage/Maggie Haberman, »Fears of a Nato Withdrawal Rise as Trump Seeks a Return to Power«, in: New York Times, 9.12.2023.
- 12
-
Vgl. ausführlich Benjamin Martill/Carmen Gebhard, »Combined Differentiation in European Defense: Tailoring Permanent Structured Cooperation (PESCO) to Strategic and Political Complexity«, in: Contemporary Security Policy, 44 (2023) 1, S. 97–124, sowie Anneke Houdé/Ramses A Wessel, »A Common Security and Defence Policy: Limits to Differentiated Integration in PESCO?«, in: European Papers, 7 (2022) 3, S. 1325–1356.
- 13
-
Vgl dazu ausführlich Council of the European Union, »Council Recommendation of 14 November 2022 assessing the progress made by the participating Member States to fulfil commitments undertaken in the framework of the permanent structured cooperation (PESCO) – (2022/C 433/02)«, in: Official Journal of the European Union, (15.11.2022) C 433, S. 6–12, <https://www.pesco.europa.eu/wp-content/ uploads/2022/11/Council-Recommendation-Progress-made-by-pMS-to-fulfil-commitments-undertaken-in-PESCO.pdf>.
- 14
-
Vgl. Ulrich Krotz/Katerina Wright, »CSDP Military Operations«, in: Hugo Meijer/Marco Wyss (Hg.), The Handbook of European Defence Policies & Armed Forces, Oxford 2018, S. 870–887.
- 15
-
Vgl. »Beschluss (GASP) 2024/632 des Rates vom 19. Februar 2024 zur Einleitung der Operation der Europäischen Union der maritimen Sicherheit zur Wahrung der Freiheit der Schifffahrt im Zusammenhang mit der Krise im Roten Meer (EUNAVFOR ASPIDES)«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (20.2.2024), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400632>.
- 16
-
Vgl. Daniel Fiott, »In Every Crisis an Opportunity? European Union Integration in Defence and the War on Ukraine«, in: Journal of European Integration, 45 (2023) 3, S. 447–462.
- 17
-
Vgl. Alexander Melzer, »EU Military Mission Is Coming Home: On the New European Union Military Assistance Mission in Support of Ukraine«, Verfassungsblog, 19.10.2022, <https://verfassungsblog.de/eu-military-mission-is-coming-home/>.
- 18
-
Vgl. Thomas Gutschker, »Mehr Hilfe als erwartet«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.2.2024.
- 19
-
Ein Strategischer Kompass für Sicherheit und Verteidigung – Für eine Europäische Union, die ihre Bürgerinnen und Bürger, Werte und Interessen schützt und zu Weltfrieden und internationaler Sicherheit beiträgt, 21.3.2022, <https://data.consilium.europa.eu/doc/ document/ST-7371-2022-INIT/de/pdf>.
- 20
-
Vgl. zur Umsetzung Annual Progress Report on the Implementation of the Strategic Compass for Security and Defence. Report of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy to the Council, März 2023, <https://www.eeas.europa. eu/sites/default/files/documents/2023/StrategicCompass_ 1stYear_Report.pdf>.
- 21
-
Vgl. dazu Florence Ertel/Daniel Göler, »Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik«, in: Werner Weidenfeld/Wolfgang Wessels (Hg.), Jahrbuch der Europäischen Integration 2022, Baden-Baden 2022, S. 353–358.
- 22
-
Vgl. Calle Håkansson, »The European Commission’s New Role in EU Security and Defence Cooperation: The Case of the European Defence Fund«, in: European Security, 30 (2021) 4, S. 589–608, sowie Pierre Haroche, »Supranationalism Strikes Back: A Neofunctionalist Account of the European Defence Fund«, in: Journal of European Public Policy, 27 (2020) 6, S. 853–872.
- 23
-
Vgl. Ursula von der Leyen/Friedrich Merz, »Eine Verteidigungsunion schaffen. Welche Konsequenzen Europa aus zwei Jahren Ukrainekrieg ziehen muss«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24.2.2024.
- 24
-
Vgl. European Defence Industrial Strategy Fact Sheet, 5.3.2024, <https://defence-industry-space.ec.europa.eu/document/ download/333faee1-a851-44a6-965b-713247515d39_en? filename=DEFIS_EDIS_factsheet.pdf>.
- 1
-
Anne Faber, »Die Weiterentwicklung der Europäischen Union: Vertiefung versus Erweiterung?«, in: Integration, 30 (2007) 2, S. 103–116; Frank Schimmelfennig/Ulrich Sedelmeier, »Theorizing EU Enlargement: Research Focus, Hypotheses, and the State of Research«, in: Journal of European Public Policy, 9 (2002) 4, S. 500–528.
- 2
-
»Failing Forward in Eastern Enlargement: Problem Solving through Problem Making«, in: Journal of European Public Policy, 29 (2022) 7, S. 1092–1111.
- 3
-
»Wartime EU: Consequences of the Russia-Ukraine War on the Enlargement Process«, in: Journal of European Integration, 45 (2023) 3, S. 487–501.
- 4
-
Der Westbalkan besteht aus sechs Staaten: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nord-Mazedonien und Serbien.
- 5
-
Suzanne Lynch/Jacopo Barigazzi, »Is Turkey Now Joining the EU? No, But the EU Is Engaging«, Politico, 13.7.2023, <https://www.politico.eu/article/is-turkey-now-joining-the-eu-no-but-the-eu-is-engaging-nato/> (eingesehen am 21.7.2023).
- 6
-
»Wider and Deeper? Enlargement and Integration in the European Union«, in: Journal of European Public Policy, 21 (2014) 5, S. 647–663; »Mind the Gap! European Integration between Level and Scope«, in: Journal of European Public Policy, 12 (2005) 2, S. 217–236.
- 7
-
Gjergj Erebara, »Fatigued EU Downgrades Enlargement Portfolio«, in: Balkan Insight, 11.9.2014, <https://balkan insight.com/2014/09/11/eu-downgrades-its-enlargement-portfolio-1/> (eingesehen am 21.7.2023).
- 8
-
European Commission, A Credible Enlargement Perspective for and Enhanced EU Engagement with the Western Balkans, Straßburg, 6.2.2018, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/ publication/d284b8de-0c15-11e8-966a-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search> (eingesehen am 21.7.2023).
- 9
-
Jahja Muhasilovic, »From Thessaloniki to Sofia: Western Balkans’ European Journey«, Anadolu Agency, 19.5.2018, <https://www.aa.com.tr/en/analysis-news/from-thessaloniki-to-sofia-western-balkans-european-journey/1151262> (eingesehen am 21.7.2023).
- 10
-
Alice Tidey/Lauren Chadwick/Efi Koutsokosta, »›A Grave Historic Error‹: Juncker Hits Out as North Macedonia and Albania Have EU Bids Blocked«, Euronews, 18.10.2019, <https://www.euronews.com/my-europe/2019/10/18/france-denmark-and-netherlands-block-albania-s-eu-membership-bid> (eingesehen am 21.7.2023).
- 11
-
European Commission, Enhancing the Accession Process – A Credible EU Perspective for the Western Balkans, Brüssel, 5.2.2020, <https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/ files/2020-02/enlargement-methodology_en.pdf> (eingesehen am 21.7.2023).
- 12
-
Margit Wunsch Gaarmann/Marina Vulović, Europäische Politische Gemeinschaft: Chancen für den Westbalkan, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 22.6.2023 (SWP Kurz gesagt), <https://www.swp-berlin.org/publikation/europaeische-politische-gemeinschaft-chancen-fuer-den-westbalkan> (eingesehen am 21.7.2023).
- 13
-
Anna Szołucha, »The EU and ›Enlargement Fatigue‹: Why Has the European Union Not Been Able to Counter ›Enlargement Fatigue‹?«, in: Journal of Contemporary European Research, 6 (2010) 1, <https://www.jcer.net/index.php/jcer/ article/download/124/192/1215>; nach Artikel 88-5 der französischen Verfassung kann auf das Referendum im Falle einer Dreifünftel-Mehrheit im Parlament verzichtet werden. Auch in den Niederlanden kann das Parlament neue EU-Beitritte ratifizieren, jedoch wird ein Referendum die wahrscheinliche Option im Hinblick auf zukünftige Erweiterungen sein.
- 14
-
European Commission, Standard Eurobarometer 97 – Summer 2022: Europeans’ Opinions about the European Union’s Priorities, Brüssel, September 2022, S. 20–21, <https:// webgate.ec.europa.eu/ebsm/api/public/deliverable/download?doc=true&deliverableId=84078> (eingesehen am 21.7.2023).
- 15
-
John O’ Brennan, »On the Slow Train to Nowhere? The European Union, ›Enlargement Fatigue‹ and the Western Balkans«, in: European Foreign Affairs Review, 19 (2014) 2, S. 221–242.
- 16
-
Jelena Džankić/Soeren Keil/Marko Kmezić, »Introduction: The Europeanisation of the Western Balkans«, in: Jelena Džankić/Soeren Keil/Marko Kmezić (Hg.), The Europeanisation of the Western Balkans: A Failure of EU Conditionality?, Cham: Palgrave Macmillan, 2019.
- 17
-
Frank Schimmelfennig/Ulrich Sedelmeier, »Conclusion: The Impact of the EU on the Accession Countries«, in: Frank Schimmelfennig/Ulrich Sedelmeier (Hg.), The Europeanization of Central and Eastern Europe, Ithaca/London: Cornell University Press, 2005, S. 210–282.
- 18
-
Erwan Fouéré, Can the War in Ukraine Revive the EU’s Enlargement Agenda for the Western Balkans?, Brüssel: Centre for European Policy Studies (CEPS), März 2022 (CEPS Policy Insights), <https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2022/ 03/PI2022-11_Can-the-war-in-Ukraine-revive-the-EUs-enlargement.pdf> (eingesehen am 21.7.2023); Tanja A. Börzel, When Europeanization Hits Limited Statehood: The Western Balkans as a Test Case for the Transformative Power of Europe, Freie Universität Berlin, September 2011 (KFG Working Paper Series 30), <http://userpage.fu-berlin.de/kfgeu/kfgwp/wpseries/ WorkingPaperKFG_30.pdf> (eingesehen am 21.7.2023).
- 19
-
Florian Bieber, »Patterns of Competitive Authoritarianism in the Western Balkans«, in: East European Politics, 34 (2018) 3, S. 337–354.
- 20
-
European Commission, Enhancing the Accession Process [wie Fn. 11].
- 21
-
Michael Emerson/Milena Lazarević/Steven Blockmans/ Strahinja Subotić, A Template for Staged Accession to the EU, Brüssel: CEPS/Belgrad: European Policy Centre (CEP), Mai 2022, <https://cep.org.rs/wp-content/uploads/2023/01/A-Template-for-Staged-Accession-to-the-EU.pdf> (eingesehen am 21.7.2023).
- 22
-
Gerald Knaus, Action Plan for the Western Balkans and EU Neighborhood: How Germany Can Contribute to Lasting Peace in the Balkans, Berlin: Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Oktober 2021, <https://dgap.org/en/research/ publications/action-plan-western-balkans-and-eu-neighbor hood> (eingesehen am 21.7.2023).
- 23
-
Lili Bayer, »EU Chief Unveils New Western Balkans Support Plan«, Politico, 31.5.2023, <https://www.politico.eu/ article/von-der-leyen-unveils-plan-support-western-balkans/> (eingesehen am 21.7.2023).
- 24
-
Europäische Kommission, »Statement by President von der Leyen at the joint press conference with Albanian Prime Minister Rama and German Chancellor Scholz«, Pressemitteilung, Tirana, 16.10.2023, <https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/en/statement_23_5044> (eingesehen am 1.12.2023).
- 25
-
Julina Mintel/Nicolai von Ondarza, Mehr EU-Mehrheitsentscheidungen – aber wie? Rechtliche und politische Möglichkeiten zur Ausweitung des Mehrheitsprinzips, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Oktober 2022 (SWP-Aktuell 60/2022), doi: 10.18449/2022A60.
- 26
-
Olivier Costa/Daniela Schwarzer/Pervenche Berès/Gilles Gressani/Gaëlle Marti/Franz Mayer/Thu Nguyen/Nicolai von Ondarza/Sophia Russack/Funda Tekin/Shahin Vallée/ Christine Verger, Unterwegs auf hoher See: Die EU für das 21. Jahrhundert reformieren und erweitern, Berlin/Paris, September 2023, <https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2627316/386102116 ff34689169fb8df7ef63ec5/230919-deu-fra-bericht-data.pdf> (eingesehen am 9.11.2023).
- 27
-
Auswärtiges Amt, »Joint Statement of the Foreign Ministries on the Launch of the Group of Friends on Qualified Majority Voting in EU Common Foreign and Security Policy«, Pressemitteilung, Berlin, 4.5.2023, <https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/-/2595304> (eingesehen am 21.7.2023).
- 28
-
Europäische Kommission, »Statement by President von der Leyen at the Joint Press Conference with Albanian Prime Minister Rama and German Chancellor Scholz« [wie Fn. 24].
- 29
-
Chiara Swaton, »Österreich will EU-Beitritt von Westbalkanländern beschleunigen«, Euractiv (online), 22.6.2023, <https://www.euractiv.de/section/europa-kompakt/news/ oesterreich-will-eu-beitritt-von-westbalkanlaendern-beschleunigen/> (eingesehen am 21.7.2023).
- 30
-
Europäischer Rat, »The Granada Declaration«, Pressemitteilung, Granada, 6.10.2023, <https://www.consilium. europa.eu/en/press/press-releases/2023/10/06/granada-declaration/> (eingesehen am 9.11.2023).
- 31
-
Europäischer Rat, »Speech by President Charles Michel at the Bled Strategic Forum«, Pressemitteilung, Bled, 28.8.2023, <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/08/28/speech-by-president-charles-michel-at-the-bled-strategic-forum/> (eingesehen am 9.11.2023).
- 1
-
Siehe beispielsweise Wolfgang Münchau, »The Eurozone Really Has Only Days to Avoid Collapse«, in: Financial Times (online), 27.11.2011, <https://www.ft.com/content/d9a299a8-1760-11e1-b00e-00144feabdc0> (eingesehen am 14.8.2023); oder auch Wolfgang Münchau, »Lack of European Reform, Not Italy, Will Break the Eurozone«, in: Financial Times (online), 3.6.2018, <https://www.ft.com/content/40f01aec-65af-11e8-a39d-4df188287fff> (eingesehen am 14.8.2023).
- 2
-
Stefanie Walter, »Brexit Domino? The Political Contagion Effects of Voter-endorsed Withdrawals from International Institutions«, in: Comparative Political Studies, 54 (2021) 13, S. 2382–2415, doi: 10.1177/0010414021997169.
- 3
-
Elisabeth Braw, »The EU Is Abandoning Italy in Its Hour of Need«, in: Foreign Policy (online), 14.3.2020, <https:// foreignpolicy.com/2020/03/14/coronavirus-eu-abandoning-italy-china-aid/> (eingesehen am 14.8.2023).
- 4
-
Erik Jones/R. Daniel Kelemen/Sophie Meunier, »Failing Forward? Crises and Patterns of European Integration«, in: Journal of European Public Policy, 28 (2021) 10, S. 1519–1536, doi: 10.1080/13501763.2021.1954068.
- 5
-
Siehe R. Daniel Kelemen/Kathleen R. McNamara, »State-Building and the European Union: Markets, War, and Europe’s Uneven Political Development«, in: Comparative Political Studies, 55 (2022) 6, S. 963–991, doi: 10.1177/ 00104140211047393.
- 6
-
Nicolai von Ondarza, Und ewig droht die Vertragsänderung?, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2015, (SWP-Aktuell 89/2015), <https://www.swp-berlin.org/ publications/products/aktuell/2015A89_orz.pdf> (eingesehen am 31.10.2023).
- 7
-
Europäische Union (EU), Conference on the Future of Europe. Report on the Final Outcome, Mai 2022, <https://www.europarl. europa.eu/resources/library/media/20220509RES29121/20220509RES29121.pdf> (eingesehen am 14.8.2023).
- 8
-
European Parliament Resolution of 9 June 2022 on the Call for a Convention for the Revision of the Treaties, 9.6.2022, <https:// www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0244_EN.html> (eingesehen am 14.8.2023).
- 9
-
@SwedeninEU, Tweet vom 9.5.2022, <https://twitter.com/ SwedeninEU/status/1523637827686531072> (eingesehen am 14.8.2023).
- 10
-
Nicolai von Ondarza, »Auf dem Weg zur Union in der Union. Institutionelle Auswirkungen der differenzierten Integration in der Eurozone auf die EU«, in: Integration, 36 (2013) 1, S. 17–33, doi: 10.5771/0720-5120-2013-1-17.
- 11
-
Siehe Nicolai von Ondarza, Die Krisengovernance der Europäischen Union. Mehr Verantwortung braucht mehr demokratische Legitimation, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, April 2023 (SWP-Studie 4/2023), doi: 10.18449/2023S04.
- 12
-
Benjamin Martill/Carmen Gebhard, »Combined Differentiation in European Defense: Tailoring Permanent Structured Cooperation (PESCO) to Strategic and Political Complexity«, in: Contemporary Security Policy, 44 (2022) 1, S. 97–124, doi: 10.1080/13523260.2022.2155360.
- 13
-
Frank Schimmelfennig/Funda Tekin, »Die differenzierte Integration und die Zukunft der Europäischen Union: Konsolidierung, Krisen und Erweiterung«, in: Integration, 46 (2023) 2, S. 94–114, doi: 10.5771/0720-5120-2023-2-94.
- 14
-
Zur Diskussion um das »Neue« im neuen Intergouvernementalismus siehe Frank Schimmelfennig, »What’s the News in ›New Intergovernmentalism‹? A Critique of Bickerton, Hodson and Puetter«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 53 (2015) 4, S. 723–730, doi: 10.1111/jcms.12234.
- 15
-
Derek Beach/Sandrino Smeets, »New Institutionalist Leadership – How the New European Council-Dominated Crisis Governance Paradoxically Strengthened the Role of EU Institutions«, in: Journal of European Integration, 42 (2020) 6, S. 837–854, doi: 10.1080/07036337.2019.1703966.
- 16
-
Edoardo Bressanelli/Nicola Chelotti, »The Shadow of the European Council. Understanding Legislation on Economic Governance«, in: Journal of European Integration, 38 (2016) 5, S. 511–525, doi: 10.1080/07036337.2016.1178251.
- 17
-
Stefan Lehne, »The Comeback of the European Commission«, Carnegie Europe (online), 24.4.2023, <https://carnegie europe.eu/2023/04/24/comeback-of-european-commission-pub-89577> (eingesehen am 14.8.2023).
- 18
-
Siehe von Ondarza, Die Krisengovernance der Europäischen Union [wie Fn. 11].
- 19
-
Nicolai von Ondarza, Das Europäische Parlament und die Corona-Pandemie. In der Krise ist das EP meist Zuschauer, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, September 2022 (SWP-Aktuell 77/2022), doi: 10.18449/2020A77.
- 20
-
Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten von Eur-Lex.
- 21
-
Eigene Berechnung auf Grundlage der Daten des Europäischen Parlaments. Zur Kontroverse um das Trilog-Verfahren siehe z. B. Gijs Jan Brandsma/Justin Greenwood/Ariadna Ripoll Servent/Christilla Roederer-Rynning, »Inside the Black Box of Trilogues: Introduction to the Special Issue«, in: Journal of European Public Policy, 28 (2021) 1, S. 1–9, doi: 10.1080/ 13501763.2020.1859600.
- 22
-
Wichtigste Ausnahmen sind Beschlüsse zur Wahl des Präsidenten bzw. der Präsidentin des Europäischen Rates (Art. 15 [5] EUV), zur Ernennung des Kandidaten bzw. der Kandidatin für das Amt der Kommissionpräsidentin bzw. Präsidenten (Art. 17 [7] EUV) sowie zur Einberufung eines Konvents (Art. 48 [3] EUV).
- 23
-
Eigene Berechnung auf Basis der öffentlichen Abstimmungsprotokolle des Rates der EU. Siehe SWP EU Council Monitor, verfügbar unter <https://www.swp-berlin.org/en/ publication/eu-council-monitor>.
- 24
-
Robert Böttner, »The Commission’s Initiative on the Passerelle Clauses – Exploring the Unused Potential of the Lisbon Treaty«, in: ZEuS: Zeitschrift für Europarechtliche Studien, 23 (2020) 3, doi: 10.5771/1435-439X-2020-3-489.
- 25
-
Annalena Baerbock/Hadja Lahbib/Jean Asselborn/Wopke Hoekstra/Bogdan Aurescu/Tanja Fajon/José Manuel Albares Bueno, »It’s Time for More Majority Decision-Making in EU Foreign Policy«, Politico (online), 12.6.2023, <https://www. politico.eu/article/eu-foreign-policy-ukraine-russia-war-its-time-for-more-majority-decision-making/> (eingesehen am 14.8.2023).
- 26
-
Julina Mintel/Nicolai von Ondarza, Mehr EU-Mehrheitsentscheidungen – aber wie? Rechtliche und politische Möglichkeiten zur Ausweitung des Mehrheitsprinzips, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Oktober 2022 (SWP-Aktuell 60/2022), doi: 10.18449/2022A60.
- 27
-
Ariadna Ripoll Servent, »The European Parliament after the 2019 Elections: Testing the Boundaries of the ›Cordon Sanitaire‹«, in: Journal of Contemporary European Research, 15 (2019) 4, doi: 10.30950/jcer.v15i4.1121.
- 28
-
Hussein Kassim, »The European Commission and the Covid-19 Pandemic: A Pluri-Institutional Approach«, in: Journal of European Public Policy, 30 (2022) 4, S. 612–634, doi: 10.1080/13501763.2022.2140821.
- 29
-
Zu aktuellen Projektionen für die Europawahl 2024 siehe Politico Poll of Polls, <https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/european-parliament-election/>, oder Europe Elects, <https://europeelects.eu/ep2024/>.
- 30
-
Die Bundesregierung, »Rede von Bundeskanzler Scholz an der Karls-Universität am 29. August 2022 in Prag«, <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzler-scholz-an-der-karls-universitaet-am-29-august-2022-in-prag-2079534> (eingesehen am 14.8.2023).
- 31
-
Olivier Costa/Daniela Schwarzer/Pervenche Berès/Gilles Gressani/Gaëlle Marti/Franz Mayer/Thu Nguyen/Nicolai von Ondarza/Sophia Russack/Funda Tekin/Shahin Vallée/Christine Verger, Unterwegs auf hoher See: Die EU für das 21. Jahrhundert reformieren und erweitern, Bericht der Deutsch-Französischen Arbeitsgruppe zu Institutionellen Reformen der EU, September 2023, <https://www.auswaertiges-amt.de/blob/ 2627316/386102116ff34689169fb8df7ef63ec5/230919-deu-fra-bericht-data.pdf> (eingesehen am 31.10.2023).
- 32
-
Europäischer Rat, »Die Erklärung von Granada«, Pressemitteilung, 6.10.2023, <https://www.consilium.europa.eu/ de/press/press-releases/2023/10/06/granada-declaration/> (eingesehen am 31.10.2023).
- 1
-
Philipp Genschel/Markus Jachtenfuchs, »From Market Integration to Core State Powers: The Eurozone Crisis, the Refugee Crisis and Integration Theory«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 56 (2018) 1, S. 178–196.
- 2
-
Sie müssen dies aber nicht zwangsläufig. Krisen können auch das Gegenteil bewirken, indem sie Renationalisierung begünstigen, da die Mitgliedstaaten und speziell deren Exekutiven zu zentralen Akteuren mit der Fähigkeit zu schneller Krisenreaktion werden können.
- 3
-
Siehe den Beitrag von Peter Becker, S. 17ff.
- 4
-
Miroslava Pisklová, QMV in CFSP: Impending Necessity or Resurfacing Utopia?, Think Visegrad, V4 Think-tank Platform, 2023, <https://europeum.org/data/articles/pisklova-intempl-final.pdf>.
- 5
-
Joint Statement by France, Germany, Italy, Netherlands and Spain, Prag, 9.9.2022, <https://www.bundesfinanzministe rium.de/Content/DE/Downloads/Steuern/g5-statement-global-minimum-effective-taxation.pdf?__blob=publication File&v=6> (eingesehen am 20.11.2023).
- 6
-
Der Anteil nicht einvernehmlicher Voten bei Ratsabstimmungen, die zwischen 2010 und 2021 mittels qualifizierten Mehrheitsentscheidungen (QMV) erfolgten, erreichte zwei Höhepunkte: 2014 und 2019. Sie schwanken somit nicht in Abhängigkeit von der ungebrochen hohen Krisendynamik. Ursächlich war für den Abfall nach 2019 vermutlich primär der Brexit. Arash Pourebrahimi/ Madeleine O. Hosli/Peter van Roozendaal, »Explaining Contestation, Votes in the Council of the European Union. Studies in Choice and Welfare«, in: Sascha Kurz/Nicola Maaser/Alexander Mayer (Hg.), Advances in Collective Decision Making, Cham 2023, S. 301–319 (307).
- 7
-
Vgl. Julina Mintel/Nicolai von Ondarza, Mehr EU-Mehrheitsentscheidungen – aber wie? Rechtliche und politische Möglichkeiten zur Ausweitung des Mehrheitsprinzips, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Oktober 2022 (SWP-Aktuell 60/2022), doi: 10.18449/2022A60.
- 8
-
Vgl. den Beitrag von Marina Vulović, S. 103ff.
- 9
-
Vgl. Ulrich Kotz/Lucas Schramm, »Embedded Bilateralism, Integration Theory, and European Crisis Politics: France, Germany, and the Birth of the EU Corona Recovery Fund«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 60 (2022) 3, S. 526–544.
- 10
-
Vgl. Kai-Olaf Lang/Nicolai von Ondarza, Neue Freunde in der Not: Die Corona-Pandemie verschiebt das Gruppengefüge in der EU, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Mai 2020 (SWP-Aktuell 39/2020), doi: 10.18449/2020A39.
- 11
-
Zur Kritik an den Neufassungen von Intergouvernementalismus und Supranationalismus bei gleichzeitigem Versuch, einen »Neo-Parlamentarismus« zu entwickeln, vgl. Vivien A. Schmidt, »Rethinking EU Governance: From ›Old‹ to ›New‹ Approaches to Who Steers Integration«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 56 (2018) 7, S. 1544–1561; zu Inkonsistenzen im »neuen Intergouvernementalismus« siehe auch Frank Schimmelfennig, »What’s the News in ›New Intergovernmentalism‹? A Critique of Bickerton, Hodson and Puetter«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 53 (2015) 4, S. 723–730.
- 12
-
Siehe den Beitrag von Raphael Bossong, S. 73ff.
- 13
-
Siehe den Beitrag von Lasse Michael Böhm, S. 35ff.
- 14
-
Christian Hillgruber, »Weniger ist mehr – Plädoyer für eine Begrenzung der Kompetenzen der EU zwecks Wiederherstellung einer föderalen Balance«, in: Stefan Kadelbach (Hg.), Die Europäische Union am Scheideweg: mehr oder weniger Europa?, Baden-Baden 2015, S. 29–48 (29).
- 15
-
»While basic constitutional features of the European Union have remained stable, EU activity has expanded to an unprecedented degree«, vgl. Christopher J. Bickerton/Dermot Hodson/Uwe Puetter, »The New Intergovernmentalism: European Integration in the Post-Maastricht Era«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 53 (2015) 4, S. 703–722 (703).
- 16
-
Zum »Neuen Supranationalismus« vgl. Schmidt, »Rethinking EU Governance « [wie Fn. 11].
- 17
-
Jenny Preunkert/Georg Vobruba, »Eurokrise und Corona-Krise im Vergleich. Warum in der Corona-Pandemie Gemeinschaftsanleihen eingeführt wurden«, in: Johannes Kiess u. a. (Hg.), Krisen und Soziologie, Weinheim/Basel 2023, S. 163–182.
- 18
-
Siehe den Beitrag von Felix Schenuit, S. 43ff.
- 19
-
Siehe den Beitrag von Paweł Tokarski, S. 25ff.
- 20
-
»After the Treaty of Lisbon reforms this supranational vs. intergovernmental categorisation seems increasingly obsolete as supranational and intergovernmental elements are now so intermingled and the distinction at least partially diluted that they are difficult to apply to the institutional reality.« Jörg Monar, »The European Union’s Institutional Balance of Power after the Treaty of Lisbon«, in: European Commission (Hg.), The European Union after the Treaty of Lisbon: Visions of Leading Policy-Makers, Academics and Journalists, Luxemburg 2011, S. 60–89 (88).
- 21
-
Klassische Überlegungen, die den Dualismus von Supranationalismus und Intergouvernementalismus überwinden, wie etwa Elemente des fusionstheoretischen Denkens, können hier – neu kontextualisiert – bei der künftigen Analyse hilfreich sein. Vgl. Marieke Eckhardt/Wolfgang Wessels, »The European Commission – Agent, Principal and Partner to the European Council?«, in: Jörn Ege/Michael Bauer/Stefan Becker (Hg.), The European Commission in Turbulent Times: Assessing Organizational Change and Policy Impact, Baden-Baden 2018, S. 31–50.
- 22
-
Fritz Scharpf, »Das Dilemma der supranationalen Demokratie in Europa«, in: Leviathan. Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 43 (2015) 1, S. 11–28.
- 1
-
Luca Carrieri, »Awakening the Europhile Giant: EU Issue Voting in Western and Central-Eastern Europe«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 62 (2024) 1, S. 262–284, doi: 10.1111/jcms.13493.
- 2
-
Sergio Fabbrini/Tiziano Zgaga, »Right-Wing Sovereignism in the European Union: Definition, Features and Implications«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 62 (2024) 2, S. 341–359, doi: 10.1111/jcms.13497. Die meisten Rechtsaußen-Parteien haben von Forderungen nach EU-Austritten Abstand genommen, bedeutende Ausnahme ist die Alternative für Deutschland.
- 3
-
Erik Jones/R. Daniel Kelemen/Sophie Meunier, »Failing Forward? Crises and Patterns of European Integration«, in: Journal of European Public Policy, 28 (2021) 10, S. 1519–1536.
- 4
-
Non-paper by Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovenia, and Sweden on the Outcome of and Follow-up to the Conference on the Future of Europe, 9.5.2022, <https://twitter.com/Sweden inEU/status/1523637827686531072> (eingesehen am 18.3.2024).
- 5
-
Dermot Hodson/Uwe Puetter, »The European Union in Disequilibrium: New Intergovernmentalism, Postfunctionalism and Integration Theory in the Post-Maastricht Period«, in: Journal of European Public Policy, 26 (2019) 8, S. 1153–1171.
- 6
-
Jonathan Zeitlin u. a., »Introduction: The European Union beyond the Polycrisis? Integration and Politicization in an Age of Shifting Cleavages«, in: Journal of European Public Policy, 26 (2019) 7, S. 963–976.
- 7
-
Wouter van der Brug u. a., »Electoral Responses to the Increased Contestation over European Integration. The European Elections of 2019 and Beyond«, in: European Union Politics, 23 (2022) 1, S. 3–20.
- 8
-
Arthur Benz, »Politikverflechtung ohne Politikverflechtungsfalle – Koordination und Strukturdynamik im europäischen Mehrebenensystem«, in: Politische Vierteljahresschrift, 39 (1998) 3, S. 558–589; Fritz Scharpf, »The Joint-Decision Trap Revisited«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 44 (2006) 4, S. 845–864.
- 9
-
Philipp Genschel/Markus Jachtenfuchs, »From Market Integration to Core State Powers: The Eurozone Crisis, the Refugee Crisis and Integration Theory«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 56 (2018) 1, S. 178–196.
- 10
-
Kathleen R. McNamara, »Transforming Europe? The EU’s Industrial Policy and Geopolitical Turn«, in: Journal of European Public Policy, (2023), S. 1–26.
- 11
-
Federico Fabbrini, EU Fiscal Capacity. Legal Integration after Covid-19 and the War in Ukraine, Oxford 2022.
- 12
-
Martin Moland, »Constraining Dissensus and Permissive Consensus: Variations in Support for Core State Powers«, in: West European Politics, 46 (2023) 6, S. 1133–1155.
- 13
-
Tanja A. Börzel, »From EU Governance of Crisis to Crisis of EU Governance: Regulatory Failure, Redistributive Conflict and Eurosceptic Publics«, in: JCMS: Journal of Common Market Studies, 54 (2016) S1, S. 8–31.
- 14
-
Antonio-Martín Porras-Gómez, »The EU Recovery Instrument and the Constitutional Implications of Its Expenditure«, in: European Constitutional Law Review, 19 (2023) 1, S. 1–24; Yichen Zhong/Helena Carrapico, »The Development of Frontex: Integration through Supranationalism«, in: European Politics and Society, (2023), S. 1–16.
- 15
-
Sergio Fabbrin, »Brussels in Hard Times: The EU’s Executive Deficit«, in: Annette Bongardt/Francisco Torres (Hg.), The Political Economy of Europe’s Future and Identity: Integration in Crisis Mode, Florenz 2023, S. 43–52.
- 16
-
Nicolai von Ondarza, Die Krisengovernance der Europäischen Union, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, April 2023 (SWP-Studie 4/2023), doi: 10.18449/2023S04.
- 17
-
R. D. Kelemen/Tommaso Pavone, »Where Have the Guardians Gone? Law Enforcement and the Politics of Supranational Forbearance in the European Union«, in: World Politics, 75 (2023) 4, S. 779–825.
- 18
-
Daniela Schwarzer u. a., Sailing on High Seas Reforming and Enlarging the EU for the 21st Century. Report of the Franco-German Working Group on EU Institutional Reform, 18.9.2023, <https:// www.auswaertiges-amt.de/blob/2617206/4d0e0010ffcd8c 0079e21329bbbb3332/230919-rfaa-deu-fra-bericht-data.pdf> (eingesehen am 27.10.2023).
- 19
-
European Commission, Commission Work Programme 2023, o. D., <https://commission.europa.eu/strategy-documents/commission-work-programme/commission-work-programme-2023_en> (eingesehen am 9.11.2023)
- 20
-
Gegenüber Georgien hat der Europäische Rat zwar erklärt, dass es »Teil der europäischen Familie« sei und potentiell Beitrittskandidat werden könne, für die Übertragung des formellen Kandidatenstatus dem Land aber weitere Bedingungen vor allem in puncto Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auferlegt. Die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sind bis auf Weiteres eingefroren.
- 21
-
Frank Schimmelfennig/Thomas Winzen, Ever Looser Union? Differentiated European Integration, Oxford 2020.
- 22
-
Christian Calliess/Gerhard van der Schyff, Constitutional Identity in a Europe of Multilevel Constitutionalism, Cambridge u. a. 2020; Werner Schroeder, »Die Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit durch die Europäische Union«, in: Zeitschrift für öffentliches Recht, 78 (2023) 1, S. 55–71.
- 23
-
J. H. H. Weiler/Daniel Sarmiento, »The EU Judiciary after Weiss. Proposing a New Mixed Chamber of the Court of Justice«, EULawlive (online), <https://eulawlive.com/app/uploads/j-h-h-weiler-and-daniel-sarmiento.pdf> (eingesehen am 7.3.2024).
- 24
-
Martin Meisel, »On Top of the World, or in the Depths of Despair? Current Developments and Problems Concerning the Accession of the EU to the ECHR«, in: Zeitschrift fur öffentliches Recht (ZöR)/Journal of Public Law, 78 (2023), S. 203–225.
- 25
-
Siehe den Bericht der CEPS-SWP High-Level Group on Bolstering EU Democracy: Kalypso Nicolaïdis/Nicolai von Ondarza/Sophia Russack, The Radicality of Sunlight. Five Pathways to a More Democratic Europe, 19.10.2023, <https://www. ceps.eu/ceps-publications/the-radicality-of-sunlight/> (eingesehen am 7.3.2024).
Alle Rechte vorbehalten.
Abdruck oder vergleichbare Verwendung von Arbeiten der Stiftung Wissenschaft und Politik ist auch in Auszügen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung gestattet.
SWP-Studien unterliegen einem Verfahren der Begutachtung durch Fachkolleginnen und -kollegen und durch die Institutsleitung (peer review), sie werden zudem einem Lektorat unterzogen. Weitere Informationen zur Qualitätssicherung der SWP finden Sie auf der SWP-Website unter https:// www.swp-berlin.org/ueber-uns/qualitaetssicherung/.
SWP‑Studien geben die Auffassung der Autoren und Autorinnen wieder.
© Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, 2024
SWP
Stiftung Wissenschaft und Politik
Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit
Ludwigkirchplatz 3–4
10719 Berlin
Telefon +49 30 880 07-0
Fax +49 30 880 07-200
www.swp-berlin.org
swp@swp-berlin.org
ISSN (Print) 1611-6372
ISSN (Online) 2747-5115
DOI: 10.18449/2024S11