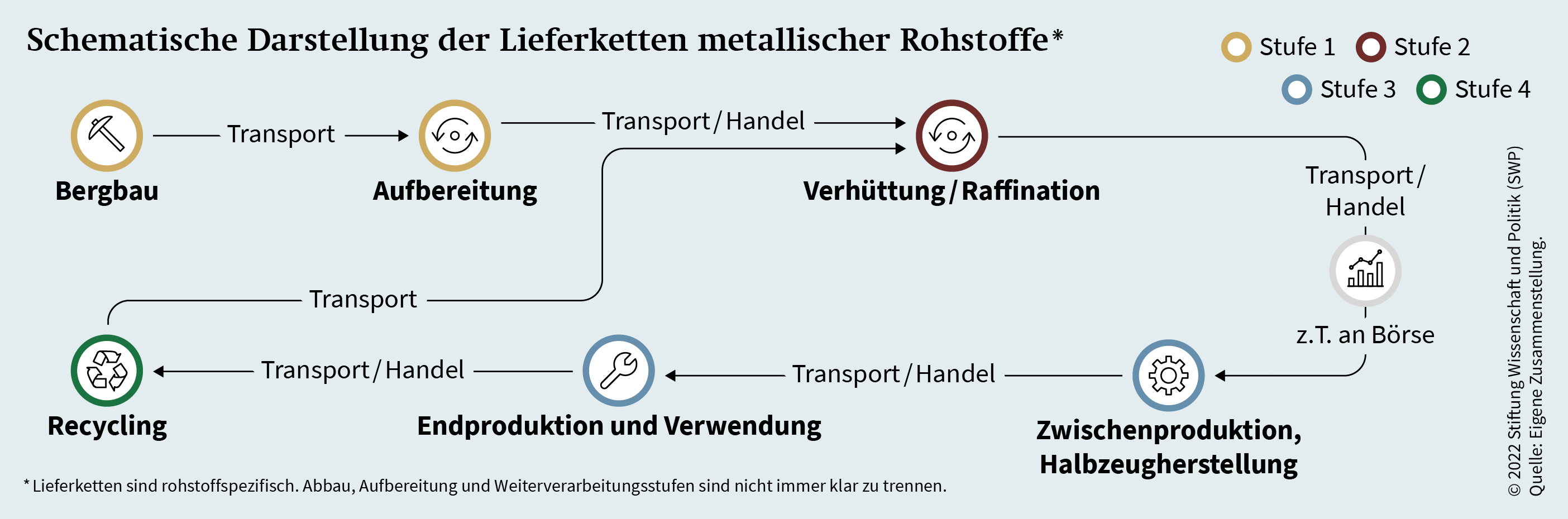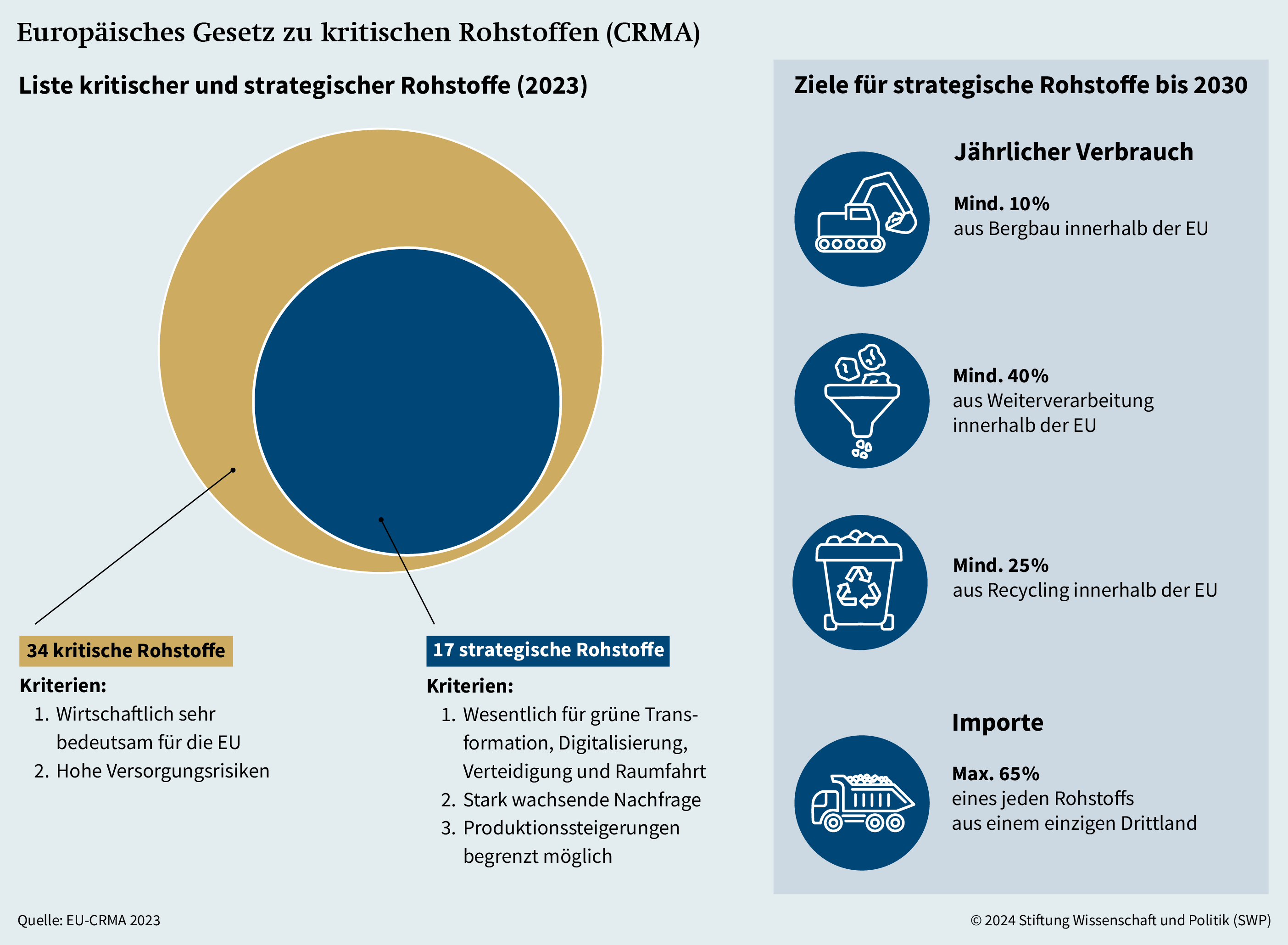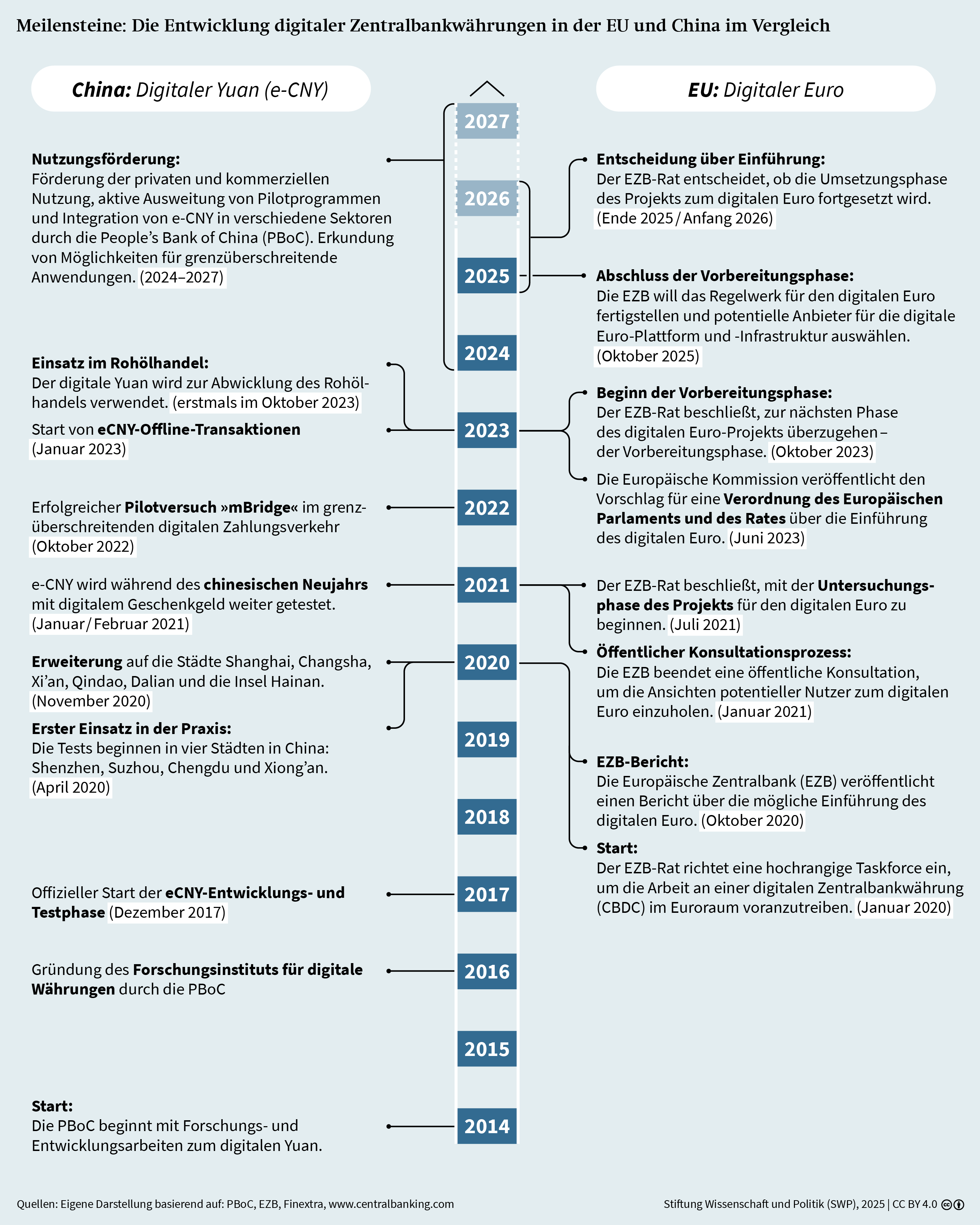Mehr Macht, weniger Markt – Denken und Handeln in der geoökonomischen Zeitenwende
SWP-Studie 2025/S 16, 30.10.2025, 116 Pagesdoi:10.18449/2025S16
Research Areas-
Die Rückkehr von Macht auf den Markt ist das Wesensmerkmal einer geoökonomischen Zeitenwende, wie sie die internationale Politik derzeit erlebt. Damit wurde der alten Erkenntnis neue Aufmerksamkeit verschafft, wonach wirtschaftliche Tätigkeit nicht nur Wohlstand erzeugen, sondern auch außen- und sicherheitspolitische Zielsetzungen befördern kann.
-
Für die Analyse und eine Strategie der Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik bedarf es einer klaren Konzeptionalisierung des Begriffs der Geoökonomie. Dies ist nicht zuletzt deshalb erforderlich, um Kosten und Nutzen geoökonomischer Maßnahmen fundiert abwägen und deren Erfolgsaussichten realistischer einschätzen zu können.
-
Die Beiträge dieser Sammelstudie fokussieren sich auf die theoretisch-konzeptionellen Grundlagen geoökonomischen Denkens und untersuchen in funktional definierten Politikfeldern ausgewählte empirische Fallbeispiele geoökonomischen Handelns.
-
Damit die deutsche Politik mehr Effektivität und Kohärenz in ihrem geoökonomischen Handeln erreichen kann, empfehlen sich folgende Vorgehensweisen: erstens der Aufbau ressortübergreifender Strukturen für die Querschnittsaufgabe Geoökonomie, zweitens der Ausbau von Kommunikation und Koordination mit relevanten Stakeholdern aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie drittens die Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern.
Inhaltsverzeichnis
1 Problemstellung und Schlussfolgerungen
2 Einleitung – Auf der Suche nach einem neuen Verhältnis zwischen Macht und Markt
2.1 Rückkehr von Macht auf den Markt
2.2 Die »geoökonomische Zeitenwende«
2.2.1 Wirtschaftliche Sicherheit
2.2.2 Wirtschaft als Machtressource
2.3 Geoökonomisches Denken und Handeln
2.4 Übersicht über die einzelnen Beiträge
3 Normative und theoretische Grundlagen geoökonomischen Denkens
3.1 Eine kleine Begriffsgeschichte der Geoökonomie
3.2 Geoökonomie: Zwischen strategischer Machtausübung und kooperativer Wohlstandsordnung
3.3 Normative Divergenzen geoökonomischer Denkschulen
4 Geoökonomie und internationale Ordnung
4.1 Was ist »die« internationale Ordnung?
4.3 Geoökonomische Ordnungsentwürfe
4.4 Geoökonomische Handlungsoptionen liberaler Demokratien
5 Die Bedeutung von Raum in der geoökonomischen Zeitenwende
5.1 Volumen und Infrastruktur: Auswirkungen auf geoökonomisches Denken
5.1.2 Infrastrukturen: Verbindung zwischen Raum und Macht
6 Technologie als Machtressource im geoökonomischen Kalkül der Staaten
6.2 Staatliche Kontrolle über Technologie
6.3 Technologieunternehmen als Instrument der Geoökonomie?
6.4 Geoökonomische Denkmuster als Risiko für Europa
Teil II Geoökonomisches Handeln
7 Geoökonomisches Handeln in der EU‑Handels- und ‑Investitionspolitik
7.1 Geoökonomische Zeitenwende in der EU‑Handels- und ‑Investitionspolitik
7.2 Akteure und Instrumente geoökonomischen Handelns
7.3 Zielkonflikte und Handlungsempfehlungen
8 Energiepolitik in der geoökonomischen Zeitenwende: Die EU zwischen Markt und Macht
8.1 Energiepolitik zwischen Markt und Macht
8.2 Außen- und sicherheitspolitische Ziele der EU-Energiepolitik: von Markt zu Macht?
8.2.1 Defensives Oberziel und Instrumente: Minimierung von Risiken und Verwundbarkeiten
8.2.2 Offensives Oberziel: Änderung des Verhaltens externer Akteure
8.3 Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten
9 Metallische Rohstoffe: Versorgungssicherheit als geoökonomische Gestaltungsaufgabe
9.1 Hohe Abhängigkeiten von chinesischen Akteuren
9.2 Europäische Koordinierung im Rohstoffsektor
9.3 Die europäische Rohstoffstrategie: Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten
9.4 Weitere Politikempfehlungen
10 Agrar- und Ernährungspolitik: Geoökonomische Tradition und neue Prioritäten
10.1 Markt, Macht und Raum: Tradition von starkem Staat und großem Technologieeinfluss
10.2 Versorgungssicherheit als zentrales geoökonomisches Ziel der Agrar- und Ernährungspolitik
10.2.1 Defensive Ziele: Absicherung gegen eigene Verwundbarkeit
10.2.2 Offensive Ziele: Politische Stabilisierung durch Versorgungssicherung in Drittstaaten
10.3 EU-Agrar- und Ernährungspolitik über die Zeit: Zurück zur alten Versorgungssicherheit
11.1 Globale Gesundheitspolitik unter Druck
11.2 Entwicklungszusammenarbeit und medizinische Lieferketten als Hebel
11.3 Defensive und offensive Instrumente in der Gesundheitspolitik
11.4 Risiken durch Fragmentierung und Potentiale strategischer Partnerschaften
11.5 Handlungsempfehlungen für deutsche und europäische Politik
12 Chinesische Geoökonomie im Weltraum: Militärische Interessen dominieren
12.1 Instrumente und politische Einbettung an der Schnittstelle Weltraum
12.2 Räume für Chinas Raumfahrtaktivitäten: Schwerpunkt Afrika
12.3 Chinesisches Weltraumprogramm setzt auf Macht statt auf Markt
12.4 Implikationen für Deutschland und Europa
13 Digital- und Cyberpolitik: Das Streben der EU und Indiens nach digitaler Souveränität
13.1 Digitale Souveränität im Vergleich
14.1 China und die EU als währungsmachtpolitische Akteure
14.2 Digitales Zentralbankgeld als neues Feld der Währungsmachtpolitik
14.3 Ausblick: Der digitale Währungsraum als Schauplatz geoökonomischen Handelns
15.1 Bilanzexterne Fiskalagenturen im gegenwärtigen deutschen fiskalischen Ökosystem
15.2 Bilanzexterne Fiskalagenturen als Hilfestellung für geoökonomische Ziele
15.3 Die Frage der fiskalischen Nachhaltigkeit: Fundierung im Finanzsystem
16 Fazit und Handlungsempfehlungen
16.1 Handlungsempfehlungen für deutsche und europäische Politik
16.1.1 Aufbau ressortübergreifender Strukturen
16.1.2 Kommunikation und Koordination mit relevanten Stakeholdern
16.1.3 Internationale Zusammenarbeit
Problemstellung und Schlussfolgerungen
Beschreibungen, Erklärungen und Empfehlungen zur Außen- und Außenwirtschaftspolitik greifen zunehmend auf den Begriff der Geoökonomie zurück. Tatsächlich erfolgt der Einsatz wirtschaftlicher und technologischer Mittel in der außenpolitischen Praxis in steigender Frequenz und Intensität, insbesondere bei jenen Staaten, die über die dafür geeigneten Machtressourcen verfügen, wie gerade die Vereinigten Staaten von Amerika und die Volksrepublik China. Deutschland und Europa sind dadurch politisch besonders herausgefordert. Der Schwerpunkt ihrer ökonomischen Wertschöpfung liegt in der industriellen Weiterverarbeitung. Daher sind sie stark auf einen regelbasierten Zugang zu globalen Beschaffungs- und Absatzmärkten angewiesen und wirtschaftlich entsprechend verwundbar.
Die undifferenzierte Verwendung des Begriffs Geoökonomie ist dabei durchaus problematisch. Meist ist schon unklar, ob dieser als Analyserahmen, Leitbild, Instrument oder Strategie gebraucht wird. Unklar bleiben ferner die jeweils zugrunde gelegten normativen und theoretischen Annahmen wie auch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten gegenüber inhaltlich verwandten Konzepten wie etwa Geopolitik. Die Dilemmata und Kosten, die mit dem Einsatz wirtschaftlicher und technologischer Maßnahmen einhergehen, werden nur zu gerne ausgeblendet. Diese begriffliche Unschärfe und konzeptionelle Inkonsistenz birgt die Gefahr, dass außenpolitisches Handeln an Kohärenz, Glaubwürdigkeit und Legitimität einbüßt. Für die Analyse wie auch für die praktische Politik bedarf es daher einer klaren Konzeptionalisierung geoökonomischen Denken und Handelns, nicht zuletzt damit sich Kosten und Nutzen entsprechender Maßnahmen fundiert abwägen und deren Erfolgsaussichten realistischer einschätzen lassen.
Angesichts dieser Ausgangslage wird in der vorliegenden Sammelstudie danach gefragt, welche grundlegenden Annahmen und Praktiken mit der zunehmenden machtpolitischen Durchdringung internationaler Wirtschaftsbeziehungen einhergehen. Die wachsende Verschränkung von Weltpolitik und Weltwirtschaft kann als eine Rückkehr von Macht auf den Markt begriffen werden. Sie hat der alten Erkenntnis neue Aufmerksamkeit verschafft, wonach wirtschaftliche Tätigkeit nicht nur Wohlstand erzeugen, sondern auch außen- und sicherheitspolitische Zielsetzungen befördern kann. Wenn aber in den Außenwirtschaftsbeziehungen vornehmlich politische Interessen verfolgt werden, rücken die potentiellen Effizienz- und Wohlstandsgewinne durch Freihandel, durch grenzüberschreitende Arbeitsteilung und regelbasierten Wettbewerb in den Hintergrund.
Politische Ziele mit wirtschaftlichen Mitteln zu verfolgen ist zwar eine jahrhundertealte Praxis, doch der hohe Grad an digitaler und wirtschaftlicher Vernetzung unterscheidet die heutige globalisierte Welt von jener früherer Epochen. Das Ausmaß grenzüberschreitender Waren-, Dienstleistungs-, Kapital-, Informations- und Migrationsströme hat wechselseitige Verflechtungen (Interdependenz) zur Folge. Werden entsprechende Verbindungen selektiv beschränkt oder ganz ausgesetzt, kann dies insbesondere für Unternehmen, mitunter aber auch für ganze Volkswirtschaften und Gesellschaften zu einer existentiellen Bedrohung werden. Darüber hinaus schaffen Digitalisierung und technologische Entwicklungen nicht nur mehr Möglichkeiten einer machtpolitischen Instrumentalisierung internationaler Wirtschaftsbeziehungen, sondern auch spezielle Verwundbarkeiten und Risiken.
Angesichts dieser Herausforderungen ist das Streben nach ökonomischer Sicherheit zum festen Bestandteil der nationalen Außenwirtschaftspolitik aller großen Wirtschaftsmächte geworden. Die wichtigsten Ziele dabei sind Versorgungssicherheit, der Schutz kritischer Infrastrukturen, die Verhinderung von ungewolltem Technologieabfluss sowie resiliente Lieferketten für kritische Vorleistungen. Die EU und ihre Mitgliedstaaten verfügen nicht in ausreichendem Maße über geeignete Entscheidungsstrukturen und defensive Instrumente, um adäquat auf entsprechende Risiken reagieren und Gefahren abwehren zu können. Andererseits ist der offensive Einsatz wirtschaftlicher oder technologischer (Zwangs-)Mittel problematisch. Erfolgsaussichten und politische Wirksamkeit solcher Maßnahmen sind ungewiss.
Vor diesem Hintergrund fokussieren sich die Beiträge dieser Studie auf die Grundlagen und Ausprägungen geoökonomischen Denkens und Handelns. Dabei ist das übergeordnete Erkenntnisinteresse, praxisrelevantes Orientierungs- und Handlungswissen für außen- und sicherheitspolitische Entscheidungsträgerinnen und ‑träger in Deutschland und Europa abzuleiten. Im ersten Teil beleuchten vier Beiträge sowohl die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen geoökonomischen Denkens als auch die dafür zentralen Kategorien von Raum, internationaler Ordnung und Technologie. Im zweiten Teil knüpfen neun Beiträge an die im ersten Teil entwickelten Konzeptionalisierungen geoökonomischen Denkens an. Untersucht werden hier – in funktional definierten Politikfeldern – ausgewählte empirische Fallbeispiele geoökonomischen Handelns in unterschiedlichen regionalen Kontexten.
Ausgehend von den jeweiligen Einzelbefunden werden drei übergeordnete Handlungsempfehlungen für geoökonomisches Handeln der Bundesregierung formuliert. Erstens sollte diese Querschnittsaufgabe innerhalb des Nationalen Sicherheitsrats im Bundeskanzleramt institutionell verankert und von einer ressortübergreifenden Struktur unterstützt werden, um institutionelle Silos aufzubrechen und Kohärenz wie Entscheidungsfähigkeit angesichts unterschiedlicher ministerieller Zuständigkeiten auf deutscher und europäischer Ebene sicherzustellen. Zweitens sollten bestehende Kommunikationskanäle weiter ausgebaut und eine noch engere Koordination mit relevanten Stakeholdern aus Wirtschaft und Wissenschaft ermöglicht werden. Drittens müsste die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern wie verbündeten Staaten und mit internationalen Institutionen intensiviert werden.
Einleitung – Auf der Suche nach einem neuen Verhältnis zwischen Macht und Markt*
Hanns Günther Hilpert / Sascha Lohmann
Der Begriff Geoökonomie erlebt im außen- und sicherheitspolitischen Diskurs derzeit eine bemerkenswerte Konjunktur. Im Sprachgebrauch deutscher und europäischer Entscheidungsträgerinnen und ‑träger hat sich der Terminus fest etabliert. Er taucht als Bezeichnung ministerieller Arbeitseinheiten ebenso auf wie im Vokabular multinational operierender Unternehmen; auch in der Begründung für die vom Bundestag gelockerte Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben findet er sich.1 Der Ausdruck, ob als Substantiv oder als Adjektiv verwendet, bezieht sich gemeinhin auf das Phänomen, dass sich (Macht-)Politik und (Markt-)Wirtschaft in zunehmender Weise wechselseitig durchdringen.2 Ursprünglich geprägt wurde er in der Weimarer Republik, als man damit die aufkommende Inkongruenz zwischen politischen und wirtschaftlichen Räumen beschrieb.3
Doch auch wenn der Begriff in Politik und Wirtschaft weit verbreitet ist, erscheinen bestehende Konzeptionalisierungen von Geoökonomie eher diffus und in der praktischen Politik bislang von geringer operativer Relevanz.4 In angewandter ebenso wie in Grundlagenforschung dient der Terminus seit Anfang der 1990er Jahre zur Analyse einer Außenpolitik von Staaten bzw. Staatenverbünden, die vorrangig mit ökonomischen Mitteln betrieben wird.5 Zum einen untersucht man dabei außenwirtschaftliche Ergebnisse und Prozesse, die maßgeblich durch geographische Faktoren bestimmt werden, wie etwa den Zugang zu Rohstoffen. In den meisten Fällen steht Geoökonomie für offensive oder defensive Zielsetzungen nationaler Sicherheitspolitik, die ausschließlich oder überwiegend unter Einsatz wirtschaftlicher und technologischer Mittel verfolgt werden – oder umgekehrt für wirtschaftliche Ziele unter Einsatz politischer Mittel bzw. Zwangsmittel.6 Zum anderen wird Geoökonomie als Status (»geoökonomische Macht«) verstanden oder zur Beschreibung eines gewandelten (Eliten-)Diskurses genutzt, in dem wirtschaftliche Zusammenhänge versicherheitlicht werden – bis hin zu der Feststellung, dass sich nicht nur ein außenpolitischer Prioritäten-, sondern gar Paradigmenwechsel vollziehe.7
Bei der Verwendung des Begriffs als Analyserahmen, Leitbild, Instrument oder Strategie bleiben die normativen und theoretischen Grundannahmen, die jeweils zugrunde gelegt werden, allerdings ebenso unklar wie die Unterschiede gegenüber und Gemeinsamkeiten mit inhaltlich verwandten Konzepten wie Wirtschaftsstaatskunst (economic statecraft), strategische Außenwirtschaftspolitik,8 Wirtschaftsdiplomatie, Wirtschaftskrieg9 bzw. Wirtschaftsmacht.10 Dies gilt auch für das eher staatszentrierte Konzept von Geopolitik. Letzteres rückt maßgeblich durch Geographie bedingte politische Ergebnisse und Entwicklungen in den Blick, die vorrangig durch diplomatische oder militärische Mittel beeinflusst werden.
Der oftmals unsubstantiierte Gebrauch sowie die überwiegend diffusen Konzeptionalisierungen von Geoökonomie geben Anlass, den Begriff in der vorliegenden Sammelstudie multiperspektivisch zu beleuchten. Leitfrage ist dabei, welches Denken und Handeln mit der zunehmenden machtpolitischen Durchdringung internationaler Wirtschaftsbeziehungen und sektoraler Entwicklungen einhergeht.
Rückkehr von Macht auf den Markt
Mit der Renaissance des Begriffs Geoökonomie in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft rückt der wechselseitige Zusammenhang von Politik (Macht) und Wirtschaft (Markt) wieder verstärkt in den Blick.11 Unter Markt wird im Folgenden der Austausch von Wirtschaftsgütern (Waren, Dienstleistungen, Landnutzung, Kapital, immateriellen Rechten und Pflichten) verstanden, wie er überwiegend im Zuge autonomer, freiwillig getroffener Entscheidungen von Anbietern und Abnehmern zum beidseitigen Vorteil und auf Grundlage des Preismechanismus (bottom-up) erfolgt. Aus diesen Austauschbeziehungen können wiederum komplexe wechselseitige Verflechtungen erwachsen, die Personen, Unternehmen und Märkte über nationalstaatliche Grenzen hinweg verbinden.12 Macht bezeichnet in einem engeren Sinne auf staatlichen Hoheitsakten beruhende Eingriffe politischer Akteure (top-down), die marktwirtschaftliche Ergebnisse, Prozesse und Anreizstrukturen insbesondere durch öffentliches Recht gezielt verändern. Die Rückkehr von Macht auf den Markt hat der alten Erkenntnis neue Aufmerksamkeit verschafft, wonach wirtschaftliche Tätigkeit nicht nur Wohlstand erzeugen, sondern auch außen- und sicherheitspolitische Zielsetzungen befördern kann.13 Zugleich geht es hier nicht bloß um die Wiederkehr einer Geopolitik, bei der staatliches Handeln marktwirtschaftliche Erwägungen überlagert.14 Vielmehr wird das Verhältnis zwischen Markt und Macht tiefgreifend transformiert. Dabei ersetzen machtpolitische Erwägungen marktwirtschaftliche Entscheidungen nicht, sondern es werden Anreizstrukturen gezielt verändert, um Marktkräfte zu lenken, anstatt sie außer Kraft zu setzen.
Auf konzeptioneller Ebene kehren Leitbilder, Prinzipien und Ordnungsvorstellungen als Orientierungs- und Bezugspunkt für internationale Politik und Wirtschaft zurück, die überwiegend auf Annahmen aus der realistischen Denktradition gründen. Demnach vollziehen sich internationale Beziehungen in einem anarchischen System. Darin agieren Nationalstaaten als maßgebliche Akteure, die einander misstrauen und jeweils um ihr eigenes Überleben kämpfen (Polarität).15 Da mit dem Schlimmsten zu rechnen die höchsten Chancen auf Überleben sichert, erscheint Vertrauen als Hochrisikoinvestition, während Zusammenarbeit lediglich als transaktionales Nullsummenspiel gilt. Aus dem Streben nach Sicherheit resultiert ein strukturelles Sicherheitsdilemma. Dieses besteht darin, dass Maßnahmen zu Selbsthilfe und Selbstverteidigung nach außen als bedrohlich erscheinen und auch dann entsprechende Gegenreaktionen auslösen können, wenn die eigenen Intentionen rein defensiv sind.16 Gleichzeitig verliert das bislang wirkmächtige liberale Paradigma einer friedensfördernden Wirkung wechselseitiger wirtschaftlicher Verflechtungen (Interdependenz) an Strahlkraft – das indes mit der vielzitierten Formel vom Wandel durch Handel nur unzureichend, da arg verkürzt, umschrieben wird.17
Sofern die Priorität auf der Einhegung von Risiken liegt, die aus außenwirtschaftlicher Verflechtung resultieren, rücken die potentiellen Wohlstandsgewinne durch Freihandel und regelbasierten Wettbewerb in den Hintergrund, insbesondere wenn asymmetrische Abhängigkeiten bestehen. Richtet sich der Fokus auf Risiken, die aus Verwundbarkeit erwachsen, treten relative Gewinne in den Vordergrund. Diese gehen zu Lasten der absoluten Kooperationserträge, die im grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr anfallen. Die Rückkehr von Macht auf den Markt geht daher mit erheblichen Effizienzverlusten einher. Werden ökonomische Abhängigkeiten ausgenutzt, unterminiert dies zudem die normativen und theoretischen Grundannahmen liberaler Politik- und Wirtschaftstheorie, zu denen etwa die strikte Trennung politischer und wirtschaftlicher Sphären mit jeweils eigenständigen Funktionslogiken gehört. Die Re-Politisierung internationaler Wirtschaftsbeziehungen verändert auch wissenschaftliche und praktische Erkenntnisinteressen. Der Blick gilt dann weniger der friedensstiftenden als vielmehr der konfliktverschärfenden Wirkung von Handel.18
Staatliche Machtpolitik, die mit wirtschaftlichen und technologischen Mitteln operiert, um außen- und sicherheitspolitische Ziele zu erreichen, stellt indes eine seit Jahrhunderten geübte Praxis politischer Gemeinschaften dar. Neu und historisch präzedenzlos sind allerdings die Rahmenbedingungen, unter denen der Einsatz dieser Mittel in der Gegenwart erfolgt. Der hohe Grad an wechselseitiger Verflechtung unterscheidet die heutige globalisierte Welt von jener früherer Epochen. Die europäische wie deutsche Außen- und Sicherheitspolitik steht damit vor gänzlich neuen Herausforderungen. Bereits eine selektive Beschränkung wirtschaftlicher Transaktionen kann für Unternehmen, ja mitunter ganze Volkswirtschaften und Gesellschaften zu einer existentiellen Bedrohung werden. In den Blick rücken dabei Abhängigkeiten von großen Beschaffungs- und Absatzmärkten und daraus resultierende Verwundbarkeiten. Über den Handel hinaus eröffnen Digitalisierung und technologische Entwicklungen (emerging sowie foundational technologies) neue Kanäle, um internationale Wirtschaftsbeziehungen machtpolitisch zu instrumentalisieren. Die außen- und sicherheitspolitisch motivierte Risikoreduzierung (de-risking) oder gar Entflechtung (de-coupling) wirkt sich erheblich auf internationale Finanz- und Handelsströme aus. Unter dem Schlagwort »geoökonomische Fragmentierung« wird diese Entwicklung in Wirtschaft und anwendungsbezogener Wissenschaft als ein sich verfestigender Trend thematisiert.19
Als Strategie kann geoökonomisches Handeln eine defensive und eine offensive Wendung nehmen. Aus Interdependenzen können asymmetrische Abhängigkeiten erwachsen, die als potentielle Verwundbarkeit ein ökonomisches und auch politisches Risiko darstellen, gegen das es sich zu schützen gilt. Offensiv lassen sich wechselseitige wirtschaftliche Verflechtungen und daraus resultierende Abhängigkeiten als Machtressource einsetzen. Wie Verwundbarkeiten abgebaut oder auch gezielt genutzt werden können, um defensive oder offensive Zielsetzungen zu verfolgen, wird intensiv diskutiert. Dabei ist der offensive Einsatz wirtschaftlicher oder technologischer (Zwangs-)Mittel durchaus problematisch. Erfolgsaussichten und politische Wirksamkeit solcher Maßnahmen sind ungewiss. Wohlfahrtsverluste, die damit ohnehin einhergehen, können durch unerwünschte Reaktionen und Gegenmaßnahmen von unmittelbar oder mittelbar Betroffenen noch verstärkt werden.
Die »geoökonomische Zeitenwende«
Verschiebungen in der Beziehung von Macht und Markt wurden bereits in der Vergangenheit intensiv debattiert und analysiert, wenn sich zeigte, dass Regierungen ihre Sicherheits- und ihre Wirtschaftspolitik – etwa im transatlantischen Verhältnis – eng miteinander verknüpften.20 Dass der Glaube an Freihandel als Treiber wirtschaftlicher Globalisierung grundlegend erschüttert wurde, bewirkten jedoch erst die Corona-Pandemie ab Anfang 2020 und der im Februar 2022 zur Vollinvasion ausgeweitete völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Mit den in der Folge weltweit gestörten Liefer- und Produktionsketten erschien die Schwelle zu einer Zeitenwende überschritten. Damit einher ging nicht nur eine grundlegende Neuausrichtung in der europäischen Sicherheitspolitik sowie in der Wirtschafts- und Finanzpolitik.21 Vielmehr galt es auch die zentralen Annahmen über das Verhältnis von Macht und Markt in tiefgreifender Weise zu überdenken. Ausgangspunkt war und ist, dass Europa in einer turbulenten Welt großen Herausforderungen gegenübersteht und Deutschland nicht mehr – wie vom damaligen Verteidigungsminister Volker Rühe in den 1990er Jahren ironisch bemerkt – »von Freunden umzingelt« ist. Das deutsche und europäische Wirtschaftsmodell ist bedroht, sollten Transportwege sowie internationale Liefer- und Produktionsketten substantiell beschränkt werden. Freiheit und Wohlstand in Europa wären dann existentiell gefährdet.
Dass die Macht auf den Markt zurückkehrt, trifft Deutschland und die EU in ihrem integrativen wie multilateralistischen Selbstverständnis. Es trifft einen Kontinent, der in einer digital vernetzten und wirtschaftlich eng verflochtenen Welt außerordentlich verwundbar ist. Da Europas komparativer Vorteil und der Schwerpunkt seiner ökonomischen Wertschöpfung in der industriellen Weiterverarbeitung liegen, ist es stark auf den verlässlichen Zugang zu globalen Zuliefer- und Absatzmärkten angewiesen. Zudem ist Europa – anders als etwa die USA, China, Indien oder Russland – arm an Energie und Rohstoffen bzw. beschränkt deren Förderung. Daher treffen Zugangsbarrieren für Rohstoffvorkommen die Europäer schmerzhaft und unmittelbar. Dies zeigte der Lieferstopp für russisches Erdgas im Zuge von Moskaus Ukraine-Invasion, der zu einem Anstieg der Gaspreise um 80 Prozent führte.22
Zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (2024) tragen Exporte mit 42 Prozent und Importe mit 38 Prozent bei.23 Damit ist die Bundesrepublik so intensiv mit der Weltwirtschaft verflochten wie kein anderes G20-Mitglied. Profitierte Deutschland in der Vergangenheit mehr als andere von der fortschreitenden Globalisierung und Handelsliberalisierung, so ist es in der aktuellen Umbruchphase auch stärker exponiert. Das betrifft die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten ebenso wie von der Nachfrage des Auslands nach Waren und Dienstleistungen deutscher Unternehmen. Derweil wird Europa – weit davon entfernt, selbst ein Takt- und Impulsgeber internationaler Politik zu sein – durch externe Eingriffe militärischer und wirtschaftlicher Art herausgefordert, ob diese nun offen oder verdeckt erfolgen. Dazu gehören Angriffe auf maritime Infrastruktur etwa durch kommerzielle Handelsschiffe, ebenso Embargos für kritische Rohstoffe. Zugleich verfügen die EU und ihre Mitgliedstaaten bislang nicht in ausreichendem Maße über geeignete Entscheidungsstrukturen und defensive Instrumente, um adäquat auf diese Risiken reagieren und Gefahren abwehren zu können. Ob sich das Wohlstandsversprechen, das etwa für Deutschland mit seinem langjährigen Status als »Exportweltmeister« einherging, auch künftig einlösen lässt, erscheint zunehmend fraglich.
Wirtschaftliche Sicherheit
Das Anliegen wirtschaftlicher Sicherheit ist zum festen Bestandteil der nationalen Außenwirtschaftspolitik aller großen Wirtschaftsmächte geworden. Die wichtigsten Ziele dabei sind stabile, resiliente Lieferketten für kritische Vorleistungen, der Schutz kritischer Infrastrukturen, die Sicherstellung von Rohstoffversorgung, auch bei Nahrungsmitteln, der Schutz vor ökonomischen Zwangsmaßnahmen Dritter und die Abwendung eines ungewollten Technologieabflusses. Wie und warum wirtschaftliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, ist letztlich situationsabhängig. Wenn etwa vormals gute Handelspartner zu strategischen Rivalen oder gar Gegnern werden, erscheint es politisch dringend geboten, die außenwirtschaftliche Verflechtung mit ihnen zu reduzieren. Sicherheitspolitisch fahrlässig wäre es hingegen, Schritte zum Zweck der Risikominderung, wenn nicht der Entflechtung zu unterlassen. Entsprechende Maßnahmen können etwa darin bestehen, dass Zuliefer- und Absatzmärkte stärker diversifiziert oder heimische Produktionskapazitäten aufgebaut werden, und zwar über die Verteidigungsindustrie hinaus. Dies mag ökonomisch kostspielig sein – der Zugewinn an nationaler Souveränität geht tendenziell zu Lasten von Wohlstand und wirtschaftlicher Effizienz.
Ökonomische Sicherheitsstrategien sollten immer Teil einer umfassenderen nationalen Sicherheitsstrategie sein, die daneben auch militärische, technologische und diplomatische Elemente umfasst. In Europa und Deutschland wird die Verbindung zwischen wirtschaftlicher und nationaler Sicherheit erst in jüngerer Zeit stärker akzentuiert. Dabei wurden auf europäischer Ebene allerdings schon zahlreiche Maßnahmen getroffen, um die wirtschaftliche Sicherheit zu wahren und zu erhöhen.24
Wirtschaft als Machtressource
Das merkantilistische Streben nach wirtschaftlicher Prosperität als Grundlage diplomatischer und militärischer Machtinstrumente ist ein historisch bekanntes, keineswegs neues Phänomen. Das Gleiche gilt für den Ansatz, dass außenwirtschaftliche Verwundbarkeiten instrumentalisiert werden, um Einfluss auf die Außenpolitik anderer Staaten und die internationale Politik insgesamt zu nehmen.25 Ältere geschichtliche Beispiele bieten die von Athen gegen Spartas Verbündeten Megara verhängte Wirtschaftsblockade, die mit zum Auslöser des Zweiten Peloponnesischen Krieges (431–404 v. Chr.) wurde, oder die Kontinentalsperre Napoleons gegen England (1806–1813). Jüngere Fälle sind das COCOM, ein informelles Exportkontrollregime, mit dessen Hilfe Ländern des damaligen Ostblocks westliche Technologie vorenthalten werden sollte (1949–1994), das Ölembargo der Organisation erdölexportierender Länder infolge des Jom-Kippur-Kriegs von 1973 sowie nicht zuletzt die umfangreichen Sanktionen gegen Russland, die unter anderem von G7-Staaten als Antwort auf die Invasion der Ukraine in Kraft gesetzt wurden. Insbesondere bei der Kontrolle der Ein- und Ausfuhr bzw. des Kapital- und Zahlungsverkehrs spielte die sicherheitspolitische Dimension von Wirtschaft schon immer eine herausragende Rolle.26
Die wichtigsten staatlichen Maßnahmen beim offensiven machtpolitischen Einsatz sind das sektorale oder umfassende Embargo (Beschränkung von Güter- und Dienstleistungsexporten), Boykotte (Beschränkung von Einfuhren des Ziellandes), Beschränkungen des Zahlungs- und Kapitalverkehrs sowie die Verhängung von Quoten, Zöllen oder gezielten Sanktionen gegen natürliche und juristische Personen. Voraussetzung für ein offensives Vorgehen sind insbesondere die Verfügungsgewalt über den Zugang zu Rohstoffen, Gütern und Dienstleistungen sowie zu den einschlägigen Handelsplätzen und ‑netzwerken als (im-)materiellen Knotenpunkten. Der forcierte Aufbau entsprechender Verfügungsgewalten kann neben der Entwicklung kritischer Technologien als Instrument und Ziel geoökonomischen Handelns verstanden werden. Aufgrund der damit verbundenen Abschreckungs- und Drohpotentiale sind derartige Anstrengungen durchaus vergleichbar mit militärischer Aufrüstung.
Als Grundlage geoökonomischer Machtausübung ist die Wirtschaftskraft eines Landes oder eines Staatenverbunds von großer Bedeutung. Um Fähigkeiten zu entwickeln bzw. zu erhalten, um außenwirtschaftliche Verflechtung als Machtressource (etwa durch Marktzugangsbeschränkungen) auch tatsächlich nutzen zu können sowie um außen- und verteidigungspolitische Lasten zu übernehmen, bedarf es eines entsprechenden ökonomischen Potentials. Es liegt auf der Hand, dass eher die großen Wirtschaftsmächte über die nötigen personellen Ressourcen und institutionellen Strukturen verfügen. Beispielsweise kann ein Boykott nur bei entsprechendem Importvolumen wirken. Historisch bildeten Wirtschaftskraft und ‑dynamik gerade im Fall der Bundesrepublik Deutschland die Grundlage dafür, den eigenen außenpolitischen Handlungsspielraum zu vergrößern und zunehmende Einflussmöglichkeiten in Europa wie auch international zu erringen.27 Insofern ist Wirtschaftswachstum einem geoökonomisch motivierten Machtaufbau grundsätzlich zuträglich. Allerdings können Embargo- und Boykottmaßnahmen ebenso wie eine Politik des de-risking oder gar des de-coupling, die jeweils hohe Effizienzverluste und Wachstumseinbußen nach sich ziehen, die eigenen politischen Einflussmöglichkeiten verringern.
Geoökonomisches Denken und Handeln
So schwierig und problematisch sich Geoökonomie als staatliche Praxis erweist, so geboten erscheint es, sich mit ihren Grundlagen und Folgen zu beschäftigen. Zwar werden die Finanzliberalisierung und die Deregulierung des grenzüberschreitenden Kapital- und Zahlungsverkehrs, die seit Mitte der 1980er Jahre unter dem neoliberalen Paradigma vorangetrieben wurden, nicht rückabgewickelt. Gleichzeitig ist unübersehbar, dass die internationalen Wirtschaftsbeziehungen eine machtpolitische Aufladung erfahren haben. Die Marktlogiken hinter Wohlfahrtssteigerung und Gewinnmaximierung werden zusehends von machtpolitischen Erwägungen durchdrungen. Letztere zielen beispielsweise auf die außen- und sicherheitspolitisch motivierte Minderung wirtschaftlicher Verwundbarkeiten oder den Abbau asymmetrischer Abhängigkeiten durch Entflechtung.
So herausfordernd diese Rahmenbedingungen auch sein mögen, müssen Deutschland und die EU ihre Außenpolitik sowie ihre Außenwirtschaftsbeziehungen doch anpassen, um sich in einer geoökonomischen Welt behaupten zu können. Es wird nicht damit getan sein, sich reaktiv auf die neue Situation einzustellen. Vielmehr bedarf es einer konzeptionellen Auseinandersetzung mit dem Phänomen, dass wirtschaftliche und technologische Mittel zunehmend eingesetzt werden, um außen- und sicherheitspolitische Interessen zu verfolgen. Dafür erscheint eine Konzeptionalisierung geoökonomischen Denkens und Handelns dringend notwendig, damit sich Handlungsmöglichkeiten und ‑zwänge anhand bestehender Chancen und Risiken fundiert beurteilen und Erfolgsaussichten entsprechender Strategien besser abschätzen lassen. Mit der vorliegenden Sammelstudie soll praxisrelevantes Orientierungs- und Handlungswissen für die »geoökonomische Zeitenwende« generiert werden.28
Übersicht über die einzelnen Beiträge
Im ersten Teil der Studie loten vier Beiträge zentrale Grundlagen geoökonomischen Denkens aus. Christian Pfeiffer leistet eine theoretische und konzeptionelle Herleitung des Begriffs Geoökonomie, indem er dessen ideengeschichtliche Ursprünge in der Zeit der Weimarer Republik zurückverfolgt. Dabei kontrastiert er zwei normative Hauptströmungen: einen realistischen, kontrollorientierten Ansatz, der vor allem fokussiert, wie wirtschaftliche Mittel zur geopolitischen Machtausübung eingesetzt werden, und einen liberalen, kooperationsorientierten Ansatz, der auf Interdependenz, Integration und Offenheit setzt. In der stark normativ geprägten Debatte über geoökonomisches Handeln, so der Autor, sei es für eine verantwortungsvolle und glaubwürdige Außenwirtschaftspolitik erforderlich, tief verwurzelte und oftmals verborgen bleibende Grundannahmen sichtbar zu machen und angemessen zu reflektieren.
Hanns W. Maull erörtert in seinem Beitrag die Implikationen einer zunehmenden machtpolitischen Instrumentalisierung internationaler Wirtschaftsbeziehungen. Geoökonomisches Denken fordere die bestehende(n) internationale(n) Ordnung(en) heraus. In dieser bzw. diesen herrsche ein Zustand wachsender Anomie, da vormals wirkmächtige Normen, Regeln und Gesetze an Bindungskraft verlören. Während liberale Weltordnungen auf Kooperation, Regeln und Offenheit setzten, so der Autor, strebten geoökonomische Ordnungsentwürfe – insbesondere autoritärer Staaten – nach Machterhalt, Hierarchisierung und strategischer Kontrolle über wirtschaftliche Abhängigkeiten. Liberale Demokratien stünden vor der Herausforderung, Strategien geoökonomischen Handelns zu nutzen, ohne dabei ihre politischen Prinzipien und ihre gesellschaftliche Offenheit zu gefährden.
Nadine Godehardt zeigt anhand aktueller wissenschaftlicher Debatten die Relevanz von Raum für geoökonomisches Denken auf. Während der Bezug zu geographischen Räumen darin kaum mehr eine Rolle spiele, stehe das Präfix »Geo« nunmehr als Chiffre dafür, dass die Realität von Machtpolitik anerkannt werde, aber auch eine Hinwendung zu Letzterer erfolge. Geoökonomisches Handeln erschaffe und strukturiere Räume, die über traditionelle geographische Definitionen statischer Art hinausgingen. Ein tieferes Verständnis des »Geo« in Geoökonomie erfordere daher eine Verknüpfung von Raum und Macht, wobei Regierungen und globale Akteure durch Kontrolle über diverse physische und nichtphysische Räume wie Infrastrukturen und volumetrische Dimensionen (wie etwa den Weltraum) staatliche Souveränität absicherten. Die Weltordnung werde zunehmend fragmentiert, während sich eine potentiell inter-imperiale Struktur herausbilde, in der Länder wie China und die USA ihre Macht durch räumliche Kontrolle ausweiteten. Angesichts dieser Entwicklung sei es für Entscheidungsträgerinnen und ‑träger maßgeblich, dynamische Raumwirkungen zu berücksichtigen, damit sich eigene wirtschaftliche oder technologische Maßnahmen effektiv gestalten lassen und eine Peripherisierung vermieden werden kann.
Daniel Voelsen beleuchtet, wie geoökonomisches Denken den Blick von Regierungen auf Technologie verändert. Diese wird zunehmend aus einer »realistischen« Perspektive betrachtet und vor allem als materielle Ressource verstanden, mit der sich staatliche Machtpositionen stärken lassen. Damit einher gehe eine inhärente Spannung zwischen dem (vom Autor als überzogen charakterisierten) Streben nach nationaler Kontrolle sowie schnellen Ergebnissen einerseits und langfristiger Innovationsfähigkeit andererseits. Für Europa berge es erhebliche Risiken, in einen machtpolitisch motivierten Technologiewettlauf hineingezogen zu werden oder diesen gar selbst zu befeuern.
Im zweiten Teil der Studie widmen sich neun Beiträge geoökonomischem Handeln anhand empirischer Fallstudien. Die Autorinnen und Autoren analysieren über verschiedene Politikfelder hinweg defensive und offensive Zielsetzungen sowie die dabei zum Einsatz gebrachten wirtschaftlichen und technologischen Instrumente. Sie bewerten Letztere hinsichtlich ihrer Handlungsfolgen und ziehen anwendungsbezogene Schlussfolgerungen für deutsche und europäische Politik. Zwei der neun Beiträge gehen über die funktionale Analyse hinaus und untersuchen bei verschiedenen regionalen Akteuren (EU, Indien, China) komparativ die jeweiligen geoökonomischen Ausgangsbedingungen, Ziele, Strategien und Handlungsmöglichkeiten in einem konkreten Politikfeld (der Digital- und Cyberpolitik bzw. der Währungsmachtpolitik). Abgeschlossen wird der Reigen mit einem explorativen Beitrag, der die mögliche Rolle externer Fiskalagenturen bei der Bewältigung geoökonomischer Herausforderungen skizziert.
Peter-Tobias Stoll und Dorothée Falkenberg zeichnen nach, wie die EU in ihrer Handels- und Investitionspolitik neben wirtschaftlichen zunehmend auch außen- und sicherheitspolitische Ziele verfolgt. Diese Neuausrichtung manifestiere sich in Ansätzen wie der »Offenen strategischen Autonomie« und der »Strategie zur Stärkung der wirtschaftlichen Sicherheit in Europa«. Dabei müsse die EU im Zielkonflikt zwischen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Freihandel navigieren und eine effektive Koordination über verschiedene Akteure und Politikbereiche hinweg sicherstellen.
Jacopo Maria Pepe richtet den Blick auf die europäische Energiepolitik, die Energie nicht mehr nur als wirtschaftliches Gut, sondern zusehends als strategisches Machtinstrument begreife. Dabei rücke die EU von ihrem traditionell marktzentrierten Ansatz ab, um verstärkt sicherheits- und außenpolitische Ziele zu verfolgen. Diese seien primär defensiv und auf Versorgungssicherung und Resilienzaufbau ausgelegt. Trotz neuer Instrumente und Maßnahmen zur Risikominimierung bleibe die EU auf absehbare Zeit mit strukturellen Abhängigkeiten und institutionellen Schwächen ihrer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) konfrontiert, die ihre Handlungsspielräume einschränkten.
Melanie Müller erläutert die strategischen Herausforderungen Europas bei der Versorgung mit mineralischen Rohstoffen. Im Zuge der digitalen und der grünen Transformation hätten sich die Bedarfe der Industrie verändert und gleichzeitig erhöht. Die Importabhängigkeit in dem geopolitisch umkämpften Sektor sei hoch, insbesondere die von China. Mit dem Critical Raw Materials Act (CRMA) verfolge die EU zwar eine koordinierte Strategie, um die heimische Produktion zu steigern und Importe zu diversifizieren. Damit sie sich umsetzen lasse, sei es aber erforderlich, Hindernisse etwa im Bergbau oder beim Recycling zu überwinden, die außenpolitische Dimension der Strategie zu stärken und die Wirtschaft besser einzubinden. Hierfür wiederum bedürfe es einer verstärkten europäischen Koordination und gezielter staatlicher Eingriffe.
Bettina Rudloff und Rocco Görhardt legen dar, dass die Agrar- und Ernährungspolitik seit jeher von geoökonomischem Handeln geprägt wird. Zentrale Faktoren sind dabei Raum, Technologie, die Vulnerabilität der Nahrungsversorgung und die Rolle des Staates. Der Beitrag identifiziert Versorgungssicherheit als primäres Ziel geoökonomischen Handelns, wobei auf historische Abläufe, auf theoretische Annahmen wie das Thünen-Modell und den Einfluss von Technologie – wie im Zuge der Grünen Revolution – verwiesen wird. Im Fokus stehen sowohl defensive Strategien wie die Selbstversorgung als auch offensive Vorgehensweisen wie der Einsatz von Nahrungshilfen zur politischen Stabilisierung. Thematisiert wird zudem, welche unbeabsichtigten Wirkungen entsprechende Maßnahmen haben können und wie sich die EU-Agrarpolitik im Laufe der Zeit entwickelt hat.
Michael Bayerlein und Pedro A. Villarreal konstatieren einen Umbruch in der globalen Gesundheitspolitik. Die multilaterale Zusammenarbeit auf diesem Feld werde zunehmend von außen- und sicherheitspolitischen Interessen überlagert und Gesundheit zum Instrument nationalstaatlicher Machtausübung. Dieser Befund mache ein neues konzeptionelles Denken auf Seiten Deutschlands und der EU notwendig. Zum einen gelte es dabei die eigene und die globale Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren zu schützen, zum anderen nationale gesundheitsbezogene Wirtschaftsinteressen zu wahren. Hierbei stünden defensive und offensive Ziele in einem Spannungsfeld. Die Autoren plädieren für eine »Global Health Architecture 2.0« als alternativen Ansatz, der auf kooperative, horizontale Zusammenarbeit (»Co-Development«) abhebt. Gefragt sei dabei, Resilienz, Gerechtigkeit und wechselseitigen Nutzen zu fördern, anstatt auf einseitige Abhängigkeiten oder konfrontative Maßnahmen zu setzen.
Angela Stanzel und Juliana Süß richten den Blick in den Weltraum, der zum Schauplatz staatlicher Machtpolitik geworden ist. China strebe danach, bis 2045 führende Weltraummacht und bis 2049 eine globale Großmacht zu werden. Das Weltraumprogramm der Volksrepublik diene primär militärischen Interessen einer Machtpolitik im All. Dabei integriere Peking seine entsprechenden Ambitionen in geoökonomische Projekte wie die »Belt and Road«-Initiative (BRI) und deren Ableger, die Digitale Seidenstraße (DSR) und den Space Information Corridor (SIC). Auf diese Weise werde versucht, globalen Einfluss auszubauen, vor allem in Afrika. Chinas intransparentes und auf zivil-militärische Fusion angelegtes Vorgehen, so die Autorinnen, stelle eine Herausforderung für Europa dar. Zu begegnen sei ihr mit dem Auf- und Ausbau eigener Fähigkeiten sowie internationaler Partnerschaften.
Annegret Bendiek und Tobias Scholz vergleichen die EU und Indien in ihrem jeweiligen Streben nach digitaler Souveränität. Beide Akteure sähen sich mit sicherheitspolitischen Bedrohungen und geoökonomischen Verschiebungen konfrontiert, was sie veranlasse, ihre digitalen und cyberpolitischen Ansätze zu überdenken. Die EU strebe danach, das Ziel digitaler Souveränität durch Vollendung des Binnenmarkts und eine Regulierung hin zur »offenen strategischen Autonomie« zu erreichen. Dabei setze sie globale Standards und betreibe ein strategisches Abhängigkeitsmanagement. Indien wiederum konzentriere sich stärker auf nationale Sicherheit und eine gezielte Abkoppelung von China. Die beiden Akteure eine das Bestreben, technologische Abhängigkeit zu reduzieren, heimische Kapazitäten in Schlüsseltechnologien wie Halbleitern, 5G und KI aufzubauen und durch bilaterale Kooperationen ihre Markt- und geopolitische Macht zu stärken.
Hanns Günther Hilpert und Paweł Tokarski richten den Blick auf die machtstrategische Dimension internationaler Geld- und Währungspolitik unter den gegenwärtigen Bedingungen einer Dollar-Dominanz. Die Autoren vergleichen die Währungsmachtpolitik der EU und Chinas, wobei sie analysieren, inwiefern die Strategien der beiden Akteure dazu beitragen, Autonomie und Resilienz ihrer jeweiligen Währung zu stärken. Während China hier einen aktiven, geopolitisch motivierten Kurs verfolge, bleibe die EU weitgehend passiv, da politische Fragmentierung, wirtschaftliche Zielkonflikte und institutionelle Barrieren eine kohärente Strategie erschwerten. Digitale Zentralbank-Währungen würden mehr und mehr zu einem maßgeblichen Instrument, wobei China bei dieser Entwicklung den Europäern klar voraus sei.
Armin Haas, Moritz Kapff und Steffen Murau skizzieren Möglichkeiten von Regierungen, auf finanzieller Ebene ihr außen- und sicherheitspolitisches Handlungsvermögen zu vergrößern. Über den Kernhaushalt eines Staates hinaus biete ein komplexes »fiskalisches Ökosystem« aus »bilanzexternen Fiskalagenturen« wie Sondervermögen oder Entwicklungsbanken ungenutzte Spielräume, um zusätzliche Prioritätensetzungen in der Außen- und Sicherheitspolitik zu finanzieren. Dieses Vorgehen stelle eine jahrhundertealte Praxis dar, die allerdings unter dem Schlagwort des Schattenhaushalts stigmatisiert werde. Deutschland stehe vor erheblichen Herausforderungen, die einen gestiegenen Finanzbedarf mit sich brächten und bereits – wie beim Sondervermögen für die Bundeswehr – zu Ausnahmen von der Schuldenbremse geführt hätten. Eine mögliche Nutzung entsprechender Agenturen sei nicht nur sorgfältig zu gestalten, was rechtliche Stellung, Einnahmemodelle und Verschuldungsmöglichkeiten angehe. Darüber hinaus bedürfe es einer fundierten Betrachtung der fiskalischen Nachhaltigkeit und einer Abkehr von vereinfachenden Narrativen über staatliche Haushalte.
Teil I Geoökonomisches Denken
Normative und theoretische Grundlagen geoökonomischen Denkens*
Der Begriff der Geoökonomie hat seit dem Ende des Kalten Krieges eine bemerkenswerte Renaissance erfahren – sowohl in strategischen Debatten als auch in der Forschung. Angesichts des Aufstiegs Chinas, der Erosion der liberalen Weltordnung und wachsender geoökonomischer Spannungen wird wirtschaftliche Macht zunehmend wieder als geopolitische Ressource verstanden. Das Konzept Geoökonomie dient dabei nicht nur der Analyse und Beschreibung globaler Ordnungsverschiebungen, sondern fungiert zugleich als normativ-performatives Handlungsmodell: Es strukturiert Wahrnehmungen, transportiert Wertvorstellungen, schafft politische Wirklichkeiten und steckt außenpolitische Handlungsspielräume ab.1
Die normative Dimension geoökonomischer Denkweisen ist historisch gewachsen. Bereits in der Zwischenkriegszeit war der Begriff umstritten und Ausdruck konkurrierender liberaler und nationalkonservativer Ordnungsideen. Auch heute prägen unterschiedliche normative Prämissen die geoökonomische Debatte. Auf der einen Seite finden sich die Anhänger des sogenannten realistischen Ansatzes, die auf Kontrolle, Autarkie und geopolitisch motivierte Wirtschaftspolitik setzen, auf der anderen die Befürworter liberaler Modelle, die Interdependenz, Wettbewerbsorientierung und regelbasierte Kooperation betonen. Die folgende Rekonstruktion geoökonomischer Denkschulen zielt darauf ab, deren ideelle Grundlagen in ihrer normativen Vielfalt darzustellen. Dieses Verständnis ist Voraussetzung, um die gegenwärtigen Herausforderungen außenwirtschaftlicher Ordnungsbildung ideologisch und strategisch einordnen zu können.
Eine kleine Begriffsgeschichte der Geoökonomie
Konzepte wie Geoökonomie sind keine statischen Begriffe, sondern Ausdruck historischer Deutungsprozesse. Bedeutungen, Konnotationen und Anwendungen unterliegen einem stetigen Wandel, beeinflusst durch ideologische Strömungen, politische Machtverhältnisse und intellektuelle Diskurse. Die historische Einordnung des Konzepts hilft, ideengeschichtliche Traditionslinien und normative Grundannahmen offenzulegen – ein wichtiger Schritt im Umgang mit politisch sensiblen Begriffen wie Geoökonomie oder Geopolitik. Historische Reflexion ist zugleich eine Frage politischer Verantwortung: Wie Bachmann und Toal2 am Beispiel des Begriffs »Lebensraum« zeigen, kann die unreflektierte Adaption historisch belasteter Konzepte weitreichende politische Konsequenzen haben. Auch der Begriff Geoökonomie ist hiervon nicht ausgenommen. Seine Ursprünge im deutschen Denken der Zwischenkriegszeit sind weitgehend vergessen – und doch hochrelevant für aktuelle Debatten über nationale Wirtschaftsinteressen und internationale Ordnung.
Arthur Dix (1875–1935), nationalkonservativer Publizist und Wissenschaftler, verwendete den Begriff der Geoökonomie bereits in den 1920er Jahren und lieferte damit einen der frühesten konzeptionellen Beiträge zur geoökonomischen Debatte. Seine Schriften, etwa Geoökonomie: Einführung in die erdhafte Wirtschaftsbetrachtung (München 1925) richteten sich an akademische und politische Kreise. Für Dix bedeutete Geoökonomie die unausweichliche Anbindung der wirtschaftspolitischen Zielsetzung aller Staaten an geographische Gegebenheiten – insbesondere Boden und Klima – und an ihr Bevölkerungspotential.3 Diese »erdhafte Betrachtung« ökonomischer Prozesse war komplementär zur Geopolitik aufzufassen, die er auf die raumbezogene Ausrichtung der Außenpolitik beschränkte. Er unterschied klar zwischen dem »Staatskörper« als Gegenstand der Geopolitik und dem »Wirtschaftskörper« als Gegenstand der Geoökonomie.4 Geoökonomie war bei Dix ein staatliches Steuerungsinstrument zur Positionierung der eigenen Volkswirtschaft im internationalen Wettbewerb. Raum wurde als politisch strukturierende Kategorie verstanden. Dix’ Perspektive spiegelt ein autoritär-nationales Weltbild wider: Geoökonomisches Denken ist Ausdruck eines kollektiven Machtanspruchs, der ökonomische Planung in den Dienst nationaler Selbstbehauptung stellt. Dieses Verständnis prägt bis heute die realistische Geoökonomie, wie Hanns W. Maulls Ausführungen zur langfristigen Umsetzung geoökonomischer Ordnungsentwürfe in dieser Studie deutlich zeigen.5
Die festen Größen im Konzept der realistischen Geoökonomie sind Kontrolle, Besitz und Abgrenzung von knappen wirtschaftlichen Räumen.
Bis heute ist die realistische Geoökonomie einem territorial gebundenen Staatsverständnis verhaftet. Nach ihrer Lehre gelten geographische Lage, natürliche Ressourcen und strategische Position als Konstanten, die außenpolitisches Verhalten und internationale Machtstrukturen bestimmen. Wirtschaftlicher Wettbewerb verläuft entlang klassischer Grenzziehungen, ökonomischer Raum wird als geopolitisch erweiterter Raum begriffen. Raum erscheint als knappes Gut und Quelle von Macht und Wohlstand: Politische und ökonomische Ordnung werden dabei in geographisch fixierten Räumen verankert gedacht. Diese Vorstellung impliziert eine Nullsummenlogik: Raum- und Machtgewinne eines Staates erfolgen zwangsläufig auf Kosten anderer. Die festen Größen des aus diesen Prämissen resultierenden Denkens in exklusiven Ordnungen sind Kontrolle, Besitz und Abgrenzung. Zudem ist das realistische Raumverständnis deterministisch: Die Lage bzw. die Verortung im Raum bestimmt Interessen, Handlungsspielräume und strategische Ziele. Der Staat erscheint als territorial gebundener Akteur, dessen Macht aus Raumkontrolle erwächst. Dieser Exklusivitätsanspruch auf Raum geht mit einem normativ konservativen und dichotomen Weltbild einher – »wir« gegen »sie«: Wirtschaftsräume sind zu erobern und zu sichern, Austausch wird als Bedrohung und wirtschaftlicher Wettbewerb als Nullsummenspiel verstanden.
Im Gegensatz dazu entwickelte Wilhelm Röpke (1899–1966), liberaler Ökonom und Kritiker des Nationalsozialismus, eine marktorientierte, individualistische Konzeption der Geoökonomie. Geographische Gegebenheiten wirken hier integrierend auf Volkswirtschaften und schaffen strukturelle Verbindungen zwischen staatlichen und wirtschaftlichen Räumen. Da diese nie vollständig deckungsgleich sind, entsteht ein geoökonomischer Expansionsdruck, der politische Annäherung begünstigt. Wirtschaftliche Integration ist damit Folge geographischer Gegebenheiten und Vorläufer politischer Integration. Selbst scheinbar autarke Staaten können sich dieser Dynamik auf Dauer nicht entziehen. Röpke betrachtete protektionistische und autarkistische Politiken als reaktionäre Gegenbewegungen, die letztlich machtlos gegenüber den Kräften der wirtschaftlichen Differenzierung und geoökonomischen Integration sind. Seine Auffassung, dass geographisch bedingte wirtschaftliche Interdependenz politisch integrierend wirkt, findet sich bis heute in liberalen Theorien der internationalen Beziehungen wieder – insbesondere in Arbeiten, die ökonomische Verflechtungen als friedensstiftenden Faktor betonen.6
Im Gegensatz zur realistischen Geoökonomie, die auf das Territorium fixiert ist, erkennen die Verfechter der liberalen Geoökonomie die Deterritorialisierung wirtschaftlicher Macht an. Nach ihrer Überzeugung haben technologischer Fortschritt, digitale Vernetzung und globale Interdependenz die strategische Bedeutung von geographischer Lage relativiert. Seit der industriellen Revolution und verstärkt durch die Wissensökonomie trete »Land« als Produktionsfaktor in den Hintergrund. Immaterielle Ressourcen wie Wissen, technologische Kapazitäten und Netzwerke gewännen an Bedeutung – Faktoren, die nicht primär territorial gebunden sind. Vertreter der liberalen Geoökonomie begreifen Raum als Ergebnis politischer und wirtschaftlicher Praktiken: dynamisch, relational und offen. Macht resultiert nach ihrer Theorie nicht mehr aus physischer Kontrolle über Raum, sondern aus der Positionierung in globalen Interaktionsnetzwerken. Nationale Territorien verlören an exklusiver Bedeutung zugunsten funktionaler Verflechtungen. Dieses Verständnis von Raum als mehrdimensionalem, relationalem Geflecht immaterieller Infrastrukturen jenseits klassischer Territorialgrenzen steht im Einklang mit der von Nadine Godehardt in ihrem Beitrag beschriebenen volumetrischen Wende. Die liberale Geoökonomie bietet damit ein konzeptionelles Fundament, um auch neuartige Raumlogiken, etwa transnationale digitale Infrastrukturen oder satellitengestützte Netzwerke, als geoökonomisch relevante Ordnungsräume zu begreifen.
Dieser liberale Ansatz eröffnet einen normativ inklusiven Horizont: Statt Kontrolle über begrenzte Räume zu maximieren, strebt die liberale Geoökonomie funktionale Vernetzung, Koordination zwischen Akteuren und flexible Anpassung an sich ständig verändernde Räume an. Wirtschaftlicher Austausch wird als Positivsummenspiel gedacht, in dem Integration Wohlstand schafft. Röpkes Ansatz steht damit für einen Strang geoökonomischen Denkens, der wirtschaftliche Integration als Motor politischer Kooperation begreift und damit ein normatives Gegengewicht zu autoritär geprägten Konzepten geoökonomischer Staatlichkeit bildet.
Geoökonomie: Zwischen strategischer Machtausübung und kooperativer Wohlstandsordnung
Die gegenwärtige Forschung unterscheidet zwei analytische Ansätze: einen Mittel-Ansatz, bei dem wirtschaftliche Mittel zur Erreichung politischer Ziele eingesetzt werden, und einen Ziel-Ansatz, bei dem politische Mittel (privat-)wirtschaftlichen Zwecken dienen. In beiden Modellen ist der Staat primärer Akteur. Heute dominiert der Mittel-Ansatz die politische Praxis und akademische Diskussion: Geoökonomie erscheint als Fortsetzung klassischer Geopolitik mit ökonomischen Machtmitteln wie Sanktionen, Investitionskontrollen oder Exportrestriktionen. Ziel ist die Durchsetzung strategischer politischer Interessen.7 Zwei gegensätzliche, idealtypische Paradigmen prägen die Debatte: ein realistisches, machtzentriertes Modell und ein liberales, wohlstandsorientiertes.
Realistische Geoökonomie fußt auf einem konfrontativen Paradigma (Nullsummenspiel): Marktmechanismen werden funktionalisiert, um geopolitische Rivalität auszutragen. Staaten konkurrieren um Handelsströme, Produktionsstandorte und strategische Industrien, ähnlich wie um Territorien. Außenwirtschaftliche Stärke (Mittel) dient nicht primär der Wohlstandsmehrung, sondern der außenpolitischen Durchsetzungsfähigkeit und Machtabsicherung (Ziel) – analog zur Geopolitik. Demgegenüber strebt die liberale Geoökonomie gegenseitige Wohlstandsmehrung an (Positivsummenspiel): Sie versteht wirtschaftliche Interdependenz als Chance für Frieden, Stabilität und Prosperität. Der Staat agiert nicht als dominanter Dirigent, sondern als Rahmensetzer, der wirtschaftliche Freiheit ermöglicht und nichtstaatliche Akteure als Partner anerkennt – im Einklang mit institutionellen Theorien der internationalen Beziehungen.
Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Wahl der Instrumente: Realistische Geoökonomie setzt auf kurzfristige Zwangsmaßnahmen wie Sanktionen oder Handelsverbote, bei denen asymmetrische Machtverhältnisse ausgenutzt werden. Diese Mittel sind eskalationsanfällig, ineffizient und wirtschaftlich nachhaltig schädlich: Opportunitätskosten und langfristige Wettbewerbsverluste werden systematisch vernachlässigt. Freier Handel und fairer Wettbewerb werden behindert, Folgen sind Marktverzerrungen, Unsicherheiten und Abschottung. Demgegenüber setzt die liberale Geoökonomie auf langfristige Kooperationsinstrumente wie Handelsverträge, Investitionspartnerschaften oder Technologietransfers. Ihr Mittel ist nicht Zwang, sondern Anreiz: Durch wirtschaftliche Verflechtung entsteht politische Stabilität. Im Vordergrund steht nicht der kurzfristige politische Gewinn, sondern nachhaltige Wohlstandsschaffung durch bewusste Einbeziehung langfristiger Effekte und eines gesamtgesellschaftlichen Mehrwerts.
Unter dem Einfluss von Denktraditionen der realistischen Geoökonomie erfahren wirtschaftliche Prozesse eine sicherheitspolitische Aufladung: Austausch mit autoritären Staaten wird potentiell als Bedrohung wahrgenommen, Märkte verlieren ihren Charakter als Räume freiwilliger Kooperation, Investitionen und Handel geraten unter Generalverdacht. Die Folge ist eine präventive Sicherheitslogik: Handelsbarrieren entstehen im Namen der nationalen Sicherheit, Märkte fragmentieren, wirtschaftliche Kooperation weicht Misstrauen. Beispiele für einen solchen Ansatz sind die US-Zölle auf Stahl und chinesische Zölle auf australische Gerste und Wein. Derartige Maßnahmen gehen zu Lasten von Planungssicherheit und rationaler Entscheidungsfindung.
Schließlich offenbart sich eine grundlegende Differenz im Verhältnis von Zielen und Mitteln: Realistische Geoökonomie folgt einem linearen Kausalmodell – politische Ziele werden extern definiert, wirtschaftliche Mittel rein instrumentell eingesetzt. Der liberale Ansatz beruht auf dem Glauben an ein rekursives Verhältnis: Der Einsatz wirtschaftlicher Mittel kann politische Zielstrukturen verändern, etwa wenn Handelskooperation politische Annäherung fördert. Geoökonomie wird so zum normativen Ausdruck außenpolitischer Philosophien – entweder autoritär und kontrollorientiert oder kooperativ, partizipativ und entwicklungsfreundlich.
Normative Divergenzen geoökonomischer Denkschulen
Ein zentrales normatives Unterscheidungsmerkmal realistischer und liberaler Geoökonomie betrifft die Frage, was als nationales Interesse gilt – und wer dieses definiert. Die Vertreter der realistischen Geoökonomie folgen einem objektivistischen Ansatz: Nationale Interessen gelten als eindeutig existent, rational ableitbar und primär im Zuständigkeitsbereich staatlicher Eliten oder Expert:innen. Der Staat erscheint als homogene Einheit (»black box«), gesellschaftliche Präferenzen spielen eine untergeordnete Rolle.8 Dieses Verständnis knüpft an die illiberale Geoökonomie von Dix an, der eine technokratische Steuerung nationalwirtschaftlicher Interessen propagierte. Es birgt paternalistische und demokratietheoretisch problematische Implikationen: Nur »echte« Expert:innen sollen wissen, was im besten Interesse der Nation liegt.9 In den 1990er Jahren etwa unterstützten US-Konzerne wie Chrysler und Ford geoökonomische Narrative, mit dem Ergebnis, dass vermeintlich unabhängige Expert:innen industriepolitische Eingriffe zur Rettung der US-Automobilbranche forderten.10
Demgegenüber basiert ein liberaler geoökonomischer Ansatz auf einem subjektivistischen Verständnis nationaler Interessen. Der Staat erscheint als Ausdruck vielfältiger gesellschaftlicher Perspektiven, was einen demokratietheoretisch inklusiven Anspruch begründet: Außenpolitik soll ebenso partizipativ gestaltet werden wie Innenpolitik.11 Dieses Denken steht in der Tradition Wilhelm Röpkes, der wirtschaftspolitische Entscheidungen als legitimationspflichtige Prozesse verstand. Nichtstaatliche Akteure gelten als aktive Mitgestalter geoökonomischer Politik; ihre Einbindung ist Voraussetzung für Akzeptanz und Wirksamkeit außenwirtschaftlicher Maßnahmen. Das deutsche Auswärtige Amt etwa setzte bei der Entwicklung außenpolitischer Leitlinien gezielt auf Konsultationen mit zivilgesellschaftlichen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Akteuren12 – ebenso bei konkreten Beschlüssen wie den Sanktionen gegen Russland.13
Realistische Geoökonomie setzt auf Zwang, Druck und Einschüchterung, ihr liberaler Gegenpart auf Freiwilligkeit, Gegenseitigkeit, positive Anreize.
Ein zweiter zentraler Unterschied liegt in der operativen Logik. Realistische Geoökonomie setzt auf konfrontative Mittel wie Zwang, Druck und Einschüchterung, um relative Vorteile gegenüber anderen Staaten durchzusetzen.14 Wirtschaftliche Instrumente werden primär als Machtressourcen verstanden, nichtstaatliche Akteure eines Zielstaats instrumentalisiert und delegitimiert. Dieser Ansatz folgt einer Nullsummenlogik, die geopolitische Spannungen eher verschärft als abbaut. Im Gegensatz dazu plädiert die liberale Geoökonomie für eine kooperationsorientierte Handlungsweise: Ökonomische Beziehungen basieren auf Freiwilligkeit, Gegenseitigkeit und positiver Anreizsetzung. Politischer Druck entsteht – wenn überhaupt – aus demokratischen Erwartungshaltungen im Inland, nicht durch äußeren Zwang. Macht wird nicht als Kontrolle, sondern als Ermöglichung interpretiert. Wirtschaftliche Interdependenz und gemeinsame Wertschöpfung fördern langfristige Stabilität und partnerschaftliche Beziehungen.
Ein drittes normatives Unterscheidungsmerkmal betrifft das Verhältnis zu wirtschaftlicher Freiheit und Eigentum. Die realistische Geoökonomie betrachtet wirtschaftliche Mittel als strategische Ressourcen unter staatlicher Hoheit. Eigentumsrechte werden dem Primat nationaler Sicherheit untergeordnet. Unternehmen werden zum Instrument staatlicher Interessen, staatskapitalistische Tendenzen und Marktverzerrungen sind hier eine unvermeidliche Begleiterscheinung. Liberale Eigentumsnormen werden im Namen der nationalen und wirtschaftlichen Sicherheit beschnitten. Demgegenüber betrachtet die liberale Geoökonomie wirtschaftliche Freiheit und Eigentumsschutz als Grundpfeiler der liberalen Ordnung.15 Staatliche Steuerung erfolgt lediglich durch Rahmensetzung und demokratische Legitimation, nicht durch Kontrolle. Eigentum wird respektiert, nicht geopolitisch instrumentalisiert. Während die realistische Variante kurzfristige Machtgewinne anstrebt, kalkuliert die liberale Geoökonomie langfristig, effizient und gesellschaftlich integrativ. Ihre normativen Prämissen stärken die internationale Kooperation, den Wettbewerb und eine regelbasierte Ordnung und bilden ein Gegengewicht zu autoritären Entwicklungsmodellen wie dem Beijing Consensus.16
Schlussbetrachtung
Geoökonomisches Denken ist mehr als eine technokratische Frage außenwirtschaftlicher Steuerung oder eine bloße Zweck-Mittel-Kalkulation: Es berührt grundlegende normative Entscheidungen über das Verhältnis von Staat und Gesellschaft, Macht und Kooperation sowie Freiheit und Kontrolle. Realistische und liberale Ansätze repräsentieren dabei konkurrierende Weltbilder mit unterschiedlichen politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Implikationen. Die gegenwärtige Wiederbelebung nationalistischer und illiberaler Narrative im Sinne von Dix’ »nationalwirtschaftlicher Gemeinwirtschaftsinteressen« zeigt, dass Geoökonomie nicht nur ein analytisches Instrument, sondern ein normativ aufgeladenes Projekt ist, dessen theoretische Grundannahmen kritisch reflektiert werden müssen. Aktuelle Debatten über wirtschaftliche Souveränität, »strategische Autonomie« und geoökonomische Rivalitäten tragen vielfach Züge eines Denkens, das ideengeschichtlich näher bei Dix als bei Röpke liegt. Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe politischer Entscheidungsträger:innen und der Wissenschaft, Geoökonomie nicht nur als Machtinstrument, sondern als gestaltbares Ordnungsmodell zu verstehen.
Gleichzeitig gibt die ideengeschichtliche Entwicklung Anlass zu vorsichtiger Zuversicht. Selbst Vertreter realistischer Denktraditionen wie Edward Luttwak erkennen an, dass historische Muster keine unveränderlichen Vorgaben für die Zukunft darstellen. Konfrontative Logiken können durchbrochen werden – etwa durch die Umlenkung geopolitischer Rivalitäten auf gemeinsame globale Herausforderungen wie den Umwelt- und Klimaschutz: Internationale Institutionen wie ein »Super-GATT« könnten geoökonomische Konflikte systemisch entschärfen und in kooperative Bahnen lenken.17
Geoökonomisches Denken formuliert »die Logik des Krieges in der Grammatik des Handels«, so Edward Luttwak in einem vielbeachteten Aufsatz von 1990.1 Etwas allgemeiner ausgedrückt, befasst sich Geoökonomie nach dieser Lesart mit der Frage, wie sich nationale außenpolitische Ziele mit wirtschaftlichen Mitteln verfolgen lassen. Dabei rückt nicht primär die Geographie wirtschaftlicher Aktivitäten in den Blick.2 Mit geoökonomischem Denken ist einerseits die Abkehr von einer globalen Perspektive verbunden, in der Geographie und staatliche Grenzen keine Bedeutung mehr zu haben scheinen. Zum anderen positioniert sich geoökonomisches Denken zumeist im Kontext der Geopolitik und bekennt sich insofern zu einer »realistischen«, also einer macht- und sicherheitszentrierten Betrachtung internationaler Beziehungen.3 Einige Implikationen, die ein solches machtpolitisches Denken über Wirtschaftstätigkeit für internationale Ordnung hat, sollen im Folgenden skizziert werden.
Was ist »die« internationale Ordnung?
Der Begriff »internationale Ordnung« (bzw. »die internationale Ordnung«) wird derzeit häufig recht unpräzise verwendet.4 Die internationale Ordnung ist, wie jede politische Ordnung, ein System von Prinzipien, Normen und Regelwerken, die das Verhalten in der zu ordnenden Gesellschaft regeln sollen – und in der Praxis auch tatsächlich mehr oder minder befolgt werden und somit ein gewisses Maß an Verhaltenssicherheit und damit Vorhersehbarkeit schaffen.5 Jede politische Ordnung beruht auf Machtstrukturen, die bestrebt sind, die Regelwerke durchzusetzen; diese Machtstrukturen sind jedoch nicht identisch mit der Ordnung, sondern bilden lediglich ihre Grundlage.6 Die jeweiligen Prinzipien, Normen und Regelwerke politischer Ordnungen können sehr unterschiedlich ausfallen; bestimmend sind die jeweils dominanten Ideologien. Die internationale Ordnung (auch: Weltordnung) ist die größte, umfassendste politische Ordnung, sie umfasst die Weltgesellschaft und die Staatengemeinschaft.7 Die Institutionen der Vereinten Nationen repräsentieren diese Weltordnung, wobei ihre wichtigsten Organe legislative (Sicherheitsrat, Vollversammlung), exekutive (Generalsekretär und Generalsekretariat) und judikative (Internationaler Gerichtshof) Funktionen abbilden, die sich von den Funktionsweisen entsprechender Organe in einer nationalstaatlichen Ordnung unterscheiden.
Während es also durchaus berechtigt ist, von der internationalen Ordnung zu sprechen, ist zugleich festzuhalten, dass diese Ordnung keineswegs nur aus ihren zentralen Organen und Institutionen besteht, sondern auch viele Teilordnungen umfasst, die wiederum auf den nationalstaatlichen Ordnungen aufbauen.8 Die Teilordnungen beziehen sich einerseits auf bestimmte Regionen, also etwa Europa, Ostasien oder Nordamerika, andererseits auf spezifische funktionale Zusammenhänge, wie etwa den internationalen Handel, den Klimawandel oder die zivile und militärische Nutzung der Kernenergie. Zwischen den Ebenen und den einzelnen Teilordnungen bestehen horizontale und vertikale Wechselwirkungen (»Interferenzen«); stabilisierende wie destabilisierende Impulse können entsprechend über die Grenzen von Teilordnungen hinweg andere (Teil-)Ordnungen beeinflussen.
Die gegenwärtige Verfassung der internationalen Ordnung ist wesentlich komplexer, als dies in der Regel gesehen wird.
Zusammenfassend: Die gegenwärtige Verfassung der internationalen Ordnung ist wesentlich komplexer, als dies in der Regel gesehen wird. Tatsächlich lassen sich analytisch mindestens drei Ebenen politischer Ordnung unterscheiden: die unterste nationalstaatliche, die mittlere, aus regionalen bzw. funktionalen Teilordnungen bestehende Ebene und die globale Ebene. Die Entwicklungen auf den drei Ebenen dieser Ordnung und in den Segmenten der mittleren Ebene, den vielfältigen Teilordnungen, verlaufen keineswegs zeitlich synchron und inhaltlich gleichgerichtet. So berechtigt es ist, die Weltordnung gegenwärtig im Umbruch zu sehen, so wenig folgt daraus schon, dass dies für alle ihre Teilordnungen gleichermaßen gilt. Während sich etwa die regionale Sicherheitsordnung in OSZE-Europa fundamental verändert präsentiert, ist diejenige Ostasiens (noch) von Stabilität gekennzeichnet – allerdings von einer zunehmend prekären. Dies gilt ebenso für funktionale Teilordnungen: Die Welthandelsordnung befindet sich schon seit längerer Zeit in einem Prozess tiefgreifenden Wandels,9 dagegen erschienen die internationale Währungsordnung und die Verfassung der internationalen Finanzmärkte noch bis vor kurzem weitgehend robust.10 Auf der Ebene der nationalstaatlichen Ordnungen schließlich vollziehen sich ebenfalls sehr unterschiedliche Entwicklungen, wobei allerdings weltweit liberale Demokratien zusehends unter Druck geraten und autokratische Herrschaftsordnungen auf dem Vormarsch sind.11 Der Umbruch der internationalen Ordnung präsentiert sich aus dieser Perspektive als ein vieldimensionaler, facettenreicher und risikoreicher Wandlungsprozess, in dem die alte, liberale Welt mit einer neuen, realistischen oder eben geoökonomischen Welt ringt.12
Liberale Ordnungen
Was kennzeichnet eine liberale Weltordnung? Darauf gibt ihre historische Entwicklung unterschiedliche Antworten. Die wichtigsten Merkmale der ersten liberalen Weltordnung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren der Freihandel, freie Kapitalmärkte und eine internationale Währungsordnung auf der Basis des Goldstandards, aber auch das Recht auf exklusive Kolonialreiche. In der Innenpolitik bereitete der Liberalismus den Weg für den Rechtsstaat, für politische Partizipation durch gewählte Parlamente (wobei das Wahlrecht sehr selektiv verliehen wurde) sowie für die Abschaffung der Sklaverei als konkreten Ausdruck des Engagements für allgemeine Freiheits- und Menschenrechte.
Einen neuen Anlauf zum Aufbau einer liberalen Weltordnung unternahmen 1945 die USA und Großbritannien. Dieser scheiterte jedoch: Das Projekt wurde rasch vom Ost-West-Konflikt überlagert und durch die Weltordnung des Kalten Kriegs abgelöst. Sie überlebte jedoch als Teilordnung für die Erste (westliche) und weite Teile der Dritten Welt des globalen Südens. Wirtschaftlich waren zentrale Prinzipien dieser Ordnung die schrittweise Liberalisierung des Welthandels und ein Währungssystem fester Wechselkurse, mit dem Dollar als Leitwährung. Der Staat übernahm in dieser Ordnung nach innen wie nach außen eine aktiv gestaltende Rolle mit dem Ziel, Wiederaufbau, Modernisierung, Industrialisierung und Entwicklung voranzutreiben und Vollbeschäftigung bzw. soziale Absicherung zu gewährleisten. Der politische Liberalismus betonte universale Menschenrechte, das Selbstbestimmungsrecht der Völker (Entkolonialisierung), politische Partizipation (allgemeine, gleiche und freie Wahlen) sowie gesellschaftliche Ausgewogenheit (Sozialstaat).13
Das Währungssystem fester Wechselkurse zerfiel zu Beginn der 1970er Jahre; es wurde abgelöst von einem Mischsystem, in dem die Wechselkurse vom Mit- und Gegeneinander der Devisenmärkte und Zentralbanken bestimmt wurden und somit fluktuierten. Zugleich wurden die nationalen Volkswirtschaften zunehmend für internationale Kapitalströme geöffnet. In der liberalen Weltordnung kam es in der Folge zu einer weiteren bedeutsamen Transformation: der neoliberalen Wende seit Ende der 1970er Jahre. Dem Neoliberalismus ging es darum, den Einfluss des Staates zurückzudrängen und seine Rolle durch private Akteure und Marktprozesse zu ersetzen; Deregulierung und Privatisierung verdrängten das Prinzip der sozialen Ausgewogenheit.14 Mit dem Ende des Ost-West-Konflikts setzte sich diese neoliberale Variante einer liberalen internationalen Ordnung als universale Ordnung durch. Der Washington-Konsens – die Vorstellung, dass Wirtschaftspolitik vor allem den Rückzug des Staates aus den von ihm übernommenen vielfältigen Aufgaben zu organisieren habe, um Freiraum für Marktprozesse zu schaffen, repräsentierte den gemeinsamen Nenner dieser neoliberalen Ideologie.
Trotz dieser Unterschiede im Einzelnen lassen sich auch etliche Gemeinsamkeiten feststellen, die sämtliche liberalen politischen Ordnungen teilen. Hierzu zählen die wirtschaftlichen Prinzipien der (internationalen) Arbeitsteilung, der Modernisierung und Industrialisierung durch immer effizienteren Einsatz von Ressourcen und der Öffnung nationaler Volkswirtschaften und Gesellschaften für alle Formen des Austauschs mit anderen – vom Handel mit Gütern und Dienstleistungen über Kapitalflüsse, Migration und Tourismus bis hin zum Austausch wissenschaftlicher Erkenntnisse, Informationen und kultureller Produkte. Das Ergebnis waren die Ausweitung, Intensivierung und Beschleunigung von Globalisierungsprozessen: Der wirtschaftliche Liberalismus ist demnach verknüpft mit der Globalisierung. Politisch postulierte der Liberalismus universelle Menschenrechte, individuelle und kollektive Selbstbestimmung, Rechtsstaatlichkeit, die Einhegung von Macht durch Verfahren der Gewaltenteilung und ‑verschränkung und die Partizipation der Bevölkerungen an politischen Entscheidungen. Krieg und Gewaltanwendung sollten zurückgedrängt und tabuisiert werden, Verrechtlichung auch die zwischenstaatlichen Beziehungen bestimmen. Grundlegende Unterschiede zwischen den Spielarten liberaler Ordnungspolitik betrafen und betreffen vor allem den Stellenwert sozialer Ausgewogenheit, den Umgang mit den Implikationen unterschiedlicher individueller und kollektiver Identitäten und die Rolle des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft.15
Demokratische Innenpolitik und Geoökonomie sind miteinander vereinbar, wenn außenpolitische Risiken und Bedrohungen wahrgenommen werden.
Die liberalen Ordnungsentwürfe lassen deutliche Übereinstimmungen bei zentralen Prinzipien und Normen für die Organisation der inner- wie der zwischenstaatlichen Politik erkennen. Die Koinzidenz einer erodierenden liberalen internationalen Ordnung mit der Konjunktur autoritärer Herrschaftsordnungen in den letzten zwanzig Jahren ist also keineswegs zufällig: Wie liberale Ordnungspolitiken im Innern und international miteinander verknüpft sind, gilt das auch mit autoritären Vorzeichen. Allerdings besteht diese Verknüpfung von autoritärer Innenpolitik und geoökonomischer Außenwirtschaftspolitik nicht zwangsläufig, es gibt Ausnahmen. Singapur etwa ist ein autoritär regierter Staat, der aufgrund seiner spezifischen Position und Lage eine konsequent liberale Außenwirtschaftsstrategie verfolgt und Sanktionen gegen Russland mitträgt. Umgekehrt waren die Außenwirtschaftspolitiken der EU, aber auch der USA keineswegs durchgängig liberal im Sinne der Marktöffnung; demokratische Innenpolitik und Geoökonomie sind insbesondere dann miteinander vereinbar, wenn außenpolitische Risiken und Bedrohungen wahrgenommen werden.
Geoökonomische Ordnungsentwürfe
In einer geoökonomisch ausgerichteten internationalen Ordnung dominieren die Prinzipien der nationalen Sicherheit und der Machtkonkurrenz. Technologische Innovation16 und wirtschaftlicher Austausch17 folgen der Logik des Erwerbs potentieller Machtvorteile durch technologische und wirtschaftliche Überlegenheit einerseits und möglicher Verwundbarkeiten andererseits, die politische Erpressbarkeit implizieren könnten. Machtbezogenes Denken begünstigt die Hierarchisierung sozialer Beziehungen in politischen Ordnungen; daher spielen Einflusszonen, in denen Großmächte kleinere Nachbarstaaten an sich binden und abhängig halten, in der Geoökonomie eine bedeutsame Rolle. Der Bezug auf den Nationalstaat befördert Nationalismus als eine wichtige handlungsleitende Einstellung. Aus der Verbindung der hierarchisierenden Funktion von Machtdenken mit der Idee der Nation bzw. des Staatsvolkes entstehen – nicht zwangsläufig, aber häufig – nationalistische Ideologien, in denen die eigene Nation überbewertet wird. Zu diesen können auch patriarchale Formen der Sozialpolitik treten, die dem Staatsvolk suggerieren wollen, sein Wohlergehen stelle ein vordringliches Anliegen des Staates dar.18
Zwei Varianten geoökonomischer Ordnungsentwürfe lassen sich derzeit unterscheiden. Die erste, revisionistische Variante ist langfristig orientiert und strebt nach einem schrittweisen, aber weitreichenden Umbau der internationalen Ordnung. Dabei geht es vor allem darum, die Weltordnung im Sinne autoritärer Regime umzugestalten und so Konsonanz zwischen innen- und weltpolitischen Ordnungsstrukturen zu schaffen. Diese Ausprägung setzt auf eine Mischung aus machtpolitischem Druck und wirtschaftlichen Sanktionen, aber auch auf wirtschaftliche Anreize und Überredung/Überzeugung durch Diplomatie und kulturelle Einflussnahme. Die Volksrepublik China repräsentiert diese Variante exemplarisch.19 Zu ihren revisionistischen Bestrebungen gehören Versuche, geltende völkerrechtliche Normen im Sinne ihrer Vorstellungen umzudeuten.20 Aber auch demokratische Staaten wie Brasilien, Südafrika oder Indien unterstützen einen grundsätzlichen Umbau der Weltordnung, wie ihn Staaten aus dem globalen Süden fordern.
Die zweite Variante zielt vor allem auf die Zerstörung der liberalen internationalen Ordnung von innen und von außen, bietet dazu aber kein alternatives Konzept, das über die Behauptung des partikulären Machtanspruchs des amtierenden Regimes hinausginge. Wenngleich Multilateralismus von Vertretern dieser Variante formal durchaus befürwortet wird, sind sie faktisch nicht bereit, sich durch multilaterale Vereinbarungen binden zu lassen. Diese Variante setzt vor allem auf Machtpolitik in Form von Subversion, Zwang und Gewalt; das zentrale Prinzip ist hier das Recht des Stärkeren. Das Russland Wladimir Putins,21 aber auch das Amerika Donald Trumps repräsentieren diese zweite Variante geoökonomischer Ordnungsvorstellungen.
Während in der Ära der Globalisierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen den Ausprägungen der wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den nationalen Volkswirtschaften im Allgemeinen nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde,22 rücken sie im geoökonomischen Denken in den Mittelpunkt. Diese wechselseitigen Abhängigkeiten sind in aller Regel asymmetrisch. Insbesondere wenn sie gesamtwirtschaftlich kritische Bereiche eines Staates betreffen, bestehen Risiken und Gefahren als Folge struktureller Verschiebungen, die bestehende Verwundbarkeiten verschärfen oder neue herausbilden, sowie im Zuge krisenhafter Störungen in den Interdependenzbeziehungen. Diese können durch Naturkatastrophen oder Unfälle (wie die tagelange Blockade des Suezkanals durch ein havariertes Containerschiff) verursacht werden, sie können aber auch darauf zurückgehen, dass Akteure wirtschaftliche Verwundbarkeiten anderer für ihre eigenen politischen Zwecke instrumentalisieren (»weaponizing interdependence«).23
Zu den strukturellen Aspekten, die in der Geoökonomie besondere Aufmerksamkeit finden, gehören Verschiebungen in der relativen Wettbewerbsfähigkeit von Schlüsselindustrien, in den technologischen Innovationspotentialen und zwischen Währungen und Kapitalmärkten.24 Aus diesen Verschiebungen können auf längere Sicht nicht nur neue Verwundbarkeiten entstehen, sondern auch Rückwirkungen auf die wirtschaftlichen, politischen und militärischen Machtrelationen zwischen Staaten. Eindämmen und reduzieren lassen sich diese Risiken und Gefahren durch kluge Industriepolitik.
Geoökonomische Handlungsoptionen liberaler Demokratien
Eine Wirtschaftspolitik, in der auf nationale Sicherheit und Macht ausgerichtete Zielsetzungen breiten Raum einnehmen, steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu einer liberaldemokratischen Innenpolitik; insbesondere besteht die Gefahr der Herausbildung von Sicherheitsstaatlichkeit, in der die Innenpolitik dem Diktat der Abwehr (realer oder imaginierter) äußerer Bedrohungen unterworfen wird.25 Analoge Probleme kann geoökonomisches Denken auch dann hervorrufen, wenn es das liberale Credo von Effizienz durch Wettbewerb und von komparativen Kostenvorteilen zugunsten nationaler Sicherheitserwägungen vernachlässigt. Allerdings stehen in demokratischen Staaten geoökonomische Entscheidungen und Politiken unter größerem Druck, sich gegenüber organisierten Interessen, zivilgesellschaftlichen Akteuren und kritischer Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Zudem haben demokratische Gesellschaften von Offenheit nach außen grundsätzlich weniger zu befürchten als autoritäre oder totalitäre Systeme. Sie bringen deshalb bessere Voraussetzungen mit für klug abwägende geoökonomische Entscheidungen, die bei der Umsetzung sicherheits- und machtpolitischer Ziele Effizienzkriterien berücksichtigen und für nachträgliche Korrekturen offenbleiben. Dabei geht es aus geoökonomischer Perspektive um zwei Problembereiche: den Umgang mit akuten Störungen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen infolge von Naturkatastrophen, Störfällen oder politisch motivierten Disruptionen sowie um strukturelle Verschiebungen in den wirtschaftlichen Machtverhältnissen.
Um die Risiken und Gefahren beherrschbar zu machen, die aus schockartigen Störungen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen entstehen können, sind zunächst Maßnahmen zu treffen, die die Ursachen der Störung – seien sie beabsichtigt oder unbeabsichtigt – beseitigen. Die Palette verfügbarer Instrumente reicht von spezifischen technischen Fähigkeiten zur Behebung der Ursache bis hin zu militärischen Interventionen. Fehlen überzeugende Optionen oder erweisen sie sich als unzureichend oder unwirksam, müssen die betroffenen Volkswirtschaften die von der Störung verursachten Kosten tragen.
Zwei Schlüsselbegriffe sind wirtschaftliche Flexibilität und gesellschaftliche Resilienz.
Zwei Schlüsselbegriffe sind in diesem Zusammenhang wirtschaftliche Flexibilität26 und gesellschaftliche Resilienz.27 Flexibilität bedeutet hierbei die Fähigkeit, wirtschaftliche Prozesse in Reaktion auf die Auswirkungen der Störung möglichst rasch und kostengünstig umzustellen. Funktionierende Wettbewerbsmärkte zeichnen sich generell durch ein hohes Maß an Flexibilität aus, sie weisen jedoch auch spezifische Schwachstellen auf, die sich etwa in Externalisierungseffekten zeigen. Flexibilität kann systematisch aufgebaut werden – etwa indem für die Möglichkeit Sorge getragen wird, Produktionsprozesse rasch anzupassen. Internationale Vereinbarungen können helfen, die Auswirkungen von Störungen auf viele Schultern zu verteilen und somit die Anpassung zu erleichtern. Jede Mobilisierung von Flexibilitätsreserven in Krisensituationen wird mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Diese Kosten müssen von den Betroffenen und von der Gesellschaft insgesamt getragen werden; die Verteilung dieser Lasten erfordert politische Entscheidungen.
Resilienz beschreibt die Fähigkeit von Staaten, Gesellschaften und Volkswirtschaften, diese Kosten zu tragen und die damit verbundenen Konflikte konstruktiv aufzulösen. Ob und in welchem Maße sie besteht, ist vorab schwer einzuschätzen, doch lassen sich gesellschaftliche Rahmenbedingungen (wie etwa hohe Legitimität der politischen Ordnung und ausgeprägter Zusammenhalt der Gesellschaft) identifizieren, die Resilienz befördern können.
Für den Umgang mit strukturellen Verschiebungen in den wirtschaftlichen Machtverhältnissen steht dem Staat eine breite Palette industrie- und innovationspolitischer Maßnahmen zur Verfügung.28 Auch hier geht es um das kluge und für Korrekturen offene Austarieren macht- und sicherheitspolitischer Zielsetzungen mit Erwägungen, die die Effektivität und Effizienz der ins Auge gefassten Entscheidungen zu berücksichtigen versuchen.
Die internationalen Wirtschaftsbeziehungen dürften in den kommenden Jahren unter den Vorzeichen verschärfter macht- und sicherheitspolitischer Konflikte zwischen den großen Mächten stärkere Einschränkungen und häufigere krisenhafte Störungen erfahren. Die Vorteile offener Volkswirtschaften werden allerdings wohl erhalten bleiben. Globale Regelwerke – wie etwa das der Welthandelsorganisation (WTO) – dürften an Bedeutung verlieren, plurilaterale Vereinbarungen zwischen gleichgesinnten Staaten dagegen an Gewicht gewinnen. Die Offenheit nationaler Volkswirtschaften wird auf diese Weise selektiver und konditionierter; dies wiederum wird Weltregieren durch universale Regelwerke (global governance) erschweren und damit globale Problemlösungsfähigkeiten gefährlich vermindern.
Im geoökonomischen Diskurs von Politik und Wissenschaft spielt der räumliche Aspekt oft nur eine untergeordnete Rolle. Der Fokus liegt meist auf der Zentralität1 bestimmter Akteure in ihren Beziehungen und Netzwerken, der Vielfalt der wirtschaftlichen, finanz- und industriepolitischen Kontrollinstrumente oder auf der Fähigkeit von Regierungen, die wirtschaftliche Stärke ihres Landes zu nutzen, um politische, wirtschaftliche oder technologische Ziele zu erreichen – oder deren Erreichen gar zu erzwingen. Dabei bleibt allerdings die Bedeutung von Raum, das Verständnis von »Geo« im Begriff Geoökonomie, eher unklar oder »Raum« wird ähnlich statisch verstanden wie in der klassischen Geopolitik. »Geo« bezieht sich dann vor allem auf die Einwirkung geographischer Faktoren auf wirtschaftliche Vorgänge und Kräfte (beispielsweise im Rahmen von Diskussionen über Standortvorteile).2
Obwohl geoökonomisches Handeln also in einem räumlichen – inter- oder transnationalen – Kontext stattfindet, wird selten umfassend über die Merkmale der Räume diskutiert, die durch entsprechende Praktiken konstituiert werden. Darüber hinaus werden im Denken über Geoökonomie denn auch kaum Vorarbeiten aus der Raumwirtschaftslehre berücksichtigt, geschweige aus anderen Disziplinen wie der Geographie, Anthropologie oder Soziologie.3 Insofern stellt die Vorsilbe »Geo« oft nur einen Bezug zum Machtbegriff her, der im Falle der Geoökonomie vor allem den Einsatz nichtmilitärischer Mittel als Alternative zur direkten Kriegsführung beinhaltet.4 Dies verkürzt den Blick auf die räumlichen Auswirkungen geoökonomischer Handlungen stark, die sowohl Räume schaffen als auch strukturieren.
Hilfreich für ein Neudenken des Raumbegriffs im geoökonomischen Denken und Handeln sind vor allem Untersuchungen aus der politischen Geographie. Das Verständnis von Raum ist hier nicht beschränkt auf territorial voneinander abgegrenzte Nationalstaaten, die international mit- oder gegeneinander agieren.5 Vielmehr konstituieren und kontrollieren laut politischer Geographie Regierungen oder grenzüberschreitende Unternehmen durch Praktiken ganz unterschiedliche physische wie nichtphysische Räume, zum Beispiel Wirtschaftskorridore, Sanktionsregime, Infrastrukturen, Produktionsnetzwerke oder Lieferketten. Entscheidend ist dabei ein Verständnis von Raum, das nicht nur durch geographische Ausdehnung bestimmt ist. Räume sind demnach auch Ökosysteme, Netzwerke und Infrastrukturen, auf die sich zunehmend die Logik der klassischen Territorialität ausdehnt. Raum in diesem Sinne ist stärker mit Macht zusammenzudenken. Zu wissen, wo Akteure Kontrolle, Zentralität oder sogar Souveränität ausüben, ist entscheidend, um zu verstehen, wie und warum sie dies tun.6 Das schmälert nicht die Bedeutung des Nationalstaates. Im Gegenteil: Im Kern geht es bei geoökonomischem Handeln zumeist um die Absicherung staatlicher Souveränität. Diese wird noch gestärkt, indem Räume jenseits der eigenen Grenzen (dem klassischen Territorium) kontrolliert werden; Kontrolle schließt hierbei ein, dass Staaten andere Akteure von sich abhängig machen oder von Akteuren unabhängig werden.
Angesichts der geoökonomischen Zeitenwende wird für Politik und Wissenschaft langfristig wichtig sein, nicht nur darauf zu blicken, wie Staaten »wirtschaftliche […] und technologische […] Mittel zur Verfolgung wirtschaftlicher, außen- und sicherheitspolitischer Interessen«7 einsetzen, sondern vor allem auch, wo sie dies tun. Zugleich rückt in der Debatte über den Begriff »Geoökonomie« der Staat als zentraler Akteur wieder mehr ins Zentrum. Dies allein ist bereits eine Entwicklung, die direkt aus geoökonomischem Handeln resultiert und dabei die Fokussierung auf die Absicherung staatlicher Souveränität und territorialer Integrität verstärkt. Das Verhältnis von Macht und Raum gerät ins Blickfeld, insbesondere Fragen danach, wie geoökonomisches Denken und Handeln Räume strukturiert und mitunter neu ordnet. Und dies gerade in einer Ära, in der die Fragmentierung sowohl der Nachkriegsordnung (nach 1945) als auch jener Ordnung fortschreitet, die sich nach dem Ende des Kalten Kriegs etabliert hat, was für deutlich mehr Unsicherheit in der Welt sorgt.
Volumen und Infrastruktur: Auswirkungen auf geoökonomisches Denken
Im Zuge der fortschreitenden Fragmentierung von Machtverhältnissen in der geoökonomischen Zeitenwende ist die Frage von besonderem Interesse, welche Räume wie strukturiert werden. Volumen und Infrastruktur bieten zwei Perspektiven an, die auf besondere Weise den Zusammenhang von Macht und Raum erkennen lassen.
Volumetrische Wende: Vertikale Ausdehnung von politischen Räumen durch technologische Fortschritte
Mit dem Begriff volumetrische Wende betonen Geographen die Fokussierung auf vertikale Räume, von Untergrund bis Weltraum. Diese setzt ein vielschichtiges Verständnis von Territorium voraus, das deutlich komplexer ist als die Gleichsetzung von Territorium mit den geographisch bedingten Grenzen eines souveränen Nationalstaates oder als der Fokus auf der horizontalen (»flachen«) Ausdehnung und Kontrolle von Territorium.8 Der Geograph Stuart Elden legt außerdem dar, dass Territorium ein Prozess und kein Resultat sei. Im Grunde ähnlich wie das, was mittlerweile zunehmend als Assemblage verstanden wird, das heißt: die Bedeutung von Territorium wird durch heterogene Ansammlungen ganz unterschiedlicher Elemente (Menschen, Technologien, Mechanismen, Ideen) ständig neu konstituiert.9
Kontrolle über volumetrische Räume von Untergrund bis Weltraum charakterisiert die geoökonomische Zeitenwende.
Nach diesem volumetrischen Verständnis prägt sich Territorium nicht nur horizontal in der Fläche als Ort oder (Staats-)Gebiet aus oder ist durch fixe Grenzlinien auf Karten definiert, sondern umfasst zunehmend neue Räume, die durch techn(olog)ische Weiterentwicklungen erschlossen oder durch Klimaveränderungen zutage treten.10 Der Begriff Volumen charakterisiert an diese Vorstellungen anschließend Räume wie beispielsweise die Atmosphäre, die Tiefsee, die Polarregionen, den (geologischen) Untergrund oder den Weltraum.
Für die geoökonomische Zeitenwende bedeutet dies auch, dass Fragen im Zusammenhang mit Kontrolle, Abhängigkeit oder Autonomie auf immer mehr komplexe volumetrische Geographien ausgreifen. Die Analysen in einem Sammelband von Franck Billé über »voluminöse Staaten« untermauern, dass für Staaten vermehrt Räume an Bedeutung gewinnen, die zuvor außerhalb der Reichweite menschlicher Intervention lagen.11 Es geht um die Ausweitung der traditionellen Logik der Territorialität auf Räume jenseits dessen, was Regierungen als Territorium markieren, das ihrer souveränen Herrschaft untersteht. Dies hat zweierlei Folgen: Zum einen dehnt sich geoökonomisches Handeln in den Raum als Volumen aus. Dabei werden die Zusammenhänge zwischen den räumlichen Dimensionen und ihrer Nutzung an Bedeutung gewinnen. Ein Beispiel dafür ist die Kommunikation zwischen Globalen Navigationssatelliten- (z. B. GPS, Beidou, Galileo) und modernen Transportsystemen, dank der sich Positionierung, Sicherheit und Effizienz verbessern lassen. Für das Denken und Handeln in der geoökonomischen Zeitenwende ist relevant, wie durch diese Zusammenhänge der Dimensionen (und Infrastrukturen) Pfadabhängigkeiten entstehen, beispielsweise durch die Kompatibilität von Globalen Navigationssystemen und den damit verbundenen Transportsystemen. Entscheidet sich ein Akteur etwa für das chinesische Beidou-System – oder stellt ihm die chinesische Regierung dieses System auf Basis eines Abkommens zur Verfügung –, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass der Akteur in einem zweiten Schritt chinesische Hochgeschwindigkeitszüge importiert. Zum anderen organisiert und strukturiert geoökonomisches Handeln volumetrische Räume. Ferner übertragen Akteure die klassische Logik der Territorialität – Anspruch auf Kontrolle über einen spezifischen, begrenzten Raum – auf volumetrische Räume, und zwar insbesondere durch nichtmilitärische Mittel.
Die volumetrische Wende wirkt aus alltäglicher Sicht beinahe selbstverständlich. Das moderne Leben ist ohne die Verknüpfung verschiedener räumlicher Dimensionen kaum denkbar; das gilt beispielsweise für das mobile Bezahlen per Smartphone oder die Abwicklung von Containern im Hamburger Hafen. Das Verständnis von Raum als Volumen unterstreicht erneut die Ko-Konstitution von Macht und Raum. Darüber hinaus bereitet diese Sichtweise auf eine zukünftige Realität vor, in welcher der Weltraum für Geoökonomie (und Geopolitik) größere Bedeutung hat.12 Das Konzept der »terrestrischen Falle«, das Enrike van Wingerden und Darshan Vigneswaran zur Theoriebildung in den internationalen Beziehungen beigesteuert haben, lässt sich auch auf andere sozialwissenschaftliche Disziplinen übertragen.13
Es gibt in der bisherigen Debatte nur wenige konzeptionelle Ansätze, die über die Erdoberfläche hinausgreifen (»flat-Earthism«) oder Bedingungen einkalkulieren, unter denen menschliches Leben erschwert ist (»human habitationism«).14 Politische Akteure müssen daher als ersten, notwendigen Schritt verstehen, dass sich ihre Macht auch vertikal in den Raum hinein ausdehnt. Die Diskussionen über »Mond-Wirtschaft« (»lunar economy«) zeigen bereits an, wohin die Entwicklungen gehen. Der Moment, in dem wirtschaftliche Aktivitäten mit Verbindungen zum Mond – die Produktion und Nutzung von Ressourcen auf dem Mond – Teil unseres Alltags werden, erscheint noch weit entfernt. Doch sind entsprechende Ambitionen bereits greifbar, was sowohl das Artemis-Programm der NASA belegt als auch der chinesische Plan, eine internationale Forschungsstation auf dem Mond (International Lunar Research Station, ILRS) zu errichten.
Infrastrukturen: Verbindung zwischen Raum und Macht
In der aktuellen Debatte über geoökonomisches Denken und Handeln dominiert das Verständnis von Infrastrukturen als ein strategisches Mittel, um politische, wirtschaftliche und technologische Ziele zu erreichen. Der Aufbau von physischen wie nichtphysischen Infrastrukturen außerhalb des eigenen Territoriums kann folglich von Staaten entsprechend instrumentalisiert werden. Wie Farrell und Newman zeigen, werden existierende infrastrukturelle Netzwerke und in Verbindung mit ihnen bestehende Abhängigkeiten von Regierungen vermehrt als Waffe eingesetzt (»weaponized interdependence«).15 Mit Blick auf eine geoökonomische Zeitenwende ist dies insofern ein zentraler Aspekt, als damit die liberale Grundannahme, dass der Aufbau gegenseitiger wirtschaftlicher Abhängigkeiten dem Frieden förderlich sei, ins Gegenteil gekehrt wird. Die Fragmentierung der Machtverhältnisse im gegenwärtigen Weltordnungsinterregnum fördert das Verständnis von Infrastrukturen als strategisches Instrument nichtmilitärischer Kriegsführung. Von den Vereinigten Staaten sprechen Farrell und Newman sogar als von einem Untergrund-Imperium, in dem die Kontrolle von Infrastrukturen eine Form von Macht begründet, die weitaus subtiler wirkt als rein militärische Gewalt. Allerdings steht auch bei diesem Ansatz die Frage nach der Macht im Vordergrund; in diesem Fall insbesondere die Frage, wie die US-Regierung bestimmte Infrastrukturen und Netzwerke zu strategischen Machtinstrumenten umfunktioniert. Der räumliche Aspekt von Infrastrukturen rückt in der Folge wieder in den Hintergrund.
Infrastrukturen gestalten Raum und ermöglichen Konnektivität im Raum.
Für geoökonomisches Handeln etwa im Rahmen einer strategischen Infrastrukturaußenpolitik ist allerdings ebenfalls von Bedeutung, wo Infrastrukturen geschaffen (z. B. in Land, Ort, Stadt oder Kommune) und welche Räume durch Infrastrukturen konstituiert werden (z. B. Transportpunkte, Kommunikationsnetzwerke, Wirtschaftszonen). Der Raum determiniert erst, mit welchen Mitteln ein Staat beispielsweise Kontrolle gewinnen oder gezielte Abhängigkeiten schaffen kann. Infrastrukturen verbinden insofern Macht und Raum auf besondere Weise. In zweifacher Hinsicht wirken sich Infrastrukturen auf Raum aus: Sie gestalten Raum direkt, gleichzeitig schaffen sie Konnektivität im Raum, konkret den Fluss von Menschen, Waren und Daten.16 Diese Dualität der Wirkungen von Infrastruktur unterstreicht die Möglichkeiten, die sich durch die Einbeziehung der Raumperspektive für die Geoökonomie ergeben. Denn eine Analyse der räumlichen Effekte von Infrastrukturen kann dabei helfen, die Optionen gezielter Einflussnahme durch Staaten genauer zu bestimmen. Im Interesse einer zweckmäßigen Auswahl von Maßnahmen geoökonomischen Handelns sollten Entscheidungsträgerinnen und ‑träger daher ein tieferes Verständnis von Infrastrukturen als Verbindung zwischen Macht und Raum entwickeln.
Ausblick: Mehr Peripherien, mehr Abhängigkeiten und die Herausbildung einer neuen inter-imperialen Weltordnung?
In der Ordnung, die sich nach dem Ende des Kalten Kriegs etabliert hat, herrschte die Vorstellung, dass gegenseitige Abhängigkeiten eine stabilisierende Wirkung auf das internationale System haben. Im derzeitigen Interregnum löst sich diese Vorstellung auf, das Verlangen von Staaten nach größerer Autonomie (und damit weniger Abhängigkeiten) nimmt stetig zu.
Geoökonomisches Handeln stärkt ein neuartiges Verständnis von Zentrum und Peripherie.
Geoökonomisches Handeln von Staaten verändert nun das klassische Verständnis des Wesens und Verhältnisses von »Zentrum« und »Peripherie« in den internationalen Beziehungen. Und das wiederum hat Auswirkungen darauf, wie der Raum der internationalen Politik künftig organisiert sein wird. Die Grenzen der neuen Peripherien stimmen selten mit den Grenzen von Nationalstaaten überein; Peripherien sind auch nicht zwingend Räume, die geographisch nah am Zentrum des kontrollierenden Akteurs (z. B. den USA oder China) liegen, oder schlichtweg abgelegene (aber fixierte) Räume wie Steppen oder Wüsten. Die neueren Peripherien sind vielmehr kleinere Einflussräume ganz unterschiedlicher Form und Ausdehnung, die beispielsweise durch die Kontrolle eines Akteurs über digitale, wirtschaftliche oder finanzielle Infrastrukturen, Lieferketten oder transnationale Wertschöpfungsketten entstehen.17 Gleichzeitig ist für die Praktiken der Großmächte eine Zunahme der vertikalen oder volumetrischen Expansion gegenüber der traditionellen horizontalen Ausdehnung von Einflussräumen charakteristisch. All dies unterstreicht, dass sich neuartige Imperien herausbilden.
Ein besonders gutes Beispiel sind die Aktivitäten der Volksrepublik China in der Ära Xi Jinping. Denn chinesische Praktiken weisen zusehends Merkmale auf, die imperialen Charakter haben, und zwar nicht weil die Volksbefreiungsarmee (VBA) andere Staaten militärisch besetzt,18 sondern weil China verstärkt Kontrolle über Infrastrukturen ausübt, Intermediäre – Kontakte zu Politik- und Wirtschaftseliten – in Drittstaaten strategisch aufbaut, die den Einfluss beispielsweise chinesischer Unternehmen unterstützen, oder weil die Volksrepublik ihre Diskurshoheit in wichtigen regionalen wie internationalen Organisationen durchsetzt.19
Ein weiteres Indiz ist die gezielte Besetzung von Räumen durch Infrastrukturprojekte, etwa durch die Schaffung und Bebauung künstlicher Inseln im Südchinesischen Meer.20 Es geht aber auch um chinesische Praktiken, die sich beispielsweise auf die Kontrolle spezifischer technischer Ökosysteme konzentrieren; so errichten, besitzen oder betreiben chinesische Akteure langfristig in mehreren Staaten Satellitenbodenstationen, Rechenzentren, Untersee-Glasfaserkabel oder Hard-/Software-Netzwerkinfrastruktur. Dies zeigt sich unter anderem in Chinas Beziehungen zu afrikanischen Ländern, beispielsweise zu Äthiopien am Horn von Afrika.21 Weiterhin liegt der Nutzen von Organisationen wie dem Forum für China-Afrika-Kooperation (FOCAC) aus chinesischer Sicht nicht darin, dass deren Mitgliedstaaten ihre Souveränität an China abgeben (und Chinas ausschließliche Autorität anerkennen), sondern er ist subtiler, oft symbolischer und letztlich funktionaler Natur. Die chinesische Regierung forciert in diesen Foren oftmals die Unterzeichnung von Absichtserklärungen als Rahmenbedingung für zukünftige Geschäfte oder veranlasst bereits den Abschluss von Abkommen über eine weitere wirtschaftliche Kooperation.
All dies weist auf die Auswirkungen hin, die geoökonomische Praktiken auch auf die Gestaltung globaler Räume haben können. Die dynamische Neuordnung von Zentrum-Peripherie-Beziehungen eröffnet dabei die Möglichkeit, dass künftig eine inter-imperiale Weltordnung entstehen könnte, die geprägt ist durch die Parallelität verschiedener Imperien. Zusätzlich forciert wird diese Entwicklung durch die zunehmende Ignoranz und Missachtung geltender internationaler Normen. Am eindringlichsten stellt dieses Verhalten der russische Staatschef Wladimir Putin unter Beweis, der spätestens seit der Vollinvasion der Ukraine im Jahr 2022 mit allen Mitteln versucht, ein neues Großrussland zu errichten. Aber auch die USA unter der zweiten Präsidentschaft Donald Trumps stellen ihre Eigeninteressen an erste Stelle, und dies ohne große Rücksicht auf geltendes nationales und internationales Recht oder maßgebliche internationale Institutionen, ob in Gestalt des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder der Welthandelsorganisation (WTO). Dass US-Präsident Trump Gebiets- oder Kontrollansprüche etwa auf den Gazastreifen, Grönland, Kanada oder Panama erhebt, unterstreicht in aller Deutlichkeit das Ende von Amerikas Rolle als Macht, die liberale internationale Regeln und Normen achtet und schützt. In gewisser Weise wandeln sich die USA von einem subtilen »Untergrund-Imperium«, wie es Farrell und Newman noch beschrieben haben, zu einem »sichtbaren Imperium«.
Die in China, Russland und den USA zu beobachtenden Entwicklungen haben konkrete Auswirkungen auf Europa und Deutschland, die nun Gefahr laufen, peripherisiert zu werden. Daher ist nicht ausgeschlossen, dass die räumlichen und machtpolitischen Auswirkungen der geoökonomischen Zeitenwende den ersten Schritt auf dem Weg zu einer inter-imperialen Weltordnung markieren.
In der wissenschaftlichen Debatte über das Verhältnis von Technologie und internationaler Politik lassen sich zwei Stränge ausmachen: Zum einen wird Technologie im Paradigma des »Realismus« instrumentell verstanden. Technologie als von Menschen hergestelltes Artefakt ist demnach eine Machtressource, die im Zusammenspiel mit anderen Ressourcen über das relative Kräfteverhältnis zwischen Staaten entscheidet. Zum anderen wird aus sozial-konstruktivistischer Perspektive betont, wie Herstellung und Nutzung von Technologie unauflöslich mit sozialen Praktiken verwoben sind. Technologie ist demzufolge nicht nur materielles Produkt intentionalen Handelns von Regierungen, sondern setzt zugleich immer wieder auch maßgebliche Rahmenbedingungen für zwischenstaatliches Handeln.1
Die Sicht von Regierungen auf Technologie ist seit jeher zumeist vom instrumentellen Blick geprägt.2 Unmittelbar zeigt sich dies im militärischen Bereich, wo Regierungen den Zugriff auf bestimmte Technologien als wesentlichen Vorteil gegenüber anderen Staaten sehen.3 Ferner ist der Zugang zu Technologie für Staaten in dem Maße bedeutsam, in dem er die Grundlage für wirtschaftliche Aktivitäten bildet.
Technologie lässt sich als Instrument nutzen, um grenzüberschreitende Einflusssphären zu schaffen.
Das seit einigen Jahren zu beobachtende Wiedererstarken geoökonomischer Deutungsmuster, also der Hervorhebung machtpolitischer Erwägungen in wirtschaftlichen Austauschbeziehungen, ist ebenfalls von diesem instrumentellen Technologieverständnis gekennzeichnet.4 Insbesondere geht dieses mit Vorstellungen zur Rolle des Staates einher, die unter dem Globalisierungsparadigma seit Ende des Kalten Krieges eher in den Hintergrund getreten waren, ohne indes je gänzlich zu verschwinden: Zentral, wenn auch häufig unausgesprochen ist dabei die Annahme, dass Staaten die technologische Entwicklung gezielt lenken können und dies auch tun sollen, um ihre nationalen Interessen zu verfolgen. Damit verbunden ist die Annahme, dass der Technologiewettbewerb zwischen Staaten auf ein Nullsummenspiel hinauslaufe. Als spezifisch räumliche Komponente kommt die Vorstellung hinzu, Technologie als Instrument zu nutzen, um grenzüberschreitende Einflusssphären zu schaffen.5 Hier offenbart sich das instrumentelle Verständnis von Technologie gewissermaßen in seiner Reinform. Und es droht zur self-fulfilling prophecy zu werden, denn je mehr Staaten dieses Verständnis zur Grundlage ihres Handelns machen, umso wirkmächtiger wird es.
Technologische Innovation
Technologie ist eine flüchtige Machtressource. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse in der Grundlagenforschung, Fortschritte in Herstellungsverfahren oder neue Anwendungsmöglichkeiten können die Bedeutung einzelner Technologien erheblich verändern. So bildete etwa die herausragende Position deutscher Unternehmen in der Entwicklung des Verbrennungsmotors seit dem 19. Jahrhundert eine wichtige Grundlage für Deutschlands wirtschaftliche Stärke. Setzen sich in Zukunft rein elektrische Antriebe durch, verliert Deutschland einen technologischen Vorteil, den es lange Zeit hatte.
Unternehmen stehen darum unter Druck, durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung am Puls der technologischen Entwicklung zu bleiben und im besten Fall durch eigene Innovationen einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern zu erlangen. Für Staaten ergibt sich daraus die vordringliche Herausforderung, die Bedingungen für technologische Innovation zu schaffen. Dazu steht ihnen eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung, die sich grob in drei Kategorien erfassen lassen:
-
Staatliche Akteure können ein gesetzliches und regulatorisches Umfeld schaffen, das Innovation fördert. Hierunter fällt etwa die Einrichtung eines Systems zum Patentschutz als Anreiz für Investitionen in Forschung und Entwicklung.
-
Zudem können Regierungen und Parlamente wichtige Grundlagen für Innovation schaffen, etwa durch Investitionen in schulische Bildung und Wissenschaft oder durch Unterstützung in Form zwischenstaatlicher Abkommen, wenn es um den Zugang zu Rohstoffen geht.
-
Schließlich können Staaten technologische Forschung und Entwicklung auch direkt finanziell fördern. Möglichkeiten dazu wären beispielsweise Zuwendungen an öffentliche Forschungsinstitute, an militärische Forschungseinrichtungen und an Universitäten, aber auch steuerliche Begünstigungen und Zuschüsse für Forschung in Unternehmen. Auch können staatliche Stellen durch das Wirken als »Leitkunden« gezielt wirtschaftliche Anreize setzen.
Je nach ihren wirtschaftlichen und administrativen Kapazitäten bemühen sich alle Staaten, durch einen Mix von Maßnahmen aus diesen drei Kategorien die Technologieentwicklung im eigenen Land voranzubringen. Doch seit geoökonomische Deutungsmuster wieder an Boden gewinnen, verschärfen sich Spannungen, die der Idee staatlich gelenkter Innovationsförderung inhärent sind. Denn echte Innovation ist in einer Weise voraussetzungsvoll und unberechenbar, die nur schwerlich mit der Verwaltungslogik von Nationalstaaten vereinbar ist.
Zu den Voraussetzungen zählt ein gesellschaftliches Umfeld von Offenheit in politischer, kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht, das in einem umfassenden Sinne Kreativität zulässt und fördert. Damit verbunden ist Innovation darauf angewiesen, dass der hohe Stellenwert von Bildung und Forschung in der gesellschaftlichen Breite verstanden und verteidigt wird. Zur notwendigen Offenheit gehört überdies, den wissenschaftlichen und kreativen Austausch nicht ins Korsett nationaler Territorialität zu zwängen. Die Unberechenbarkeit von Innovation erweist sich besonders darin, dass die Zeiträume nicht planbar sind. So können Jahrzehnte vergehen, bis in einem bestimmten Feld ein Durchbruch gelingt, aber es können auch mehrere Innovationen rasch aufeinander folgen. Unvermeidbare Konsequenz dieser Unberechenbarkeit ist außerdem, dass viele vermeintliche Innovationen scheitern.
Für Staaten ist all dies eine Zumutung. Vor allem in demokratischen, teils auch in autoritären Staaten stehen Regierungen unter Druck, ihre Bevölkerung davon zu überzeugen, dass sich der Einsatz öffentlicher Ressourcen auszahlt. Wenn daher Forschungsförderung unter der Prämisse betrieben wird, möglichst bald vorzeigbare Ergebnisse zu produzieren, erschwert dies jede echte Innovation.
Dennoch verfolgen mittlerweile die meisten Regierungen das Ziel, bei einzelnen Technologien eine führende Rolle einzunehmen oder zumindest ein wichtiger Standort für die Arbeit an diesen Technologien zu sein. Ausweis dafür sind die vielen Regierungsstrategien, die sich schon im Titel einzelnen Technologien widmen.6
Falsch ist dabei nicht die Ambition, etablierte Technologievorreiter herauszufordern. Problematisch ist vielmehr, wenn Regierungen lediglich auf bestehende Trends reagieren oder wenn sie ausblenden, welche und wie große Ressourcen für ihre Ziele auf Dauer notwendig sind. Zur Falle kann eine solche Ankündigungspolitik dann werden, wenn sie überzogene Erwartungen weckt – und so jenes Vertrauen verspielt wird, das nötig ist, um den öffentlichen Rückhalt für langfristige Innovationsförderung sicherzustellen.
Für Regierungen geht es also darum, zu erklären, warum sich eine breit und langfristig angelegte Investition in die Voraussetzungen und Grundlagen technologischer Innovation lohnt; anders ausgedrückt: warum der Verzicht auf kurzfristige Ergebnisse langfristig ertragreicher ist.
Das wohl bekannteste Beispiel für diese Art von Innovationsförderung ist die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) der USA. Gegründet im Jahr 1958 als Reaktion auf den sogenannten Sputnik-Schock, verfolgt sie das erklärte Ziel, mit ambitionierter Forschungsförderung technologische Überraschungen zu vermeiden, die durch Entwicklungen in anderen Ländern verursacht werden können. 2024 betrug das Budget der DARPA 4,1 Milliarden US-Dollar (rund 3,4 Milliarden Euro, Stand: September 2025).7 Die 2018 in Deutschland gegründete Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND) gilt als Versuch, in ähnlicher Weise langfristig und jenseits enger Vorgaben des Haushaltsrechts echte Innovationen zu fördern. Im Jahr 2024 standen der SPRIND dafür 220 Millionen Euro zur Verfügung.8
Staatliche Kontrolle über Technologie
Es gehört zum Selbstverständnis moderner Staaten, das Geschehen auf ihrem Territorium kontrollieren zu können. In demokratischen Staaten kommt in diesem Anspruch die Vorstellung zum Ausdruck, dass Gesellschaften mit Hilfe demokratischer Verfahren ihre Zukunft aktiv und selbstbestimmt gestalten.9
Mit der Rückkehr geoökonomischer Denkmuster in »realistischer« Tradition verstärken sich die Spannungen, die der Idee national verfasster, territorial gebundener Souveränität innewohnen. In der jüngsten Phase der Globalisierung ab den 1990er Jahren war noch die Zurückhaltung des Staates zugunsten des globalen Wirtschaftsgeschehens erklärtes Programm vieler Regierungen. Doch angesichts der zunehmenden machtpolitischen Aufladung internationaler Wirtschaftsbeziehungen wachsen die Erwartungen an den Staat wieder.10 Technologie gehört allerdings zu jenen Phänomenen, die sich nur schwerlich von Staaten kontrollieren lassen.
Noch vergleichsweise einfach zu handhaben sind rechtliche Vorgaben zur Nutzung physischer Artefakte auf dem Territorium eines Staates. Sie können mit staatlichen Zwangsmitteln auf dem eigenen Staatsgebiet durchgesetzt werden. Schon lange üblich sind etwa detaillierte Vorgaben für Fahrzeuge, von Privatautos bis zu Flugzeugen.
Gemeinhin wird die Kontrolle von Technologie mit dem Verweis auf Risiken gerechtfertigt, die für einzelne Personen oder die Gesellschaft als Ganze entstehen können. Unter dem Vorzeichen geoökonomischer Deutungsmuster kommen zwei Motive hinzu: zum einen die Hoffnung, im Sinne des beschriebenen Nullsummenspiels einen technologischen Vorteil gegenüber anderen Staaten zu behalten, zum anderen die Sorge, in technologische Abhängigkeit von anderen Staaten zu geraten, also gewissermaßen die Furcht vor Kontrollverlust.
Beide Motive stehen jedoch in Spannung dazu, wie sich Entwicklung, Verbreitung und Nutzung von Technologie verändert haben. Erstens sind viele technologische Endprodukte heute Kombinationen verschiedener Hard- und Software, die über komplexe internationale Lieferketten zusammengeführt werden. Zweitens können zahlreiche Technologien sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke eingesetzt werden (dual use). Drittens gewinnen Software und Vernetzung an Bedeutung.
Gerade dieser letzte Punkt stellt eine neue Herausforderung für Staaten dar. Immer mehr Geräte wie Autos oder Produktionsmaschinen lassen sich heute in ihrer Funktionalität auch nach Fertigstellung durch Software-Updates verändern. Hinzu kommt, dass Software deutlich schwerer entlang territorialer Grenzen zu kontrollieren ist als physische Objekte. Ist ein Staat nicht willens, sich so radikal von der Außenwelt abzuschotten wie etwa Nordkorea, ist das Risiko groß, dass andere Staaten sich Zugang zu fortschrittlichen Softwareentwicklungen verschaffen. Wenn also der technologische Vorsprung eines Staates gegenüber anderen auf eben diesen Entwicklungen basiert, kann er sich rasch verflüchtigen.
Praktisch zu beobachten ist dieses Problem im Bemühen nun schon verschiedener US-Administrationen, mit Exportkontrollen zu verhindern, dass fortschrittliche Technologie nach China gelangt. Dazu zählt vor allem Technologie für die Nutzung und Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI).11 Nicht überraschend setzt die US-Regierung dabei vor allem auf Hardware wie zum Beispiel besonders leistungsfähige Computerchips. Der Effekt dieser Maßnahmen wird sich abschließend erst in der Rückschau einschätzen lassen. Plausibel scheint, dass sie die Entwicklung in China etwas verlangsamt haben. Allerdings sorgte die chinesische Firma DeepSeek im Frühjahr 2025 für Aufsehen, als sie ihr KI-Modell vorstellte: Gerade jene Einschränkungen bei der Hardware, die durch die Exportbeschränkungen verursacht waren, hatten anscheinend den Anreiz für Innovationen bei der Software, also dem eigentlichen KI-Modell, geliefert.
Auch hier zeigt sich mithin, dass die Übernahme geoökonomischer Deutungsmuster die Gefahr birgt, gemäß der Logik eines zwischenstaatlichen Nullsummenspiels die Rolle von Staaten zu überschätzen. Weil sich Technologie in vielen Fällen nicht oder nur zu unverhältnismäßigen Kosten – siehe Nordkorea – territorial kontrollieren lässt, läuft die Logik eines Nullsummenspiels in dieser Hinsicht ins Leere.
Technologieunternehmen als Instrument der Geoökonomie?
Die Konzentration wirtschaftlicher Macht in den Händen weniger Unternehmen ist nicht neu, denn schließlich gab es vor Big Tech schon Big Tobacco und Big Oil. Bekannt ist auch, dass solch konzentrierte Wirtschaftsmacht Gesellschaften prägt und in verschiedener Weise politisch wirksam wird.
Ein wichtiger Unterschied liegt aber darin, dass die wirtschaftliche Macht von Big Tech auf einer sehr viel dynamischeren Basis beruht. Das Produkt Erdöl und das damit verbundene Geschäftsmodell haben sich über die letzten Jahrzehnte im Kern nur wenig verändert. Im Bereich moderner Technologien hingegen können selbst Weltmarktführer jederzeit durch neue technologische Entwicklungen verdrängt werden. Die heute großen Unternehmen reagieren darauf, indem sie kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investieren – aber auch, indem sie regelmäßig potentielle Konkurrenten aufkaufen.
Über die letzten Jahre hat sich so die Dominanz einer überschaubaren Anzahl US-amerikanischer Unternehmen verfestigt. Gemessen an der Marktkapitalisierung zählen hierzu aktuell Apple, Amazon, Meta, Microsoft – und als Neuzugänge im Rahmen der jüngsten Entwicklungen im Bereich KI die Firmen OpenAI und Nvidia. Die größte Konkurrenz erfahren sie durch chinesische Unternehmen wie Baidu, Alibaba, Tencent oder Huawei. In einzelnen Bereichen agieren auch global einflussreiche Großunternehmen aus anderen Ländern. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) etwa ist derzeit führend in der Produktion von Halbleiterchips.12
Die USA und China sind entschlossen, mit technologischer Dominanz die Politik anderer Länder zu beeinflussen.
Wie im vorigen Abschnitt beschrieben versuchen viele Regierungen im Sinne der Logik eines Nullsummenspiels, die technische Vorrangstellung »ihrer« Unternehmen zu sichern. Ziel ist, dank internationaler Marktdominanz möglichst viel zu exportieren und die damit verbundenen Skaleneffekte zu nutzen, ohne den militärisch oder wirtschaftlich entscheidenden Vorsprung aus der Hand zu geben. Verbunden ist dies für Staaten wie die USA und China mit dem Bestreben, mittels technologischer Dominanz auch Einfluss auf die Politik anderer Länder zu nehmen.13
Als transnationale, zum großen Teil öffentlich gehandelte Unternehmen wehren sich diese Firmen immer wieder gegen den Vorwurf, gewissermaßen als Agenten ihrer Herkunftsstaaten zu wirken. Nicht zuletzt sind sie darum bemüht, Befürchtungen ihrer Kunden in anderen Staaten zu zerstreuen.14
Hier lässt sich erkennen, dass die Instrumentalisierung von Tech-Unternehmen zur Verfolgung außen- und sicherheitspolitischer Ziele anspruchsvoll und von Spannungen durchzogen ist: Erstens beruht der globale Einfluss großer Technologieunternehmen wesentlich darauf, dass sie gerade nicht als politische Akteure gesehen werden. Je intensiver Regierungen versuchen, die Kontrolle über diese Unternehmen zu verstärken und sie für ihre politischen Zwecke zu nutzen, umso mehr gerät deren globale Marktstellung unter Druck. Zweitens basiert die globale Macht der großen Technologieunternehmen darauf, dass sie eine Größe erlangt haben, die selbst für die mächtigsten Staaten zur Herausforderung werden kann. Drittens kann die Größe solcher Firmen selbst zu einem Innovationshindernis werden, wenn diese über längere Zeit eine quasimonopolistische Stellung innehaben und kaum noch echter Konkurrenz ausgesetzt sind.
Dies stellt die Regierungen in Peking und Washington vor die Herausforderungen, ihren Technologieunternehmen genug Freiräume zu lassen, um international erfolgreich und innovativ zu sein, ohne dabei wirtschaftliche Macht in einer Weise zu konzentrieren, die im eigenen Land politisch oder auch wirtschaftlich zum Problem werden könnte. In China war über die letzten Jahre zu beobachten, wie die Kommunistische Partei gezielt ihre Kontrolle über die Technologieunternehmen gefestigt hat.15 Auch in den USA hatte sich in der Amtszeit von Biden angedeutet, dass das Kartellrecht in Stellung gebracht werden könnte, um die Macht der US-Unternehmen einzuhegen.16 Doch mit dem abermaligen Amtsantritt von Donald Trump zeichnet sich eher ein neuer Pakt zwischen der Regierung und den Unternehmen ab: Solange die Unternehmen Trumps umfassenden Machtanspruch akzeptieren, ist er bereit, ihnen weitreichenden Spielraum zu gewähren und ihre Interessen im Ausland offensiv zu vertreten.17
Geoökonomische Denkmuster als Risiko für Europa
Für den Rest der Welt birgt das Wiedererstarken »realistischer« geoökonomischer Denkmuster mit Blick auf die Technologiepolitik erhebliche Risiken. Die Regierungen in Washington und Peking eint, dass sie sich als zentrale Akteure einer globalen Konfrontation verstehen, die wesentlich über den Zugang zu modernster Technologie ausgetragen wird. Dabei hängt die relative Stärke der beiden Rivalen unter anderem davon ab, ob es ihnen gelingt, relevante Märkte zu dominieren. In der Logik eines Nullsummenspiels droht so die weitere Ausdifferenzierung technopolitischer Einflusssphären.
Gemäß dieser Konfliktdeutung liegt es nicht im Interesse der USA und Chinas, die internationale Marktmacht der Tech-Unternehmen zu beschränken. Deswegen ist zu befürchten, dass sich die heute schon zu beobachtende Technologieasymmetrie zwischen diesen Unternehmen und dem Rest der Welt verfestigt und sogar verstärkt. Spätestens in mittlerer Frist würde dies die wirtschaftlichen Aussichten anderer Staaten erheblich trüben und darüber hinaus wahrscheinlich ihre politischen Gestaltungsspielräume einschränken.
Gerade für die liberalen Marktwirtschaften Europas ist dies nicht zuletzt eine konzeptionelle Herausforderung.18 Sie müssen sich darauf einstellen, dass mächtige Staaten mit ihrem geoökonomisch motivierten Vorgehen die globalen Märkte und deshalb auch das Handeln globaler Unternehmen immer mehr verzerren. Und sie müssen Wege finden, darauf zu reagieren, ohne ihrerseits dazu beizutragen, diese Verzerrungen zu vergrößern. Diese Aufgabe wird umso anspruchsvoller, wenn zugleich das Ziel lautet, einen möglichst wenig politisierten Binnenmarkt in Europa zu bewahren.
Einen Ansatzpunkt hierfür bilden die oben ausgeführten Überlegungen zu einer wirklich strategischen, vor allem langfristig angelegten Politik zur Innovationsförderung. Ein Beispiel dafür, wie dieser Balanceakt im Rahmen kurz- bis mittelfristiger Maßnahmen gelingen kann, wäre eine konsequentere Anwendung des bestehenden Kartellrechts, möglicherweise sogar eine Verschärfung der entsprechenden Rechtsgrundlagen. Damit wäre es möglich, sich der geoökonomisch motivierten Marktkonzentration in vielen Technologiebereichen entgegenzustellen und so den Raum für mehr Wettbewerb und Innovation zu schaffen.
Maßnahmen wie diesen ist gemein, dass sie sich als Reaktion auf geoökonomische Konfliktmuster eignen, ohne dass sie selbst mit machtpolitischen Argumenten begründet werden müssen. Hier bietet sich eine Chance, die für Europas Wirtschaft lange prägenden Ordnungsvorstellungen praktisch wirksam werden zu lassen und zudem diskursiv zu verteidigen. Voraussetzung für eine solche Politik ist allerdings die Bereitschaft, Konflikte mit den USA und China auszuhalten. Denn im Kalkül dieser Staaten bilden solche Politikansätze eine Gefahr für ihre geoökonomisch verstandene Machtposition, die gegenwärtig durch staatliche Eingriffe in marktwirtschaftliche Vorgänge auf- und ausgebaut wird.
Teil II Geoökonomisches Handeln
Geoökonomisches Handeln in der EU‑Handels- und ‑Investitionspolitik
Geoökonomische Zeitenwende in der EU‑Handels- und ‑Investitionspolitik
Geoökonomisches Handeln wird gemeinhin beschrieben als »Tendenz in den internationalen Beziehungen, wirtschaftspolitische Instrumente einzusetzen, um außenpolitische Ziele im Bereich Sicherheit oder Geopolitik zu verfolgen«.1 Die Voraussetzungen dafür wurden in der EU bereits mit dem Vertrag von Lissabon geschaffen. Darin ist seit 2009 festgelegt, dass die »gemeinsame Handelspolitik […] im Rahmen der Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handelns der Union gestaltet«2 wird. In der Praxis bewegt sich die EU jedoch in einem Spannungsfeld aus gemeinsamer Handelspolitik einerseits, die in ihrer ausschließlichen Kompetenz liegt, und zwischenstaatlicher Außen- und Sicherheitspolitik andererseits, die die Mitgliedstaaten verantworten. Eine sich zuspitzende geopolitische Lage hat die EU‑Handels- und ‑Investitionspolitik – im Rahmen ihrer Kompetenzen – zu einer »geoökonomischen Wende«3 veranlasst, die dadurch gekennzeichnet ist, dass neben wirtschaftlichen Zielen zunehmend auch außen- und sicherheitspolitische Ziele verfolgt werden. Die Herausforderung besteht darin, Prioritäten und Arbeitsweisen der EU und ihrer Mitgliedstaaten zusammenzubringen, um Instrumente zu entwickeln, die sowohl wirtschaftlich effektiv als auch geopolitisch strategisch sind, ohne dabei die interne Kohärenz der EU-Außenpolitik zu gefährden.
Mit ihrer Handelsstrategie von 2021 unter dem Titel »Eine offene, nachhaltige und entschlossene Handelspolitik« nimmt die EU diese Herausforderungen für ihre Handelspolitik an. Zur Offenheit und Nachhaltigkeit tritt jetzt als weiterer Leitbegriff die Entschlossenheit hinzu. Diese bezieht sich auf verschiedene Aspekte, zu denen als Ziel nicht nur die Durchsetzung und Stabilität der regelbasierten Ordnung hinzukommt, sondern – mit Blick auf deren Erosionserscheinungen – auch die Durchsetzung der Rechte und Interessen der EU, die Abwehr ökonomischen Drucks sowie die Resilienz der EU. Diese Handelsstrategie führt das Konzept der offenen strategischen Autonomie ein, das seitdem den politischen Diskurs der EU prägt. Parallel dazu entwickelt die EU in schneller Folge »autonome Maßnahmen«, das heißt unilaterale Instrumente, die zum einen der Nachhaltigkeit dienen, zum anderen aber auch den oben genannten Ansprüchen genügen sollen, wirtschaftlich effektiv und geopolitisch strategisch zu sein.
Während die Handelsstrategie von 2021 noch ausschließlich von handelspolitischen Akteuren erarbeitet wurde, ist die Europäische Strategie für wirtschaftliche Sicherheit von 2023 in Zusammenarbeit mit außen- und sicherheitspolitischen Akteuren der EU entstanden. Diese Strategie zielt darauf ab, die eigene Wettbewerbsfähigkeit4 zu stärken, die EU vor Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit zu schützen sowie mit möglichst vielen Drittländern zusammenzuarbeiten, die dieselben Anliegen oder Interessen in Bezug auf wirtschaftliche Sicherheit haben. Die Formel promote, protect and partner bringt diese Ausrichtung auf den Punkt. Der Schutz und die Zusammenarbeit gehören dabei zum Gegenstandsbereich der Handelspolitik als Teil des auswärtigen Handelns der Europäischen Union.
Diese strategische Neuausrichtung verdeutlicht die Europäische Kommission unter anderem in der Umbenennung ihrer Generaldirektion »Handel« zur Generaldirektion »Handel und wirtschaftliche Sicherheit« für die Legislaturperiode 2024–2029.
Akteure und Instrumente geoökonomischen Handelns
In der Praxis bedeutet die geoökonomische Neuausrichtung der EU-Handelsstrategie, dass klassische Akteure der EU-Handelspolitik verstärkt mit Akteuren der Außen- und Sicherheitspolitik zusammenarbeiten. So entwickeln die Generaldirektion Handel und wirtschaftliche Sicherheit (DG TRADE) in der Europäischen Kommission, der Ausschuss für internationalen Handel (INTA) des Europäischen Parlaments sowie der Rat für Auswärtige Angelegenheiten (FAC) in der Zusammensetzung Handel bestehende Instrumente fort und schaffen neue. Letztere sollen es der EU ermöglichen, mit ihrer Handels- und Investitionspolitik auf geopolitischen Druck und neue Herausforderungen zu reagieren. Damit dies gelingt, müssen sich die handelspolitischen Akteure mit denen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) abstimmen. Die GASP wiederum liegt in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, wird vom Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) implementiert und koordiniert und untersteht der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP).
In der EU-Strategie für wirtschaftliche Sicherheit tritt der Nexus zwischen Handel und Sicherheit deutlich zutage.
Die Strategie für wirtschaftliche Sicherheit haben die Europäische Kommission und der HR/VP 2023 gemeinsam vorgestellt. Dass der HR/VP als nichtwirtschaftlicher Akteur an der Erarbeitung einer Strategie für Wirtschaftssicherheit beteiligt war, illustriert die geoökonomische Neuorientierung der EU‑Handels- und ‑Investitionspolitik.
Betrachtet man genauer, wer für die in dieser Strategie genannten Handels- und Investitionsinstrumente jeweils zuständig ist, tritt der Nexus zwischen Handel und Sicherheit deutlich zutage. So fallen die Instrumente gemäß der Kompetenzverteilung der EU zwar nicht in die Zuständigkeit der GASP, weisen aber vermehrt direkte Bezüge zu ihr auf (siehe Tab. 1, S. 48).
Diejenigen handels- und investitionspolitischen Instrumente, die den Handel-Sicherheits-Nexus in besonderer Weise darstellen und als exemplarisch für die Wende der EU zu geoökonomischem Handeln gelten, sind im zweiten Pfeiler der Strategie (»Protect – Schutz vor wirtschaftlichen Risiken und Bedrohungen«) zu finden: die Verordnung über die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen von 2019, das Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang (Anti-Coercion Instrument, ACI) von 2023 und die für 2025 angekündigte Überprüfung von Investitionen in Drittstaaten.
Die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in die EU wurde 2019 durch einen Kooperationsmechanismus gestärkt, der sicherstellen soll, dass strategische Sektoren vor Übernahmen geschützt sind, die die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährden könnten. Seitdem hat die EU den Mechanismus von einem freiwilligen Kooperationsrahmen zu einem verpflichtenden, harmonisierten System ausgebaut, das nahezu alle Mitgliedstaaten umfasst. Seit 2024 werden auch indirekte Beteiligungen von Unternehmen aus Drittstaaten an Unternehmen in der EU stärker reguliert; dasselbe gilt für weitere Sektoren, die als sensibel eingestuft worden sind. Ab 2025 sollen zusätzlich Outbound-Investitionen in Hochtechnologien überwacht werden. Das 2023 eingeführte Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang fügt sich ebenfalls in die geoökonomische Neuausrichtung der EU-Handelspolitik ein, indem es der EU ermöglicht, auf wirtschaftlichen Zwang mit Gegenmaßnahmen wie Handels- oder Investitionsbeschränkungen zu reagieren und so ihre Souveränität zu schützen. Diskutiert wurde das Instrument im Kontext des Handelskonflikts mit den USA, angewendet wurde es jedoch bisher nicht (Stand: September 2025).
Zielkonflikte und Handlungsempfehlungen
In einem (neo-)liberalen Verständnis zielt grenzüberschreitender Handel darauf ab, einen globalen Raum zu gewährleisten und gleichzeitig einzuhegen, der staatlichem Einfluss entrückt ist. In diesem globalen Raum sollen sich Marktakteure frei entfalten können. Staatlicher Eingriff dient vorrangig dazu, Protektionismus zu bekämpfen und einen Rahmen zu setzen und zu erhalten, in dem Wettbewerb stattfinden, Diskriminierung ausgeschlossen und Nachhaltigkeit garantiert werden kann. In diesem Verständnis gründet sich Handelspolitik auf die allseitigen Vorteile internationaler Arbeitsteilung und ihren Beitrag zu Wachstum, Wohlstand und Entwicklung für alle. Dem entspricht die Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) als multilaterale Form der Governance.
Schon mit den vielfältigen Freihandelsabkommen schaffen sich Staaten und Staatenverbünde wie die EU in diesem globalen Raum Einflussbereiche exklusiver Präferenz und Kooperation in bilateralen und regionalen Formaten. Darin lässt sich bereits im Ansatz ein »geoökonomisches« Muster erblicken. Die geoökonomische Wende tritt programmatisch erst ein, wenn Strategien für wirtschaftliche Sicherheit entwickelt werden, wie die EU und zuvor in ähnlicher Form schon Japan und die USA es getan haben. Mit solchen Strategien wird die gewollte Autonomie des Marktes und der Wirtschaft als Ordnungsideal zusehends überformt, indem außen- und sicherheitspolitische Prioritäten gesetzt werden.
In geoökonomischer Sicht weicht das Bild eines globalen Marktes der Vorstellung eines Kräfteparallelogramms: Rivalisierende Handelsmächte verstehen die Stärke und Resilienz des eigenen Wirtschaftsraumes sowie die Handelsströme als Einflussgrößen, und sie identifizieren sich mit dem Erfolg oder Misserfolg ihrer Wirtschaftssubjekte. In diesem Sinne drängt Macht zurück auf den Markt. Dabei muss Versicherheitlichung als ein relationales Konzept verstanden werden: Je mehr Akteure sicherheitspolitischen Handlungsmustern im internationalen Wirtschaftsverkehr folgen, desto mehr wächst der Druck auf andere, es ihnen gleichzutun.
In ihrer Strategie für wirtschaftliche Sicherheit definiert die EU die unten in der Tabelle wiedergegebenen drei Aktionsfelder promote, protect und partner. Dadurch verknüpft sie die in der Strategie behandelten Bereiche der Wirtschaftspolitik mit dem Gesichtspunkt der Sicherheit. Mit protect und partner ist besonders die Handelspolitik angesprochen.
Die Stärkung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit, beschrieben im Aktionsfeld »Promote – Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Innovation«, ist eine wichtige Aufgabe der EU‑Binnenmarkt- und ‑Binnenwirtschaftspolitik.
Im Sinne des protect diente schon die Handelsstrategie von 2021 mit ihrem Konzept der offenen strategischen Autonomie dazu, die europäischen Unternehmen, den Binnenmarkt, die Autonomie der EU sowie die offene, regelbasierte Welthandelsordnung zu schützen. In noch viel größerem Maße gilt dies für die in den letzten Jahren eingeführten unilateralen Instrumente, die im Aktionsfeld »Protect – Schutz vor wirtschaftlichen Risiken und Bedrohungen« aufgelistet sind.
Mit den im Aktionsfeld »Partner – Internationale Zusammenarbeit und Multilateralismus« genannten Instrumenten bzw. im Rahmen der dort aufgeführten Organisationen und Kooperationen unternimmt die EU Anstrengungen, die WTO zu stabilisieren. Dabei geht es darum, das regelbasierte, offene Welthandelssystem zu verteidigen. Dieses kanalisiert nämlich Impulse der Versicherheitlichung durch eine Ausnahmeklausel im WTO-Recht. Diese erlaubt es, im Sinne eines »Sicherheitsventils«, zu Zwecken der nationalen Sicherheit von den allgemeinen Regeln abzuweichen – was allerdings an einschränkende Voraussetzungen geknüpft ist. Auf eine Beschwerde der Ukraine hin, Russland blockiere den Transit ukrainischer Waren durch sein Territorium, hat die WTO-Streitschlichtung klargestellt, dass sie in engen Grenzen selbst überprüft, ob solche Voraussetzungen vorliegen. Demgegenüber beharren die USA darauf, dergleichen selbst zu bestimmen, und verpflichten andere Staaten in Handelsverträgen dazu, diese Rechtsposition anzuerkennen.5 Im Interesse der Aufrechterhaltung des Regelsystems sollte sich die EU dem entgegenstellen. Ebenso sind Initiativen zur Reaktivierung der WTO und ihrer Funktionen weiter zu unterstützen. Hier ist insbesondere die Mehrparteien-Übergangsvereinbarung zur Beilegung von Handelsstreitigkeiten zu nennen, mit der 57 WTO-Mitglieder sich auf ein provisorisches Berufungsverfahren verständigt haben. Es soll die durch das Veto der USA blockierte Rechtsmittelinstanz der WTO ersetzen und verdient jede Unterstützung.
|
Pfeiler / Instrument |
Zuständige Generaldirektion der Europäischen Kommission |
Zuständige Formation im Rat der EU |
Zuständiger Ausschuss des Europäischen Parlaments |
Bezug zur GASP |
||
|
Partner – Internationale Zusammenarbeit und Multilateralismus |
||||||
|
Freihandelsabkommen |
DG TRADE |
Rat für Auswärtige Angelegenheiten (Handel) |
INTA |
kann berücksichtigt werden |
||
|
Global Gateway |
DG INTPA |
nicht zuständig |
AFET, DEVE, Stellungnahme: INTA |
HR/VP einbezogen |
||
|
Multilaterale Organisationen und Kooperationen (z. B. WTO, VN, MDBs, G7/G20, TTC) |
DG CNECT, DG GROW, DG INTPA, DG TRADE |
Rat für Auswärtige Angelegenheiten |
AFET, INTA und Parlamentarische Delegationen |
EAD und HR/VP meist involviert |
||
|
Generaldirektionen (DGs) der Europäischen Kommission: CNECT Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien COMP Wettbewerb ECFIN Wirtschaft und Finanzen GROW Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und kleine und mittlere Unternehmen INTPA Internationale Partnerschaften TRADE Handel und wirtschaftliche Sicherheit |
Ausschüsse des Europäischen Parlaments: AFET Auswärtige Angelegenheiten DEVE Entwicklung ECON Wirtschaft und Währung EMPL Beschäftigung und soziale Angelegenheiten IMCO Binnenmarkt und Verbraucherschutz INTA Internationaler Handel ITRE Industrie, Forschung und Energie JURI Recht TRAN Verkehr und Tourismus |
|||||
|
MDBs Multilaterale Entwicklungsbanken TTC Handels- und Technologierat |
||||||
|
Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf den in der »Europäischen Strategie für wirtschaftliche Sicherheit« explizit genannten Instrumenten mit Handels- und Investitionsbezug. Europäische Kommission, Gemeinsame Mitteilung an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat und den Rat über eine »Europäische Strategie für wirtschaftliche Sicherheit«, JOIN(2023) 20 final, Brüssel, 20.6.2023, Kapitel 3, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023JC0020>. |
||||||
Freihandelsverträge nehmen als traditionell weit entwickeltes Instrument der EU-Handelspolitik an Bedeutung zu.6 Sie dienen in einer deutlich defensiven Richtung dazu, der EU Marktzugänge zu sichern, unterstützen damit die Diversifizierung der Handelsströme und damit wiederum das de-risking. Sie können, in Zeiten einer zunehmenden Erosion der WTO, als eine Art Sicherheitsnetz ein offenes und regelbasiertes Welthandelssystem gewährleisten. Handelsverträge können aber auch offensiv genutzt werden, zum Beispiel um freundschaftliche Beziehungen zu vertiefen. Neben den schwerfälligen und voraussetzungsvollen Freihandelsabkommen kommen dafür auch sogenannte »Mini-Abkommen« in Frage, etwa zu Investitions- und Rohstoffthemen oder zum digitalen Handel. »Offensiv« kann die EU darüber hinaus handeln, indem sie bestimmte Akteure für Abkommen nicht in Betracht zieht und damit ein Signal setzt.
Bei der Vereinbarung von Handelsverträgen muss die EU sich entscheiden, welche Prioritäten sie setzen will.
Es ist allerdings nicht zu übersehen, dass es für die EU oft schwierig ist zu entscheiden, welche Art von Handelsvertrag mit welchem Partner oder welchen Partnern sie anstreben sollte, welche Prioritäten sie setzen soll und wie Konsens erreicht werden kann.7 Hier streiten die Wertgebundenheit der auswärtigen Politik der EU mit Energie- und Rohstoffinteressen und der Suche nach Zugang zu ausländischen Märkten. Ob mit Saudi-Arabien Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen aufgenommen oder ob das Investitionsabkommen mit der Volksrepublik China zum Abschluss gebracht werden soll – in beiden Fällen stellen sich diese Fragen besonders deutlich.
Diese schwierige Wahl verweist auf die vielgestaltigen und komplexen Zielkonflikte, denen sich die Handelspolitik in der geoökonomischen Zeitenwende gegenübersieht. Dabei geht es nämlich keineswegs nur um den auf der Hand liegenden Fall, dass Handel und Investitionen zugunsten der Sicherheit und damit zu außen- und sicherheitspolitischen Zwecken eingeschränkt werden. Hier mag es sogar in Einzelfällen einen Gleichlauf geben, wenn ein Freihandelsabkommen den Zugang zu einem Markt sicherstellt und zugleich die Beziehungen zu einem freundschaftlich gesinnten Partner vertiefen hilft. Gerade bei Freihandelsabkommen kann sich jedoch ein weniger offensichtlicher, aber folgenreicher Interessenkonflikt mit den Nachhaltigkeitszielen der EU-Handelspolitik ergeben. Zu diesen Nachhaltigkeitszielen gehört, dass menschenwürdige Arbeit, Umweltschutz und zunehmend auch weitere Bereiche des Menschenrechtsschutzes gewährleistet sein müssen. Wenn aber Interessen von Handel und Sicherheit für den raschen Abschluss von Handelsabkommen sprechen, kann es passieren, dass Zugeständnisse bei den Nachhaltigkeitszielen oder Abstriche bei den unilateralen Nachhaltigkeitsinstrumenten und ihrer Durchsetzung gemacht werden.
Die EU steht damit vor der Herausforderung, in ihrer Handels- und Investitionspolitik für Kohärenz zwischen den Zielen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Handel zu sorgen. Zusätzlich ist ein passgenauer Anschluss an die internen Politiken zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, die in der Strategie für wirtschaftliche Sicherheit ebenfalls angesprochen sind. Dazu müssen sich verschiedene Akteure und Politikfelder mit unterschiedlichem Kompetenzgefüge und unterschiedlicher institutioneller Verankerung koordinieren: Konkret erfordert die Umsetzung der Strategie für wirtschaftliche Sicherheit eine Abstimmung der Handelspolitik mit der Außen- und Sicherheitspolitik. Da die Strategie aber nicht nur externe Maßnahmen im Sinne der Handelspolitik vorsieht, sondern auch interne Maßnahmen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und zum Binnenmarkt, ist überdies eine Koordination mit diesen Politikbereichen und der zuständigen Generaldirektion (DG GROW) notwendig. Dasselbe gilt für die Koordination mit den verschiedenen Feldern der Nachhaltigkeitspolitik.
Die Zielkonflikte durch Abstimmung zu bewältigen ist wichtig, weil die geoökonomische Wende mit ihren vielfältigen Maßnahmen Kosten und Nachteile mit sich bringt. Sie mindert den Handel und seine wohlstandsfördernde Funktion, kann Protektionismus schüren und errichtet bürokratische Hürden, die besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU) treffen. Die zahlreichen bilateralen und unilateralen Aktionen und Maßnahmen untergraben darüber hinaus den multilateralen Ansatz der Welthandelsordnung und seine wichtige Legitimationsfunktion. Insgesamt stellt sich hier die Aufgabe, widerstreitende Ziele zu verwirklichen, indem Vor- und Nachteile abgewogen und möglichst ein Ausgleich herbeigeführt wird. Diese Aufgabe kann kaum allein dadurch gelöst werden, dass sich die beteiligten EU-Organe und die Ressorts in den Mitgliedstaaten abstimmen. Das Wissen um Abhängigkeiten, Verwundbarkeiten, um Handlungsoptionen und potentielle Nachteile – insgesamt das Risikowissen – liegt bei den Unternehmen und der Wirtschaft. Es ist deswegen unabdingbar, dass die EU und die Mitgliedstaaten Wege und Verfahren entwickeln, um Unternehmen und die Wirtschaft mit ihrem Wissen in die Abstimmung einzubeziehen.
Energiepolitik in der geoökonomischen Zeitenwende: Die EU zwischen Markt und Macht
Energie hat eine doppelte Natur: Sie ist ein wirtschaftliches Gut und zugleich ein strategisches Machtinstrument. In der geoökonomischen Zeitenwende gewinnt die Machtdimension an Bedeutung: Politische Interessen und staatliche Eingriffe haben Energiebeziehungen zusehends »versicherheitlicht«. Die Konzentration fossiler und mineralischer Ressourcen, oligopolitische Angebotsstrukturen und die technologische Komplexität grüner Energieträger verstärken diese Entwicklung. Energie wird so erneut zu einem geopolitischen Hebel – etwa durch Preissteuerung, Infrastrukturkontrolle oder Technologiedominanz.1 Für das traditionell marktbasierte Modell der Europäischen Union als Nettoimporteur ist das ein Paradigmenwechsel. Die EU setzte lange auf ihren liberalisierten Binnenmarkt und internationale Kooperation zur Sicherung der Energieversorgung – selbst im Zuge der Energiewende hatte der Markt Vorrang vor geopolitischem Kalkül.
Die geoökonomische Zeitenwende erzwingt nun ein Umdenken: Die EU-Energiepolitik wird zusehends mit Technologie-, Rohstoff- und Industriepolitik verzahnt. Die mit ihr verknüpften Ziele richten sich nicht mehr nur in klassisch defensiver Weise auf Versorgungssicherheit, sondern auf den Abbau von Abhängigkeiten und den Aufbau von Resilienz. Zugleich werden mit der Energiepolitik verstärkt offensive, sicherheits- und außenpolitische Intentionen verfolgt. Mit Instrumenten der Sanktionspolitik, mit Kauf- und Exportverboten und der Setzung normativ-technologischer Standards wird im Rahmen dieses Politikfelds auf die Verhaltensänderung dritter Akteure oder die Durchsetzung eigener Interessen hingearbeitet.2
Gleichzeitig schränken strukturelle Abhängigkeiten und institutionelle Schwächen die Handlungsspielräume der EU erheblich ein. Ihre Ziele kann die Union daher weiterhin vor allem defensiv erreichen. Dafür braucht es den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien, Technologieoffenheit (die Erdgas und Atomkraft einschließt), eine vollendete Energieunion und eine engere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, den EU-Institutionen und der Energiewirtschaft.
Energiepolitik zwischen Markt und Macht
Energiepolitik bewegt sich traditionell im Spannungsfeld zwischen Markt und staatlicher Macht. Während ein marktgetriebenes Modell der Organisation nationaler Energiesysteme auf Liberalisierung, Deregulierung und wirtschaftliche Dynamiken sowie auf die Wirkung von Preissignalen setzt, fußt ein staatszentriertes Modell auf der strategischen Rolle des Staates als Regulierer und Subventionierer, auf der einflussreichen Rolle staatlicher Energieunternehmen und der Vereinbarung langfristiger Abnahme- und Lieferverträge. Die Dualität zwischen diesen beiden Ansätzen prägt seit jeher auch die internationalen Energiebeziehungen, insbesondere zwischen Export- und Importländern.3
Hauptaufgabe der energiearmen Importländer ist traditionell die Herstellung von Energieversorgungssicherheit, auf Seiten der energieproduzierenden Exportländer ist es die Sicherung der Abnahme ihrer Ressourcen. Eine enggefasste Definition von Energiesicherheit misst einer nachhaltigen, sicheren und erschwinglichen Versorgung oberste Priorität innerhalb der Energiepolitik zu.4 Eine solche Definition basiert ausschließlich auf einem kommerziellen, marktbasierten Verständnis von Energie. Die Faktoren, die hierbei ins Kalkül gezogen werden, sind Angebot und Nachfrage, effiziente Marktallokation, Preisgestaltung und internationale Marktbeziehungen. Dabei ausgeblendet werden die räumlich-geographische Konzentration von Ressourcen, technologische Entwicklungen, politische Präferenzen und Ambitionen sowie geopolitische Umwälzungen.
Die geographische Konzentration von Ressourcen sowie infrastrukturellen Verbindungen bestimmt und kennzeichnet allerdings seit jeher die Energiemärkte und die Beziehungen zwischen Produzenten und Konsumenten. Dieser Faktor ist prägend für fossile sowie für erneuerbare Energieressourcen im Besonderen – wenngleich in unterschiedlichem Maße. Gas- und Ölressourcen sind generell geographisch konzentriert. Auf diesem Umstand beruht die Marktmacht und politische Macht der Länder, die Energie und Energieträger produzieren und exportieren. Erneuerbare Energien wie Sonne und Wind sind hingegen geographisch weniger konzentriert als fossile Rohstoffe, was theoretisch das Risiko asymmetrischer Abhängigkeiten reduziert. Allerdings sind Geologie und Raumkonzentration von kritischen Mineralien, die für viele grüne Technologien benötigt werden, auch in einem post-fossilen Energiesystem von großer Bedeutung. Anders als in der fossilen Energiewelt kommt bei grünen Energieträgern auch eine erhöhte Technologie- und Industrieintensität hinzu. Die Faktoren Technologieentwicklung und Industriewertschöpfung können dementsprechend – neben der geographischen Konzentration von Ressourcen und Infrastruktur – auch in einem grünen Energiesystem Marktdominanz schaffen und marktverzerrende Praktiken begünstigen.5
Energie ist somit zwar ein zunehmend global gehandeltes Gut, dessen Verfügbarkeit weiterhin von gut funktionierenden Marktmechanismen geregelt und gewährleistet wird. In Zeiten geopolitischer Spannungen, einer Fragmentierung der politischen Weltordnung und erodierender Akzeptanz multilateraler Institutionen werden der Energiehandel und die Ausgestaltung von Energiebeziehungen allerdings nicht nur den Marktmechanismen und privaten Marktakteuren überlassen, sondern stellen auch eine zentrale Aufgabe des Staates dar. Dessen Möglichkeiten, Einfluss auf Preisgestaltung, Handelsflüsse und Infrastruktur zu nehmen und technologische und industrielle Dominanz auszuspielen, sind politisches Kapital, das sich als geoökonomisches Instrument einsetzen lässt. Dieser Einsatz kann entweder defensiven Zwecken dienen, um die Versorgung mit Energie durch Diversifizierung, Redundanz und Absicherung von Lieferketten sicherzustellen. Oder er kann offensiv ausgerichtet sein, etwa indem Energiebeziehungen durch Sanktionen, Kaufverbote, Lieferstopps oder durch eine entsprechende Vertrags- und Preispolitik beschränkt werden, um außen- und sicherheitspolitische Interessen gegenüber externen Akteuren zu verfolgen.6
Außen- und sicherheitspolitische Ziele der EU-Energiepolitik: von Markt zu Macht?
Die außen- und sicherheitspolitische Dimension der Energiepolitik hat insbesondere seit der Corona-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Verzahnung von Energiepolitik mit sicherheitspolitischen Zielen stellt die EU vor große Herausforderungen. Bis zum 22. Februar 2022 war die EU-Energiepolitik primär marktorientiert und darauf fokussiert, Fälle von Marktbeherrschung im Binnenmarkt zu vermeiden. Bereits 2007 nahmen die EU und ihre Mitgliedstaaten Anlauf zu einer koordinierten Energiepolitik. Der Vertrag von Lissabon (2009) schuf dafür eine supranationale Grundlage. Das 2015 verabschiedete Paket zur Energieunion sollte Energiesicherheit strategisch verankern. Das Vorhaben hatte allerdings nur mäßigen Erfolg.7 Im Vordergrund standen die Liberalisierung und Marktintegration des Gas- und Stromsektors. Eine mit vollständigen Hoheitsbefugnissen ausgestattete Energieaußenpolitik konnte indes nicht etabliert werden (und fehlt weiterhin). In dieser Zeit hatte zudem die Klimapolitik Vorrang vor Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Während die EU mit dem Green Deal Klimaziele klar und offensiv priorisierte, diente ihr die Verzahnung von Energie- und Klimaaußenpolitik vor allem zur Förderung globaler Klimaschutzmaßnahmen. Die Aspekte Energiediplomatie und Versorgungssicherheit traten dahinter zurück.8
Seit der Corona-Pandemie und mehr noch seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den daraus folgenden Verwerfungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten hat der politisch motivierte Missbrauch von Energieinterdependenzen (»weaponization«) zugenommen. Für die EU bedeutet dies, dass sie ihre energiepolitischen Ziele, Prioritäten und Instrumente neu ausrichten muss – sowohl mit Blick auf die fossile Energieversorgung als auch die Energietransformation.
Der Dekarbonisierung kommt nun neben der klimapolitischen auch eine geoökonomische Funktion zu.
Auch wenn Dekarbonisierung und grüne Transformation wichtige Treiber der EU-Energiepolitik bleiben, lässt sich in der Haltung gegenüber dem Energie-Trilemma – dem Konflikt zwischen den Zielen Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit – eine Verschiebung beobachten. Das Hauptinteresse gilt nun der Minimierung von Risiken durch den Aufbau industriepolitischer Resilienz, Autonomie und Unabhängigkeit sowie dem verstärkten Einsatz regulativer, wirtschaftlicher und industriepolitischer Instrumente zur geopolitischen Einflussnahme auf externe Akteure. Dadurch kommt auch der Dekarbonisierung nicht mehr nur eine klimapolitische, sondern auch eine geoökonomische Funktion zu. Die EU und ihre Mitgliedstaaten setzen im Zuge dieser veränderten Priorisierung eine Vielzahl neuer wirtschaftlicher und technologischer Maßnahmen ein. Diese beruhen auf einem umfassenden, teils erneuerten rechtlich-regulatorischen Werkzeugkasten. Dieser zunehmende Einsatz der Energiepolitik als geoökonomischem Machtinstrument offenbart zugleich die fortbestehenden finanziellen, wirtschaftlichen und institutionellen Grenzen des EU-Handelns.
Defensives Oberziel und Instrumente: Minimierung von Risiken und Verwundbarkeiten
Die EU bleibt stark von fossilen Energieimporten abhängig, insbesondere von Erdgaslieferungen. Im Jahr 2023 deckte sie 58 Prozent ihres Energieverbrauchs durch Importe ab. Bei Erdgas lag die Importquote bei 90 Prozent (Deutschland: 95 Prozent).9 Diese Abhängigkeit wird mittelfristig bestehen bleiben. Eine signifikante Reduktion der Gasnachfrage ist erst nach 2030 möglich und nur unter der Voraussetzung, dass Elektrifizierung und Wasserstoff Erdgas in nennenswertem Umfang substituieren können.
Auch im post-fossilen Energiesystem bleibt die EU importabhängig, was insbesondere für Wasserstoff, Solar- und Windtechnologien sowie mineralische Rohstoffe gilt. 97 Prozent der Solarzellen und Siliziumwafer (in Solarmodule eingebaute Halbleiter) stammen aus China. Auch bei kritischen Rohstoffen wie Iridium, Platin, Nickel, Lithium und Kobalt ist die EU auf Importe angewiesen.10
Angesichts dieser Importabhängigkeit verfolgt die EU in ihrer Energiepolitik eher defensive Ziele. Sie fokussiert sich auf Versorgungssicherheit und Risikominimierung. Die Diversifizierung fossiler Energieimporte, der Ausbau erneuerbarer Energien, die Sicherstellung kritischer Rohstoffe und die Erhaltung und Entwicklung der eigenen Industrie und Technologieführerschaft sollen ihre Resilienz und Unabhängigkeit im Energiebereich stärken.
Im Gasbereich reduzierte die EU seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ihre Abhängigkeit von Russland durch eine Umorientierung auf alternative Lieferanten wie Norwegen, die USA, Katar und afrikanische Staaten und mit der Durchsetzung anderer Preis- und Liefermechanismen auf dem globalen LNG-Markt. Parallel weitete sie strategische Energiereserven aus, führte verbindliche Vorgaben für den Füllstand von Gasspeichern ein, erweiterte die Infrastruktur für LNG und verbesserte Krisenmechanismen.11
Erneuerbare Energien werden dabei nicht nur klima-, sondern vor allem sicherheitspolitisch relevanter. Mit dem beschleunigten Ausbau von Wind- und Solarenergie und der Nutzung von Wasserstoff sollen geopolitische Risiken reduziert werden.12 Die EU hat nach Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine die Zielvorgabe, bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch auf 32 Prozent zu steigern, auf 42,5 Prozent erhöht. Die Mitgliedstaaten sind aufgerufen, 45 Prozent anzupeilen. Dieses Ziel soll durch eine überarbeitete Richtlinie für erneuerbare Energien erreicht werden, die 2023 verabschiedet wurde. Der EU Green Deal und der RePowerEU-Plan sehen wiederum vor, bis 2030 eine Solar- und Windkapazität von 80 bis 120 Gigawatt allein für die Wasserstoffproduktion aufzubauen.
Der Ausbau der Infrastruktur für grüne Energieträger steht dabei ganz oben auf der Agenda. Projekte wie das Hydrogen Backbone zum Aufbau eines Europäischen Wasserstofftransportnetzes, Offshore-Windparks in der Nordsee und der Netzausbau fördern aus Sicht der EU die energie- und industrielle Unabhängigkeit Europas und erweitern zudem den geopolitischen Handlungsspielraum der Union. Die EU investiert daher in strategische Energieinfrastrukturprojekte; etwa 1,25 Milliarden Euro stellt sie dafür etwa aus der Connecting-Europe-Fazilität (2024) bereit.13
Trotzdem ist die EU bei Schlüsseltechnologien wie Batterien, Solarmodulen und Elektrolyseuren (Vorrichtungen zur Herstellung von meist grünem Wasserstoff) sowie bei der Rohstoffbeschaffung, ‑veredelung und ‑verarbeitung nach wie vor stark von Importen abhängig. Gleichzeitig bleiben die Produktionskapazitäten der Union begrenzt, trotz des Anspruchs, in einigen Bereichen wie Wasserstoff Technologieführerschaft anzustreben. Der Critical Raw Materials Act zielt deshalb darauf ab, die heimische Produktion, das Recycling und strategische Partnerschaften zu fördern. Flankiert wird er durch den Clean Industrial Deal, der die europäische Industrie bei der Dekarbonisierung stärken soll.14
Vor diesem Hintergrund bleibt Atomenergie ein umstrittenes, aber strategisch wichtiges Element der EU-Energiepolitik. Für Länder wie Frankreich, Finnland oder Tschechien ist Kernkraft seit langem ein zentraler Faktor bei ihren Bemühungen, die Klimaziele zu erreichen. Angesichts der aktuellen geoökonomischen Herausforderungen gewinnt Atomenergie noch an Bedeutung, da sie zur Diversifizierung der Versorgung und zu technologischer Souveränität beitragen kann.
Neben der Diversifizierung und dem Aufbau von Resilienz wird auch der Schutz kritischer Energieinfrastruktur immer wichtiger. Die EU verstärkt Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere für Pipelines, Stromnetze und Raffinerien. Angriffe wie auf die Gaspipeline Nord Stream 2 verdeutlichen die Notwendigkeit schärferer Sicherheitsvorkehrungen und einer besseren Koordination, insbesondere im maritimen Raum und dort vor allem in der Nord- und Ostseeregion. Die Maßnahmen bleiben allerdings weitestgehend in der Zuständigkeit der Nationalstaaten.15
Offensives Oberziel: Änderung des Verhaltens externer Akteure
Auch wenn die defensiven Ziele Priorität haben, greift die EU vermehrt auch zu Instrumenten, mit denen sie den geopolitischen Herausforderungen, die in erster Linie von Russland und China ausgehen, aktiv begegnen will. Sie nutzt ihre Markt- und Regulierungsmacht, indem sie Sanktionen verhängt und Exportkontrollen erlässt, ausländische Einflussnahme begrenzt, internationale Partnerschaften fördert und die Entwicklung technologischer Standards vorantreibt.
Wirtschaftliche Restriktionen, etwa Embargos für Dienstleistungen und Technologien, die im Energiesektor eine wichtige Rolle spielen, zielen auf eine Schwächung der russischen Energieindustrie. Der Ölboykott und die von der EU angestrebte Einstellung der russischen Gaslieferungen bis 2027 sollten dem Kreml zudem auch finanzielle Ressourcen entziehen. Die direkten Ölimporte aus Russland sind schon jetzt von 25 auf 3 Prozent gesunken, die Gasimporte um zwei Drittel: von 45 Prozent auf deutlich unter 20 Prozent.16
Die EU verschärft zudem die Kontrolle strategischer Investitionen in kritische (Energie-)Infrastrukturen und Schlüsseltechnologien, um geopolitische Einflussnahmen zu begrenzen.17 Die damit einhergehenden Maßnahmen umfassen Screenings von ausländischen Investitionen sowie Handels- und Investitionsbeschränkungen in sensiblen Bereichen wie Wasserstoff, Windkraft und Batterien.18
Um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, die Energieversorgung zu stabilisieren, aber auch um neue grüne Märkte zu erschließen, intensiviert die EU außerdem internationale Energiepartnerschaften. Insbesondere Kooperationen zu erneuerbaren Energien und Wasserstoff sollen neue grüne Märkte nach den Standards und Regelwerken der EU schaffen.
Schließlich und damit verbunden setzt sich die EU für die Etablierung globaler Technologiestandards ein, etwa beim globalen Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft (H2 Global, Europäische Wasserstoffbank, Wasserstoffverordnungen) und im Zusammenhang mit den CO₂-Grenzausgleichsmechanismen.19 Das Setzen dieser Standards soll nicht nur dazu dienen, klimapolitisch Konvergenz zu erzeugen, sondern auch, die Position der EU in globalen Lieferketten zu stärken sowie Wettbewerbsnachteile für die eigene energieintensive Industrie wettzumachen, die durch Dekarbonisierungkosten verursacht werden.
Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten
Trotz neuer Instrumente und Maßnahmen bleibt das geoökonomische Handeln der EU in der Energiepolitik begrenzt. Einerseits bestehen komplexe externe Abhängigkeiten fort, während externe Akteure zunehmend an Gestaltungsmacht gewinnen; andererseits erschwert die institutionelle Struktur der EU ein kohärentes Vorgehen, insbesondere durch die starke Rolle der Mitgliedstaaten bei Zielbestimmung, Umsetzung und Finanzierung.
Die EU bleibt in den Bereichen fossile, grüne und nukleare Energie importabhängig. Nach der Abkehr vom russischen Gas wurden Abhängigkeiten lediglich verlagert. Besonders im LNG-Sektor hat sich die Abhängigkeit von US-Lieferungen unter vertraglich rigiden Bedingungen verstärkt. Der Bezug aus alternativen Quellen wie Katar ist nach wie vor mit einem geopolitischen Risiko verbunden. Zudem konkurriert Europa preislich mit asiatischen Abnehmern, während marktbeherrschende Anbieter wie die USA und Katar mit ihren Energieexporten geopolitische und handelspolitische Ziele verknüpfen.
Eine mögliche Wiederabnahme russischen Pipelinegases, etwa im Zuge von Deals zwischen den USA und Russland, könnte zwar Entlastung bringen, würde aber Abhängigkeiten wiederbeleben und das Ziel der strategischen Autonomie untergraben. Geoökonomische Maßnahmen wie Sanktionen haben sich – etwa gegenüber Russland und China – als begrenzt wirksam oder gar kontraproduktiv erwiesen, wie die anhaltend hohen russischen Einnahmen aus dem Ölverkauf oder Abhängigkeiten in grünen Wertschöpfungsketten zeigen.
Der Ausstieg aus fossilen Energien schafft für die EU neue Abhängigkeiten und birgt neue Risiken.
Die Energietransformation ist nicht nur klimapolitisch, sondern auch geoökonomisch nach wie vor sinnvoll. Doch der Ausstieg aus fossilen Energien ist mit neuen Risiken behaftet: Der Aufbau alternativer Technologien, Lieferketten und Partnerschaften schafft neue Abhängigkeiten. Bei Wasserstoff etwa ist die EU trotz technologischer Stärke auf Importe – insbesondere aus China – angewiesen. Knappheit von Rohstoffen wie Lithium, Kobalt und Nickel sowie Chinas Marktmacht bei Batterien und Schlüsselkomponenten machen restriktive Maßnahmen gegen die Volksrepublik riskant und ineffektiv.
Auch eine Renaissance von Atomkraft zieht neue Verwundbarkeiten nach sich: Die EU ist bei Uranimporten auf Kasachstan, Kanada, Australien und Russland angewiesen. Besonders bei Urananreicherung und Brennelementefertigung verfügt Russland über eine dominierende Marktstellung, was sicherheitspolitische Risiken birgt.
Institutionell bleibt die EU zudem in ihrer außenpolitischen Schlagkraft begrenzt. Die Kommission ist für den Binnenmarkt zuständig, während die Regierungen der Mitgliedstaaten weiterhin wichtige energiepolitische Entscheidungen treffen. Diese Kompetenzverteilung verhindert, dass die Union auf geoökonomischem Feld strategisch kohärent zu handeln vermag. Die Energieunion ist unvollständig, und der Binnenmarktfokus wird den Anforderungen der neuen geopolitischen Realität oft nicht gerecht.
All dies trägt dazu bei, dass offensive Instrumente wie Sanktionen oder Investitionsrestriktionen zu wenig Wirkung entfalten und die EU als energieintensiver Nettoimporteur ihre geoökonomischen Ziele unverändert primär auf defensivem Wege erreichen muss – durch Diversifizierung, Resilienz und strategische Investitionen. Der Aufbau resilienter Infrastrukturen und koordinierter Gasspeicher- und Beschaffungssysteme und eine innovationsgetriebene Industriepolitik sind dabei zwar unverzichtbar, aber nicht ausreichend.
Die EU muss in den Bereichen kritische Rohstoffe und saubere Energien gezielt Partnerschaften etablieren. Die von ihr geschlossenen Handelsabkommen sollten strategischer gestaltet und stärker mit Energie-, Klima- und Industriepolitik verzahnt werden. Zugleich muss die EU aufstrebende Partnerländer als gleichberechtigte Akteure ernst nehmen, zumal diese oft EU-Initiativen wie dem CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) kritisch gegenüberstehen.
Letztlich erfordert die geoökonomische Zeitenwende eine realistische Bewertung der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union in der Energiepolitik. Wo supranationale Lösungen fehlen, ist es empfehlenswert, flexible Formate und eine engere Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten, der Kommission und der privaten Energiewirtschaft anzuvisieren, damit Europa seine Marktmacht tatsächlich strategisch nutzen kann.
Wie die Bundesrepublik und die EU ihre Rohstoffversorgung sicherstellen können, ist keine grundlegend neue Frage. Der Bedarf an metallischen Rohstoffen jedoch hat sich in den vergangenen Jahren stark erhöht – sie werden benötigt für die Energie- und die Mobilitätswende, zur Digitalisierung und in der Verteidigungsindustrie. Insbesondere deutsche und europäische Unternehmen sind stark von Importen aus Drittstaaten abhängig. Das liegt an den industriellen Strukturen, aber auch daran, dass nur wenig metallische Rohstoffe in der EU abgebaut und weiterverarbeitet werden.
Gleichzeitig gilt gerade der Rohstoffsektor als geopolitisch umkämpft. Zum einen nimmt China in den Lieferketten metallischer Rohstoffe eine bedeutsame Rolle ein. Durch Russlands Krieg gegen die Ukraine wurden deutsche und europäische Akteure – Regierungen wie Unternehmen – für die Risiken einseitiger Abhängigkeiten von autoritären Staaten sensibilisiert. China hat in der Vergangenheit wiederholt Exportbeschränkungen für Rohstoffe erlassen. Zum anderen hat sich generell der geopolitische Wettbewerb zwischen den Staaten um den Zugang zu Rohstoffen verstärkt.
Mittlerweile steht die Diversifizierung von Rohstofflieferketten weit oben auf der Agenda Deutschlands und der EU. Die politischen Maßnahmen, die hier bislang ergriffen wurden, gehen in die richtige Richtung. Doch reichen sie nicht aus, um sich in einem geopolitisch veränderten Umfeld behaupten zu können.
Hohe Abhängigkeiten von chinesischen Akteuren
Die Bedeutung globaler Rohstofflieferketten für geoökonomisches Handeln ergibt sich aus der dominanten Rolle chinesischer Akteure. Diese nehmen auf allen Stufen der Lieferketten von metallischen Rohstoffen eine zentrale Stellung ein. Vereinfacht sind es vier Stufen, in die sich Rohstofflieferketten einteilen lassen (vgl. Grafik 1, S. 58): der Abbau von Rohstoffen im industriellen oder handwerklichen Bergbau (Stufe 1), die Weiterverarbeitung der Erze in Schmelzen und Raffinerien (Stufe 2), die industrielle Verarbeitung von Rohstoffen (Stufe 3) und das Recycling (Stufe 4).
Die erste Stufe der Rohstofflieferkette – der Abbau – ist zwar zu großen Teilen in Staaten des globalen Südens angesiedelt, also in Afrika, Lateinamerika und Asien. Doch sind chinesische Akteure weltweit am Abbau beteiligt, Staatskonzerne ebenso wie private Firmen. Deutsche Unternehmen sind in diesem Bereich häufig eher mit der Exploration von Rohstoffen befasst – also der geographischen Erkundung von Vorkommen und der Einschätzung technischer Möglichkeiten, was eigentlich dem Stadium vor dem Abbau entspricht.1 Es gibt zwar deutsche Unternehmen, die Abbau betreiben, doch geschieht dies kaum im größeren Maße. Bedeutende Rohstoffkonzerne wie etwa Glencore, Anglo American oder Rio Tinto haben ihren Sitz außerhalb der EU.
Auf der zweiten Stufe hat sich China in den vergangenen 15 Jahren eine Spitzenposition erarbeitet. Laut Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) gehen 41 Prozent der globalen Schmelz- und Raffinadeproduktion auf chinesische Akteure zurück.2 Einige deutsche Konzerne verarbeiten Rohstoffe teilweise auch vor Ort weiter. Zudem gibt es deutsche Expertise im Bereich der Schmelz- und Raffinadeproduktion wie im Kupfersektor, wo der deutsche Anteil an der globalen Produktion bei 2,5 Prozent liegt.3 Das ändert aber nichts an der chinesischen Vormachtstellung in vielen Rohstofflieferketten. Für europäische Abnehmer ist die Volksrepublik dadurch zu einer Art Nadelöhr geworden.4
|
Quelle: entnommen aus: SWP-Studie 13/2022, S. 14; siehe <https://www.swp-berlin.org/publications/assets/ Studie/2022S13/images/2022S13_nachhaltige_rohstoffaussenpolitik_003.png>. |
Aus dieser Konzentration ergibt sich das Risiko einer Instrumentalisierung von Lieferketten durch China. Gefährdet sind dabei gerade deutsche und europäische Firmen, die zu großen Teilen auf der dritten Stufe der Wertschöpfungskette aktiv sind, also bei der industriellen Verarbeitung. Dies betrifft die wichtigsten Industriebranchen in Deutschland – wie den Automobilsektor, die chemische Industrie, den Maschinenbau sowie die Metall- und Elektroindustrie. Sie benötigen metallische Rohstoffe, die kaum noch in der EU abgebaut und weiterverarbeitet werden.
Europäische Koordinierung im Rohstoffsektor
Die EU hat die europäische Zusammenarbeit zur Rohstoffsicherung verstärkt. Bereits seit 2011 unterhält sie eine Liste kritischer Rohstoffe, die auf die EU Raw Materials Initiative aus dem Jahr 2008 zurückgeht. Sie basiert auf einer umfassenden Methodologie zur Bewertung von Kritikalität und fokussiert auf solche Rohstoffe, die für die Produktion in der EU besonders bedeutsam sind. Die Aufstellung wird alle drei Jahre aktualisiert. Während die erste Version der Liste noch elf Rohstoffe umfasste, ist sie bei der letzten Aktualisierung im Jahr 2023 auf insgesamt 34 Rohstoffe angewachsen.5 2020 hatte die EU zudem einen Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen veröffentlicht, um die Versorgungssicherheit im Rohstoffsektor zu erhöhen. Doch erst 2022 entstand im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine politischer Handlungsdruck. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) stellte im Januar 2023 das Eckpunktepapier »Wege zu einer nachhaltigen und resilienten Rohstoffversorgung« vor.6 Diese Strategie enthielt bereits die Zielsetzung einer verstärkten Abstimmung auf europäischer Ebene, für die Deutschland den Schulterschluss mit Italien und Frankreich suchte.7
Grafik 2
Quelle: EU-CRMA; entnommen aus: SWP-Aktuell 22/2024, S. 2; siehe <https://www.swp-berlin.org/publications/assets/ Aktuell/2024A22/images/2024A22_EU-Rohstoffpolitik_001.png>.
Im März 2023 stellte Brüssel dann mit dem Critical Raw Materials Act (CRMA) das europäische Rohstoffgesetz vor, mit dem die EU und ihre Mitgliedstaaten die Versorgung europäischer Unternehmen mit Rohstoffen sicherstellen wollen. Es ist das erste Mal, dass die EU die Rohstoffsicherung koordiniert und strategisch angeht, nachdem die Mitgliedstaaten sich zuvor jeweils nur um ihre eigene Versorgung gekümmert hatten. Der Europäischen Kommission kommt dabei eine bedeutsame Rolle zu. Sie leitet das sogenannte Critical Raw Materials Board, das sich aus Vertreterinnen und Vertretern der EU-Mitgliedstaaten zusammensetzt und die Umsetzung des CRMA verantwortet. Der CRMA richtet sich nicht auf alle 34 kritischen Rohstoffe, sondern auf die Untergruppe der strategischen Rohstoffe. Gemeint sind damit 17 Rohstoffe, die für die grüne Transformation, die Digitalisierung, die Rüstungs- und Verteidigungsindustrie sowie für die Raumfahrt eine zentrale Rolle spielen und in ihrer Verfügbarkeit durch wachsende geopolitische Konkurrenz besonders gefährdet sind. Für die Zeit bis 2030 hat sich die EU konkrete Ziele gesetzt. Zum einen sollen Abbau, Weiterverarbeitung und Recycling strategischer Rohstoffe in der EU verstärkt, zum anderen die entsprechenden Importquellen diversifiziert werden. Bis Anfang des nächsten Jahrzehnts sollen nicht mehr als 65 Prozent eines jeden der strategischen Rohstoffe aus Drittstaaten stammen.8
Die europäische Rohstoffstrategie: Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten
Die Umsetzung des CRMA geht allerdings mit einer Reihe von Herausforderungen einher, für welche die EU bisher noch keine zufriedenstellenden Antworten gefunden hat.
Wiederbelebung von Bergbau und Weiterverarbeitung sowie Erhöhung des Recyclings in der EU. Die Ziele im CRMA sind ambitioniert – das gilt für die konkreten Zielmargen ebenso wie für den zeitlichen Horizont. Die erste Herausforderung besteht darin, Abbau und Weiterverarbeitung der entsprechenden Rohstoffe in der EU zu steigern. Die Hürden für die Erschließung neuer Minen sind ohnehin hoch. Von der Exploration bis zur Eröffnung einer Abbaustätte kann es zwischen zehn und zwanzig Jahren dauern, zumal in einigen europäischen Staaten für solche Vorhaben hohe bürokratische Hürden sowie anspruchsvolle Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards bestehen.
Die EU will die Verfahren nun beschleunigen und die Umsetzung rascher voranbringen. Im März 2025 veröffentlichte die Kommission eine Liste strategischer Rohstoffprojekte in der EU, womit sie einer Zielsetzung aus dem CRMA entsprach. Auf dieser Liste stehen 47 Projekte in 13 EU-Staaten, für die sich das Critical Raw Materials Board unter mehr als 100 eingereichten Vorschlägen entschieden hat. Die ausgewählten Vorhaben decken 14 der 17 strategischen Rohstoffe ab. Ein zentraler Fokus liegt auf Rohstoffen für die Batterieherstellung.9
Die Zivilgesellschaft reagiert kritisch darauf, dass in der EU der Bergbau wiederbelebt wird.
Die EU will diese Projekte bei der Finanzierung und bei der Suche nach europäischen Abnehmern unterstützen. Zudem sollen die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden; sie sollen nicht länger als 27 Monate dauern. Hohe Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards will man bei der Umsetzung jedoch wahren.10 Dies wird auch notwendig sein, denn insbesondere die Wiederbelebung des Bergbaus in der EU wird von der Zivilgesellschaft kritisch betrachtet. In Spanien oder Portugal leisten betroffene Gemeinden schon massiven Widerstand gegen das Vorhaben, den Bergbau auszuweiten. Ähnliche Reaktionen sind in anderen Mitgliedstaaten zu erwarten.11
Auch die hochgesteckten Ziele beim Recycling bringen Herausforderungen mit sich. Bisher liegt die Recyclingrate für die 34 kritischen Rohstoffe der EU bei gerade einmal 8,3 Prozent,12 bei Seltenen Erden sogar bei nur einem Prozent.13 Recycling ist energieintensiv und daher oft sehr teuer, was insbesondere für komplexe Produkte gilt.14 Hinzu kommt, dass viele Erzeugnisse nicht so gebaut werden, dass sie sich gut recyceln lassen, oder dass nur wenige Angaben vorhanden sind, welche Rohstoffe darin überhaupt enthalten sind.15 Überdies werden viele relevante Produkte nach Gebrauch gar nicht gesammelt, oder sie gehen dann ins Ausland, so dass sie nicht in der EU recycelt werden.16 Die EU muss also auch hier massive Anstrengungen unternehmen, um die gesteckten Ziele zu erreichen.
Die außenpolitische Dimension. Auch die Zielsetzung des CRMA, die Lieferketten durch neue Partnerschaften mit Akteuren in anderen Weltregionen zu diversifizieren, bleibt für die EU eine Herausforderung. Während China schon lange ein fest etablierter Spieler in verschiedensten Ländern ist, hat sich der Konkurrenzdruck in den letzten Jahren weiter erhöht. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben ihren Fokus verschoben – weg von der Zentrierung auf fossile Rohstoffe hin zu einer Diversifizierung ihres Portfolios. Beide Golfstaaten haben zuletzt stärker in den Rohstoffsektor Afrikas und Lateinamerikas investiert, um ihren strategischen Einfluss auszubauen und profitable Projekte zu sichern.17
Bis zur Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus im Januar 2025 konnte sich die EU noch auf eine gemeinsame Koordinierung mit »like-minded states« im Rohstoffsektor und insbesondere auf eine unterstützende Rolle der USA verlassen. Washington hatte 2022 die Minerals Security Partnership (MSP) ins Leben gerufen. Unter ihrem Dach sollen folgende »gleichgesinnte Partner« im Rohstoffsektor kooperieren: Australien, Deutschland, EU, Finnland, Frankreich, Indien, Japan, Kanada, Schweden, Südkorea und Vereinigtes Königreich. Die MSP setzte vier Prioritäten – Diversifizierung und Stabilisierung von Lieferketten, Erhöhung von Investitionen, Förderung von ESG (Environment, Social, Governance)-Standards sowie Steigerung des Recyclings. Die Initiative wurde damit zu einem Paradebeispiel für die Strategie des »Friendshoring«.18 Unter Trump ist die Zukunft der MSP jedoch ungewiss, da seine wirtschaftlichen Drohungen gegen beteiligte Akteure wie Kanada, Australien oder die EU eine Zusammenarbeit in diesem Rahmen zunehmend unwahrscheinlich machen. Betroffene Staaten können auch außerhalb der MSP weiter zusammenarbeiten. Hierfür müssen sie allerdings neue Möglichkeiten finden, ohne Washington zu kooperieren, und diese mit interessierten Partnern ausloten.
Letzteres würde zugleich Spielräume eröffnen, um den Risiken einer einseitigen Fokussierung auf westliche Partner entgegenzuwirken und auf rohstoffreiche Länder im globalen Süden zuzugehen. Denn diese streben ebenfalls nach einer Diversifizierung ihrer Lieferbeziehungen, nicht zuletzt weil die starke Abhängigkeit von Rohstoffexporten nach China für sie zu einem ökonomischen Risiko geworden ist. Und sie formulieren das Ziel, stärker in globale Lieferketten integriert zu werden – weg von der einseitigen Rolle des Rohstofflieferanten, hin zum Aufbau der weiterverarbeitenden Industrie.
Es wird kaum möglich sein, über Jahrzehnte gewachsene Lieferketten umzulenken, ohne dass große Infrastrukturprojekte im Rohstoffsektor entsprechend flankiert werden. Dies bedeutet auch eine notwendige Verschiebung im Verhältnis zwischen Markt und Staat – zugunsten einer stärkeren Steuerung durch finanzielle Anreize. Auf europäischer Ebene fehlt bisher ein gemeinsamer Topf, um die Projekte im Ausland auch finanziell zu unterstützen. Verschiedene EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, haben zwar eigene Rohstofffonds aufgelegt; eine gute Koordination zwischen den jeweiligen Töpfen ist also wichtig. Theoretisch besteht zudem die Möglichkeit, die Global Gateway Initiative mehr für den Rohstoffsektor zu nutzen, was bisher kaum geschehen ist. Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen ihre Mittel jedoch erhöhen, um mit anderen finanzstarken Akteuren des Rohstoffsektors in Konkurrenz treten zu können. Hierzu sollte die European Investment Bank (EIB) noch intensiver eingebunden werden.
Einbindung der Wirtschaft. Die dritte Herausforderung besteht in der Schwierigkeit, die Wirtschaft in die Diversifizierungsbemühungen einzubinden. Hier liegt womöglich die eigentliche Achillesferse der EU. Nur wenige europäische Unternehmen haben bisher echte Anstrengungen unternommen, um ihre Lieferketten im Rohstoffsektor zu diversifizieren, wie aktuelle Studien zeigen.19 Nötig ist hier ein fundamentales Umdenken bei wirtschaftlichen Akteuren. Denn viele der geopolitischen Risiken sind längst sichtbar; und hier bestehen auch ökonomische Gefahren für die vom Rohstoffimport abhängigen Firmen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die hohen Abhängigkeiten von China. Versorgungsprobleme drohen etwa, sollte der sino-amerikanische Handelsstreit sich zuspitzen oder der Konflikt zwischen China und Taiwan eskalieren.20 Eine stärkere Diversifizierung sollte daher auch im Interesse der Wirtschaft sein. Hier geht es darum, das Verhältnis zwischen Markt und Staat neu zu justieren.
Die Politik steht vor der Herausforderung, stärker in Lieferketten einzugreifen, ohne die Marktmechanismen auszuhebeln.
Im Raum stehen dabei immer wieder Forderungen nach staatlicher Lagerhaltung von Rohstoffen. Doch solche Ansätze sind schwer zu realisieren. Nicht nur müssten Unternehmen sensible Informationen mit staatlichen Stellen teilen. Zudem wären Eingriffe in den Markt erforderlich, die eher zu Verknappungen führen und die Preise weiter in die Höhe treiben könnten, insbesondere wenn die Beschaffung europäisch organisiert würde.21 Nur bedingt hilfreich wäre es auch, Anreize für die unternehmerische Lagerhaltung zu schaffen, denn dies könnte ähnliche Preiseffekte auf den Märkten haben.22 Nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob es der öffentlichen Hand zuzumuten ist, Steuermittel für die Versorgung von Firmen einzusetzen, die sich selbst nicht um Diversifizierung bemühen – obwohl die geopolitischen Risiken bekannt sind.
Politische Akteure haben in der Vergangenheit vielfach auf die drohenden Gefahren hingewiesen, doch zeigt sich immer deutlicher, dass Freiwilligkeit ohne unmittelbaren Handlungsdruck nicht zum erwünschten Ergebnis führt. Daher steht die Politik nun vor der Herausforderung, stärker in die Steuerung von Rohstofflieferketten einzugreifen, ohne dabei die Marktmechanismen auszuhebeln. Vorsichtige Maßnahmen wie die Erhebung von Konzentrationszöllen sind bereits in der Diskussion;23 wie diese im Rohstoffsektor verhängt werden könnten, wurde bisher aber nicht konkretisiert. Eine weitere Möglichkeit wäre, Diversifizierungspflichten für Unternehmen einzuführen, um das de-risking der europäischen Wirtschaft aktiv zu fördern. Solche Pflichten müssten weitreichend genug sein, um Firmen, die dahingehend bislang untätig geblieben sind, zur Diversifizierung ihrer Lieferketten zu bewegen. Sie dürfen jedoch nicht so ambitioniert sein, dass europäische Unternehmen dadurch miteinander in Wettbewerb treten.24 Deutsche und europäische Akteure müssen hier eine Diskussion ohne ideologische Scheuklappen führen.
Insgesamt sollte die EU die Kooperation zwischen europäischen Unternehmen stärker unterstützen. Da es keine großen europäischen Rohstoffkonzerne gibt, ist die EU in ihren Partnerschaften darauf angewiesen, Unternehmen auf der zweiten und dritten Stufe der Lieferketten zusammenzubringen. Die betreffenden Firmen müssen bereit sein, die Weiterverarbeitung in anderen Ländern umzusetzen oder dort in Rohstoffprojekte zu investieren und langfristige Abnahmeverträge zu schließen. Auf dem Gassektor sind in diesem Sinne bereits gemeinsame europäische Ausschreibungen gelungen.25 Bisher gibt es jedoch weder in den Mitgliedstaaten noch auf europäischer Ebene Bemühungen, Unternehmen aus verschiedenen EU-Staaten dazu zu bewegen, dass sie gemeinsame Einkäufe oder Investitionen in rohstoffreichen Ländern tätigen. Letzteres ist aber notwendig, um die EU-Rohstoffpartnerschaften sowie andere Rohstoffkooperationen mit konkreten Angeboten zu untermauern. Hier sind größere politische Anstrengungen erforderlich, bei denen auch die nationalen sowie europäischen Wirtschafts- und Industrieverbände eine aktivere Rolle einnehmen müssen.
Weitere Politikempfehlungen
Die bisherigen Bemühungen der EU, die europäische Rohstoffversorgung zu sichern, gehen zwar in die richtige Richtung, reichen aktuell jedoch nicht aus. Nötig sind zusätzliche Schritte, zu denen die EU auch in der Lage ist. Abgesehen davon, dass weitere finanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen, bedarf es insbesondere eines stärkeren politischen Engagements, einer verbesserten europäischen Koordinierung und der Bereitschaft, an bestimmten Stellen gezielter einzugreifen. Eine sinnvolle Ergänzung wäre es, das Amt eines oder einer »europäischen Rohstoffbeauftragten« zu schaffen. Den Anstrengungen Europas ließe sich damit im Inland wie im Ausland ein Gesicht geben. Die Bundesregierung könnte sich auf europäischer Ebene für einen solchen Posten einsetzen.
Gleichzeitig sollten sich Deutschland und die EU davor hüten, das »Rennen um die Rohstoffe« weiter zu befördern. In diesem Sinne empfiehlt sich auch eine sensible Sprache. Immer häufiger wird in der Rohstoff-Community vom »Krieg« oder »Kampf« um die Rohstoffe gesprochen. Eine derartige Zuspitzung von Begrifflichkeiten ist unangemessen und angesichts des polarisierten geopolitischen Umfelds kontraproduktiv, zumal solche Narrative auch im Ausland wahrgenommen werden. Innerhalb der EU sind sie ebenfalls nicht geeignet, die Akzeptanz des Rohstoffabbaus zu erhöhen. Weitaus sinnvoller ist es, wenn deutsche und europäische Entscheidungsträger konkret benennen, an welcher Art von Kooperation sie interessiert sind – und wenn sie dabei attraktive Angebote an mögliche Handelspartner machen.
Agrar- und Ernährungspolitik: Geoökonomische Tradition und neue Prioritäten
Landwirtschaft und die sie betreffenden Politikbereiche waren immer schon wesentlich von geoökonomischen Aspekten bestimmt: So ist beispielsweise der Raumbezug ein Faktor, der der Produktion von Nahrungsmitteln immanent ist. Ein weiterer Faktor ist die Vulnerabilität, die bei der lebenswichtigen Versorgung mit Nahrung sowohl für Individuen wie für Länder auch ein politisches Ziel ist: Nahrungsversorgung ist ein zu schützendes Menschenrecht; damit kommt dem Staat als öffentlichem Akteur auch gegenüber Marktakteuren eine wichtige Rolle zu.
Markt, Macht und Raum: Tradition von starkem Staat und großem Technologieeinfluss
Der Einfluss des Raumes auf die Landwirtschaft ist ein klassischer Gegenstand wissenschaftlicher Analyse: Nach dem Thünen-Modell der Standorttheorie ordnet sich landwirtschaftliche Produktion in Ringen um ein Marktzentrum an;1 verderbliches Gemüse wird demnach eher marktnah angebaut, Weidehaltung findet dagegen marktfern statt. Standortfaktoren beeinflussen insofern auch Handelsflüsse, als Handel und Transport den Produktions- mit dem Verbrauchsort verbinden. Maritime Nahrungstransportwege, insbesondere wenn sie durch Meerengen verlaufen, sind anfällig für Störungen und Risiken, etwa infolge von Naturereignissen, Unfällen oder Konflikten. So machte der russische Angriff auf die Ukraine lange die Schwarzmeerpassage unpassierbar, die essentiell für die Getreideversorgung in Afrika ist.
Im Zuge von technologischem Fortschritt wurden die landwirtschaftliche Produktivität gesteigert und die Versorgungssicherheit verbessert, etwa durch Maschinen und chemische Düngemittel.2 In den 1960er Jahren ermöglichte die »Grüne Revolution«, die auch mit Entwicklungshilfe finanziert wurde, im globalen Süden Produktivitätssteigerungen durch Maschinen- und Bewässerungstechnik, neue Hochertragssorten, Dünger und Pestizide. Gleichzeitig resultierten hieraus aber auch Abhängigkeiten von entsprechenden Technologieunternehmen – etwa für Länder aus dem globalen Süden vom globalen Norden.3 Ein jüngeres Beispiel dafür, wie Technologie Landwirtschaft von natürlichen Standortfaktoren unabhängig machen kann, ist die Treibhausproduktion in Katar.4
Landwirtschaftliche Produktion ist auch Risiken ausgesetzt, die sich aus Marktversagen aufgrund öffentlicher Leistungen oder externer Effekte wie positiven (Haltung bedrohter Tierrassen) und negativen Nachhaltigkeitswirkungen (Nitratbelastung des Grundwassers) ergeben können. Da der Markt diese Wirkungen nicht unbedingt ausreichend zu regeln vermag, sind staatliche Interventionen wohlfahrtsrelevant. Ob sichere Ernährungsversorgung eine öffentliche Leistung oder privat durch den Markt zu gewährleisten ist, wird in vielen auch widersprüchlichen wissenschaftlichen Arbeiten untersucht. Schon Thomas Hobbes und Carl von Clausewitz sahen Nahrungsversorgung als Teil und Gebot politischer Sicherheit, die als klassisches öffentliches Gut Staatsaufgabe ist.5 Diesen Autoren zufolge lässt sich Nahrungsversorgung auch militärisch durch Kriege bewerkstelligen bzw. können Konflikte durch Aushungern des Gegners entschieden werden, was allerdings im Völkerrecht später als Kriegsverbrechen eingestuft wurde.6
Sichere Ernährungsversorgung ist als Menschenrecht im VN-Sozialpakt von 1966 völkerrechtlich verankert. Dies begründet staatliche Schutzpflichten, die sich auch auf Konfliktsituationen und den Schutz von Infrastruktur erstrecken, die dem Zugang zu Nahrungsmitteln dient.
Insgesamt spielt der Staat als Akteur in der Agrar- und Ernährungspolitik der meisten Länder eine zentrale Rolle. Marktakteure stehen zu ihm in Wechselbeziehung: Einerseits versuchen Interessenvertreter Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen. Andererseits ist der Staat auch bei der Erfüllung vieler seiner Aufgaben auf Private angewiesen. Dies zeigt sich etwa beim Schutz kritischer Infrastrukturen, zu denen viele Länder auch die Ernährungswirtschaft zählen. Hier verlangt der Staat privaten Akteuren Sicherheitspflichten ab, wie etwa die Pflicht, über Lagermengen zu berichten.7
Versorgungssicherheit als zentrales geoökonomisches Ziel der Agrar- und Ernährungspolitik
Versorgungssicherheit hat nach der Definition der Food and Agriculture Organization (FAO) vier unterschiedliche Dimensionen, die sämtlich geoökonomisches Handeln betreffen können: (1) Die physische Verfügbarkeit von Nahrung eines Landes, die auf Eigenproduktion, Importen, Reservehaltung oder Nahrungshilfen beruhen kann. (2) Der Zugang zu Nahrung, der sich logistisch durch geeignete Markt- und Transportstrukturen sowie ökonomisch durch entsprechende Preise und Einkommen sicherstellen lässt. (3) Physiologische Nutzbarkeit, die Energie- und Wasserversorgung als Voraussetzung für Nahrungsproduktion einbezieht. (4) Alle genannte Dimensionen sollen auf stabilem Niveau sein.8
Defensive Ziele: Absicherung gegen eigene Verwundbarkeit
Die Versorgung der Bevölkerung war immer wichtig für politische Eliten, nicht zuletzt für die Absicherung der eigenen Macht: Bereits vor und zu Beginn der Französischen Revolution kam es immer wieder wegen steigender Mehlpreise zu Unruhen. Auch der Arabische Frühling wurde von Protesten gegen hohe Nahrungsmittelpreise befeuert.9
Eine übliche Leitvorstellung vieler Regierungen ist daher, dass sich ihr Land selbst mit Nahrungsmitteln versorgen kann und möglichst unabhängig ist von Nahrungslieferungen anderer Länder.10 Damit steht die erste FAO-Dimension (physische Verfügbarkeit) im Fokus, wobei Importe und Nahrungshilfen ausgeklammert werden. Am Selbstversorgungsgrad (SVG) lässt sich die Verfügbarkeit ablesen als Anteil der im eigenen Land produzierten Nahrungsmittel am inländischen Verbrauch.11 In der EU liegt der SVG bei vielen Agrarerzeugnissen wie Getreide oder tierischen Produkten deutlich über 100 Prozent, so dass Überschüsse exportiert werden können. Demgegenüber sind die Werte bei pflanzlichen Ölen, Obst und Nüssen merklich geringer, hier besteht folglich Importbedarf.12
Noch markantere Versorgungsanfälligkeiten zeigen sich, wenn man nahrungsphysiologisch essentielle Komponenten wie Vitamine und Aminosäuren in den Blick nimmt: Die EU hat die Importe dieser Komponenten auf wenige Lieferanten aus wenigen Angebotsregionen konzentriert. Kommt es zu Störungen in Lieferketten oder auch in der Beziehung zu Zulieferländern, gibt es daher kaum Substitutionsmöglichkeiten. Gleiches gilt für Mischdünger, wohingegen die Herkunft spezialisierter Dünger, etwa phosphathaltiger Dünger, teils diversifizierter ist.13
Offensive Ziele: Politische Stabilisierung durch Versorgungssicherung in Drittstaaten
Nahrungshilfen werden oft explizit als Instrument zur politischen Stabilisierung verstanden, obgleich sich weder die Auslösung von Konflikten noch die Flucht aus Staaten, in denen es Konflikte gibt, eindeutig und allein auf Versorgungsprobleme zurückführen lassen.14 Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wurde Moskau dafür kritisiert, die gezielte Herbeiführung von Versorgungsproblemen als Kriegsstrategie zu nutzen (»weaponization«),15 indem russische Truppen landwirtschaftliche Produktionsmittel zerstörten, ukrainische Ernten beschlagnahmten und die Schwarzmeerpassage für Transporte unpassierbar machten. Zu politischen Konflikten mit Versorgungsbezug kam es auch infolge von Sanktionen: Nach humanitärem Völkerrecht sind Güter wie Medikamente und Nahrung von Sanktionen auszunehmen.16 Diese beeinträchtigen nicht nur die Versorgung der Bevölkerung des sanktionierten Staates selbst, sondern möglicherweise auch die globale Versorgung, wenn ein großer Agrarexporteur wie Russland als Folge von Sanktionen weniger Agrarprodukte zu liefern vermag. Russland warf dem Westen denn auch vor, dass er mit seiner Sanktionspolitik Hungerprobleme verursache.17 Sanktionen, deren Wirkungen und die Kommunikation über sie geraten hier ins Spannungsfeld gegenläufiger geoökonomischer Ziele des Westens und Russlands.
Auch die EU ist ein großer Agrarexporteur. Mit einem Anteil von 17 Prozent an der globalen Ausfuhr von Weizen lag sie 2023 knapp hinter Russland (20 Prozent) und Australien (18 Prozent). Ihre Abnehmer liegen dabei vor allem in Afrika, gefolgt von Saudi-Arabien.18 Nach dem russischen Angriff traten Konflikte auf zwischen dem europäischen Beitrag zur globalen Versorgung und Umweltschutzzielen. Eine aus Biodiversitätsgründen beschlossene, für den Bezug von Subventionen obligatorische Stilllegung landwirtschaftlicher Anbauflächen wurde ungeachtet ökologisch motivierter Kritik gestoppt.19 Im Interesse globaler Versorgungssicherung könne nicht auf Produktionsmengen verzichtet werden.
Manche geoökonomischen Wirkungen resultieren aus defensiven Versorgungszielen. So beschränken Argentinien, Indien und China zum Beispiel häufig ihre Exporte, um die heimische Versorgung sicherzustellen, was wiederum die Weltmarktpreise hochtreibt, zu Lasten importabhängiger Länder. Die in der Vergangenheit stark auf Produktionssteigerung ausgerichtete EU-Agrarpolitik führte zu Mengenüberschüssen, die zum Teil exportiert wurden und den internationalen Wettbewerb verzerrten. Handelspartner übten an dieser Praxis heftige Kritik. Solche indirekten Wirkungen versucht das WTO-Agrarabkommen von 1994 einzudämmen, indem es Reduktionspflichten für Zölle und Subventionen festschrieb und Vorgaben für deren marktneutrale Ausgestaltung machte.20
EU-Agrar- und Ernährungspolitik über die Zeit: Zurück zur alten Versorgungssicherheit
Zu den Zielen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) gehören seit den römischen Verträgen 1957 unter anderem eine sichere Versorgung der Bevölkerung zu angemessenen Verbraucherpreisen und die Steigerung landwirtschaftlicher Produktivität. Seit Ausbruch der Coronapandemie 2020 und verstärkt durch die russische Vollinvasion in die Ukraine 2022 gewinnt das in der EU bereits seit Beginn der europäischen Agrarpolitik wichtige Versorgungsziel wieder an Bedeutung, das zusehends auch durch sicherheitspolitische Ziele ergänzt wird (Tabelle 1).21
Agrar- und Ernährungspolitik sind immer schon geoökonomisch bestimmt und ausgerichtet.
Die geoökonomische Perspektive der Agrar- und Ernährungspolitik ist nicht neu, sie ist seit jeher durch geoökonomische Faktoren wie Raum, Technologie und Versorgungssicherung beeinflusst oder auf diese ausgerichtet. Es ist dabei nicht leicht, geoökonomische Wirkungen dieses Politikfelds eindeutig zu identifizieren: Ernährungs- und Agrarpolitik hat eben häufig auch unbeabsichtigte geoökonomische Nebeneffekte – etwa Versorgungsrisiken für Dritte als Folge von Exportbegrenzungen im Interesse der Versorgungssicherung.
Es zeigt sich aber generell im Zeitablauf eine Veränderung agrar- und ernährungspolitischer geoökonomischer Prioritäten. So verschob sich der Fokus mit der grünen Revolution etwa von der Technologie (1960er Jahre) zu Sicherheit, wie das aktuell in vielen Ländern und auch in der EU der Fall ist. Eine Analyse veränderter geoökonomischer Bedingungen, die dann möglicherweise neue und explizitere geoökonomische politische Strategien als bislang nach sich ziehen, verlangt dabei eine fallgenaue Betrachtung von Verwundbarkeiten. Denn diese unterscheiden sich bei einzelnen Produktgruppen oder Nahrungskomponenten und Ländern.
Geoökonomisches Handeln in der Globalen Gesundheitspolitik: Zur »Global Health Architecture 2.0« durch eine liberale Geoökonomie
Globale Gesundheitspolitik unter Druck
Globale Gesundheitspolitik umfasst alle öffentlichen und privaten Maßnahmen zur Bewältigung grenzüberschreitender gesundheitlicher Herausforderungen. Die multilaterale Zusammenarbeit in der globalen Gesundheitspolitik wird derzeit von überwiegend national definierten außen- und sicherheitspolitischen Interessen überlagert. Staaten instrumentalisieren gesundheitspolitische Initiativen, um ihren Einflussbereich auszuweiten. Strategien wie Impfstoffdiplomatie oder bilaterale Gesundheitskooperationen dienen nicht allein humanitären Zwecken, sondern immer häufiger als geoökonomisches Mittel.1
Diese machtpolitische Aufladung führt zu Spannungen zwischen defensiven Interessen und offensiven Zielsetzungen, ein Problem, dem sich auch Deutschland nicht entziehen kann. Einerseits gilt es, Lieferketten abzusichern, Vorsorge und Reaktionsfähigkeit zu stärken und Verwundbarkeiten zu reduzieren. Andererseits sollen global Standards gesetzt und wirtschaftliche Interessen behauptet werden. Die daraus resultierenden Zielkonflikte2 setzen Deutschland unter Druck, aus einzelnen Ansätzen3 eine kohärente Strategie zu entwickeln.
Dazu ist konzeptionelles Neudenken erforderlich. Leitend sollten zwei Ziele sein: erstens die Bevölkerung vor akuten und langfristigen Gesundheitsgefahren zu schützen, zweitens die Stabilität gesundheitsbezogener wirtschaftlicher Interessen sicherzustellen. Diese Ziele ließen sich auf zwei Wegen erreichen, nämlich entweder im nationalen Alleingang, welcher mit der Stabilisierung der globalen Gesundheitsarchitektur bricht, oder mit einer Zusammenarbeit, die globale Gesundheit neu ausbuchstabiert und partnerschaftlich stärkt.
Deutschland sollte gemäß seinem Selbstverständnis eine neue globale Gesundheitsarchitektur anstreben, eine »Global Health Architecture 2.0«, die auf partnerschaftlicher und horizontaler Zusammenarbeit (»Co-Development«) beruht.4 Hierbei würden Interventionen kontextsensitiv und gemeinsam mit betroffenen Gemeinschaften sowie im Austausch mit der Wissenschaft entwickelt. Investitionen würden dabei als Partnerschaften verstanden, die auf wechselseitigem Nutzen und Gleichrangigkeit basieren und Völkerrechtsnormen respektieren.
Entwicklungszusammenarbeit und medizinische Lieferketten als Hebel
Die internationale Entwicklungszusammenarbeit gerät verstärkt ins Blickfeld von Staaten, die sie mit geoökonomischen Ansätzen machtpolitisch zu instrumentalisieren versuchen. Das betrifft auch die globale Gesundheitspolitik, die eng mit dem Aufbau resilienter Systeme und der Bekämpfung von Krankheiten verbunden ist. Finanzielle Unterstützung wird häufig an politische oder wirtschaftliche Bedingungen geknüpft. Das strukturelle Machtgefälle erlaubt es Geberstaaten, Engagement als Druckmittel einzusetzen, etwa für Rohstoff- und Handelsabkommen, oder um Gefolgschaft einzufordern. So waren bis 2020 11 der 15 wichtigsten Handelspartner der USA einst Empfänger von US-Auslandshilfe, auch im Bereich Gesundheit.5
Augenfällig wurde die Instrumentalisierung vornehmlich in der Covid-19-Pandemie. China verfolgte eine Impfstoffdiplomatie, indem es im Rahmen der Health Silk Road wirtschaftliche Verknüpfungen gezielt ausbaute.6 Dazu gehört etwa der institutionelle Mitaufbau des Africa Center for Disease Prevention and Control. Russland intensivierte bilaterale Kooperationen im Gesundheitsbereich, zum Beispiel in Uganda. Gleichzeitig zogen sich westliche Akteure teilweise aus multilateralen Initiativen wie »Gavi, the Vaccine Alliance« zurück.7 Dies ist Ausdruck des wachsenden transaktionalen Verständnisses von globaler Gesundheit, bei dem kurzfristige nationale Interessen die langfristige globale Gesundheitssicherheit verdrängen, und begünstigt eine Vertiefung dieses Ansatzes.
Die geoökonomische Dimension der Gesundheitspolitik, die von einer Rückkehr von Macht auf den Markt8 geprägt ist, lässt sich speziell bei medizinischen Lieferketten gut beobachten. Staaten mit Kontrolle über Ausgangs- und Wirkstoffe oder Produktionskapazitäten nutzen offensichtlich diese Lieferketten (Markt) als außenpolitisches Druckmittel (Macht). Exportkontrollen verursachten Engpässe bei Schutzausrüstung und pharmazeutischen Wirkstoffen. Überaus verwundbar ist der Bereich Antibiotika, da die Produktion von Inhalts- und vor allem Ausgangsstoffen stark auf China konzentriert ist.9 Juristisch erscheint die Unterscheidung zwischen legitimen Schutzgründen und politischem Druck oft ambivalent. Völkerrechtlich, namentlich nach WTO-Recht, sind Handelsbeschränkungen nur zulässig, wenn sie notwendig sind und keine weniger restriktiven Alternativen bestehen. Forderungen nach vorteilhaften Handelsabkommen oder politischer Unterstützung sind kein akzeptabler Grund, unter anderem Exporte medizinischer Güter zu beschränken. Auf diese Weise würde das WTO-Recht grundsätzlich einer vermehrten geoökonomischen Nutzung dieser Maßnahmen entgegenwirken.
China verwendet marktbeherrschende Stellungen bei Antibiotika sowie bei Masken und Geräten als außenwirtschaftliches Instrument, um außen- und sicherheitspolitische Interessen durchzusetzen. Auch die USA ergreifen vermehrt außenwirtschaftliche Maßnahmen im Gesundheitssektor. Unter Verweis auf das Trittbrettfahren anderer Länder bei der Arzneimittelpreisgestaltung kündigte Washington an, Zölle einzuführen.10 Damit soll der Zugang zu Gesundheitsgütern durch Repatriierung von Produktion gewährleistet und die US-Gesundheitsindustrie gestärkt werden. Solche Maßnahmen setzten das regelbasierte WTO-System unter Druck.
Defensive und offensive Instrumente in der Gesundheitspolitik
Die EU und Deutschland haben Instrumente etabliert, um ihre Interessen zu schützen und ihre Ziele zu verfolgen. Als defensive Maßnahmen stehen die Rückverlagerung pharmazeutischer Produktionskapazitäten und der Aufbau strategischer Bevorratungssysteme im Vordergrund.11 Damit soll mehr Versorgungssicherheit gegenüber externen Schocks erzielt und politischen Einflussnahmen begegnet werden. Konkret fördert die EU den Ausbau lokaler Produktionsstätten für Arzneimittel und persönliche Schutzausrüstung. Mit Hilfe von Subventionen sollen kritische Kapazitäten erhalten bleiben und im Krisenfall rasch hochgefahren werden. Parallel wird eine koordinierte Bevorratung strategischer Güter wie Antibiotika, Schutzausrüstungen und Beatmungsgeräte aufgebaut, um zeitweilige Engpässe zu überbrücken.
Defensive gesundheitspolitische Maßnahmen stoßen an finanzielle und regulatorische Grenzen.
Diese Maßnahmen stoßen an finanzielle und regulatorische Grenzen, besonders bei Generika. Eine dauerhafte Subventionierung würde fiskalische Zwänge erzeugen und Kosten in ohnehin belasteten Gesundheitssystemen erhöhen. Höhere Lohnkosten wiederum können die Rentabilität von Generika gefährden. Bevorratung bietet nur begrenzte Sicherheit und birgt das Risiko von künstlichen Engpässen und Ineffizienzen, etwa durch Produkte, deren Verfallsdatum überschritten ist.12 Zusätzlich begrenzen externe Entwicklungen den Spielraum. Die USA verfolgen eine offensive Industriepolitik im Gesundheitsbereich mit Zöllen und Reindustrialisierungsanreizen, um inländische Kapazitäten zurückzugewinnen und die globale Preisgestaltung zu beeinflussen. Das stellt die europäische Gesundheitsindustrie vor Herausforderungen.13
Offensive Ziele lassen sich über institutionellen Kapazitätsaufbau, Technologietransfer und regulatorische Harmonisierung verfolgen. Beispielhaft ist die von der EU-Kommission geförderte Partnerschaft zwischen der Europäischen Arzneimittel-Agentur und der im Aufbau befindlichen African Medicines Agency. Diese soll sich bei der Zulassung neuer Arzneimittel auf Entscheidungen der Europäischen Arzneimittel-Agentur stützen. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet dies als »regulatory reliance«.14 Zur Unterstützung wurden im Jahr 2024 zehn Millionen Euro bereitgestellt, unter anderem für Schulungen durch das Paul-Ehrlich-Institut. Langfristig stärkt die Einbindung europäischer Standards regionale Strukturen und die Position Europas in der multilateralen Ordnung.
Risiken durch Fragmentierung und Potentiale strategischer Partnerschaften
Internationale Zusammenarbeit ist für Deutschland unverzichtbar, wenn es seine Ziele erreichen will. Dazu zählen der Schutz vor Pandemien und die Verringerung externer Abhängigkeiten in der medizinischen Versorgungskette. Die europäische Strategie der offenen strategischen Autonomie ist nicht als Rückzug aus dem Multilateralismus zu verstehen. Sie zielt darauf ab, Abhängigkeiten selektiv zu reduzieren und gleichzeitig innerhalb eines regelbasierten Systems handlungsfähig zu bleiben.
Die Entwicklungen in den USA offenbaren die geoökonomische Dimension gesundheitspolitischer Strategien. Zölle, Reindustrialisierungsanreize und Preisregulierung könnten den Druck auf transnationale Unternehmen erhöhen, von denen viele in Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten ansässig sind. Ohne flankierende Preisgestaltung drohen kurzfristige Preisanstiege bei patentgeschützten Arzneimitteln und bei Generika. Entgangene Einnahmen könnten in Drittstaaten kompensiert werden, was die Stabilität nationaler Gesundheitssysteme beeinträchtigen würde.
Diese externen Faktoren treffen auf eine institutionell fragmentierte europäische Gesundheitsgovernance. Handelspolitik wird auf EU-Ebene verhandelt,15 aber die Preispolitik für Arzneimittel ist Sache der Mitgliedstaaten. Der fragmentierte Markt erschwert kohärente Strategien und belastet Investitionsentscheidungen pharmazeutischer Unternehmen.
Handlungsempfehlungen für deutsche und europäische Politik
Um medizinische Lieferketten abzusichern, pandemische Vorsorge und Reaktionsfähigkeit zu stärken sowie gesundheitspolitische Ziele offensiv zu verfolgen, sollte Deutschland die Gestaltung einer resilienten und gerechten »Global Health Architecture 2.0« vorantreiben. Dafür ist ein integrierter Ansatz vonnöten, der globale Gesundheit, Geopolitik und Wirtschaft im Sinne einer liberalen Geoökonomie kohärent zusammendenkt.16 Anstelle kurzfristiger Zwangsmaßnahmen wie Handelsbeschränkungen für kritische Güter setzt liberales geoökonomisches Denken auf langfristige Kooperationsinstrumente, zum Beispiel auf Gesundheitspartnerschaften.
Ein Kernelement wäre die verstärkte horizontale Zusammenarbeit im Sinne von »Co-Development« mit Ländern niedrigen und mittleren Einkommens.17 Nachhaltigkeit, regionale Wertschöpfung und gegenseitiger Nutzen stünden im Zentrum. Die gezielte Förderung lokaler Generika-Produktion, etwa in Südafrika oder Nigeria, könnte Regionen stabilisieren und die Diversifizierung globaler Lieferketten voranbringen. Solche Partnerschaften erhöhen auch die Resilienz europäischer Gesundheitssysteme. Deutschland hat durch technische Beratung ohne direkte finanzielle Zuwendungen die Impfstoffproduktionskapazitäten in Afrika gestärkt. Regulatorische Zusammenarbeit hat dazu beigetragen, nationale Rahmenbedingungen zu reformieren, um Investitionen europäischer Pharmaunternehmen in Senegal, Südafrika und Äthiopien anzuregen.18 So wirkt Deutschland daran mit, die Gründung der African Medicines Agency zu beschleunigen. Ergänzend hat die Bundesregierung eine Spende von 600 Millionen Euro an Gavi angekündigt. Diese multilaterale Initiative kann Impfstoffe afrikanischer Hersteller zu angemessenen Preisen kaufen und auf dem Kontinent verteilen. Das Wachstum dieser Unternehmen verschafft den Ländern mehr Autonomie, um dauerhafte Bedarfe zu decken und in Gesundheitsnotfällen schneller reagieren zu können.
Deutschland und die EU sollten die Offensivmaßnahmen der USA im Gesundheitsbereich nicht kopieren.
Deutschland und die EU sollten die Offensivmaßnahmen der USA im Gesundheitsbereich nicht kopieren. Die unklare Rechtslage und potentiell destabilisierende Effekte machen solche Schritte riskant. Stattdessen sind vorausschauende Notfallpläne nötig. Dazu gehört die Prüfung defensiver regulatorischer Optionen wie gezielter Preiskontrollen für besonders betroffene Produkte. Ergänzend kommen temporäre Subventionen in Betracht, die Folgekosten abfedern, sofern Unternehmen Preisstabilität zusagen. Voraussetzung ist eine enge Abstimmung der Bundesregierung mit der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten darüber, ob und inwieweit solche Maßnahmen mit dem EU-Wettbewerbsrecht vereinbar sind.
Anstatt Produktion zu repatriieren und großflächige Bevorratung anzustreben, sollten globale Lieferketten durch strategische Partnerschaften weiter diversifiziert werden. Dieser Ansatz entspräche dem Prinzip des »Co-Development« innerhalb einer »Global Health Architecture 2.0«. Dadurch würde der gemeinsame Aufbau neuer Produktionskapazitäten mit jenen Ländern des globalen Südens ermöglicht, die Abhängigkeiten von Importen aus China reduzieren wollen. So ließe sich für mehr Resilienz auf beiden Seiten sorgen, und es entstünde ein eigenständiger europäischer Weg ohne Repatriierung und wirtschaftlichen Druck.19
Langfristig sollte die Bundesregierung – allen voran das Bundesministerium für Gesundheit, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und das Auswärtige Amt – Initiativen fördern, welche die multilaterale Gesundheitsarchitektur stärken. Dazu gehören ein substantieller Ausbau der Rolle Deutschlands in bestehenden Mechanismen wie Gavi und dem Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Deutschlands Expertise in pharmazeutischer Produktion und in Regulierungsprozessen böte hierfür eine belastbare Grundlage, um international glaubwürdig und strategisch Einfluss zu nehmen. Die konsistente Nutzung dieses Potentials trägt zu einer »Global Health Architecture 2.0« bei, die Souveränität, Solidarität und Resilienz verbindet.
Chinesische Geoökonomie im Weltraum: Militärische Interessen dominieren
Für die Volksrepublik China unter Xi Jinping ist der Weltraum von großer strategischer Bedeutung. Laut dem 2022 veröffentlichten Weltraum-Weißbuch soll das chinesische Raumfahrtprogramm zur wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung der Volksrepublik beitragen, die nationale Sicherheit mit gewährleisten, Interessen schützen und ganz allgemein Chinas »Stärke ausbauen«.1 Konkret strebt Peking mit dem Programm Fortschritte bei Innovationen, eine Modernisierung seines Militärs, einen Ausbau der Raumfahrtindustrie und eine Verstärkung der internationalen Kooperation in diesem Bereich an. Der anvisierte Aufstieg als Weltraummacht ist für Xi Jinping ein Meilenstein auf dem Weg zur Verwirklichung des »Chinesischen Traums«, den Großmachtstatus, den China bis 2049 »wiederherstellen« will. Xis »Weltraum-Traum« (hangtian meng) ist Teil dieses übergeordneten Ziels.2
Bereits bis 2045 soll die Volksrepublik zur führenden Weltraummacht (hangtian qianguo) aufsteigen. Dabei gilt es den momentan mächtigsten Player in dieser Sphäre zu überholen: die USA, deren Status sich neben der militärischen Dimension vor allem auf kommerzielle Erfolge privater Unternehmen gründet – ein Motiv, das für China im Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten überhaupt eine große Rolle spielt. Anders als in Europa, wo die Raumfahrt (und die dadurch erschlossenen Satellitendienste) meist keine strategische Priorität genießt, wird die Präsenz im All in China also als wesentliches Element einer Großmacht gesehen. Die Ambitionen des Landes als Weltraummacht lassen sich an den Etappenzielen ablesen, die im Weißbuch jeweils in den genannten Politikfeldern erreicht werden sollen. So will die Volksrepublik zum Beispiel Satelliten für den nachrichtendienstlichen Gebrauch und Antisatellitenraketen entwickeln, seine Raumstation Tiangong (»Himmelspalast«) weiter ausstatten und eine Raumsonde auf der erdabgewandten Seites des Mondes landen lassen. Zu den weiteren Meilensteinen zählen die Erweiterung der chinesischen Weltrauminfrastruktur, unter anderem durch eine Vermehrung der Bodenstationen, die Expansion der Raumfahrtindustrie (durch den Ausbau von Satellitenkommunikationsdiensten und des inzwischen in Betrieb genommenen Beidou-Navigationssatellitensystems sowie durch Kommerzialisierung) und die Ausdehnung eines Netzwerks aus internationalen Partnerschaften.
Diese Partnerschaften sind teilweise eingewoben in die Seidenstraßeninitiative (Belt and Road Initiative, BRI), jenes Projekt, mit dem China seine wirtschaftlichen und politischen Interessen global vorantreibt. Der chinesische Wissenschaftler Shi Yinhong sah in der BRI bereits 2015 ein Instrument, mit dem China den ersehnten Status einer strategischen Wirtschaftsmacht zu erreichen suche. Aus dieser Position heraus sei es dann in der Lage, seinen ökonomischen Einfluss politisch zu nutzen.3 Chinas Konnektivitäts- bzw. Infrastruktur-Initiativen, die inzwischen auch den Weltraum einschließen, sind Beispiele dafür, wie die chinesische Führung unter Xi Jinping Macht und Markt zusammendenkt.4 Hierbei ist das chinesische Ziel, eine Weltraummacht zu werden, dem größeren Ziel, Weltmacht zu sein, unterzuordnen. Neben dem Prestigegewinn erweitert die Präsenz im Weltraum auch Chinas militärische Fähigkeiten, die wiederum seinen Weltmachtstatus untermauern sollen.
Instrumente und politische Einbettung an der Schnittstelle Weltraum
Die BRI ist für China eines der Hauptinstrumente bei seinen Bemühungen, den Status einer Weltmacht zu erringen und Soft Power auszuüben. Die Schwerpunkte der BRI liegen auf dem Ausbau von Infrastruktur, der Erschließung neuer Märkte und der Verbesserung der Konnektivität. Die Digitale Seidenstraße (DSR) ist eine Komponente der BRI. Hier liegt der Fokus auf dem Ausbau der globalen digitalen Infrastruktur, zum Beispiel über die Verbreitung der 5G-Technologie, von Glasfaserkabeln, Satelliten-Bodenstationen und mobilen Zahlungsplattformen. Die auf diese Weise erhöhte Konnektivität ist eine Facette in Chinas Weltraumaktivitäten, weshalb die Ausweitung der Digitalen Seidenstraße ebenfalls Pekings Bemühungen zugeordnet werden kann, Weltraummacht zu werden. Am deutlichsten wird diese Verbindung durch eine weitere Komponente der Digitalen Seidenstraße: das Projekt des Space Information Corridor (SIC). Der SIC soll die Internet- und Telekommunikationsverbindungen zwischen den BRI-Partnerländern verstärken. Chinas wachsende Weltraumkapazitäten (Satelliten, Bodenstationen, Telekommunikationssysteme) sollen hier zum Tragen kommen.
Der Aufbau von Infrastrukturen, die Chinas Weltraumambitionen dienen, hat geopolitische Implikationen.
Der Aufbau von Infrastrukturen, die Chinas Weltraumambitionen dienen, wie die Errichtung von Bodenstationen (zum Beispiel im Iran 2015 und in Saudi-Arabien 2016), hat geopolitische Implikationen. Chinesische Bodenstationen im Ausland könnten nicht nur für zivile, sondern auch für militärische Zwecke genutzt werden, etwa für Spionage oder für das Sammeln von sensiblen Daten. Mit dem Aufbau einer Mega-Satellitenkonstellation für die Bereitstellung von Internetdiensten versucht China zudem, dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX die globale Führungsposition streitig zu machen, die die Firma mit ihrem Netzwerk Starlink wirtschaftlich wie auch politisch derzeit innehat.5
China nutzt die Partnerschaften, die es im Rahmen der BRI und der DSR geknüpft hat, auch, um die wirtschaftliche und (geo)politische Kooperation im Bereich Weltraum zu vertiefen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Afrika. Hier kann die Volksrepublik Pfadabhängigkeiten durch Infrastrukturen generieren, um so neue Märkte zu erschließen und Dienstleistungen in der Raumfahrt anzubieten.6
Räume für Chinas Raumfahrtaktivitäten: Schwerpunkt Afrika
Peking hat bereits mehr als zwanzig bilaterale Weltraumpartnerschaften mit afrikanischen Staaten abgeschlossen. Die entsprechenden Agreements sehen in der Regel Informationsaustausch vor, aber eben auch den Bau besagter Infrastrukturen in den jeweiligen Ländern.
Afrika bietet China bei dessen Ambitionen, eine Weltraummacht zu werden, geographisch wie auch wirtschaftlich eine geeignete Bühne: Manche Regionen am Äquator sind perfekte Standorte für Raketenstarts, da weniger Treibstoff benötigt wird, um in den Weltraum zu gelangen. In Dschibuti ist bereits ein chinesischer Weltraumbahnhof in Planung. Er soll 2027 fertig sein. Allerdings müssen vor der Inbetriebnahme noch einige rechtliche Hürden überwunden werden.7 Nach einer Nutzungsdauer von dreißig Jahren soll der Weltraumbahnhof vollständig in die Verwaltung Dschibutis übergehen.
Die von China gebauten Bodenstationen sind aus rechtlicher Perspektive ein anderes Unterfangen, da sie auch nach der Fertigstellung in chinesischer Hand bleiben und generell Intransparenz herrscht, welche Radardaten genau gesammelt und für welchen Zweck sie genutzt werden. Aus diesem Grund haben Drittländer wie Australien, Schweden und Chile bereits ihre Kooperation mit China beim Zugang zu ihren Bodenstationen gekündigt.8 In Namibia steht dagegen bereits seit 2001 eine von China betriebene Satellitensteuerungs- und ‑überwachungsstation, ein weiteres Zentrum wurde in Äthiopien gebaut.9 In manchen Fällen wurden die Technologien kostenlos überlassen – so erhielt Ägypten bereits einen Satelliten und ein Montagewerk.10
In Anbetracht der wachsenden Zahl von Satelliten im Weltraum und der fortschreitenden Integration von Satellitendiensten in das moderne Leben und die moderne Verteidigung sind Regierungen weltweit bestrebt, Weltraumfähigkeiten aus- und aufzubauen. China bietet vielen afrikanischen Staaten Zugang zu seinen Satellitenmärkten, chinesische Unternehmen können hier auf den schon bestehenden Netzwerken aufbauen. Firmen wie Huawei und ZTE haben bereits eine Vorreiterrolle beim Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur in Afrika eingenommen – Huawei hat bis zu 70 Prozent der 4G-Infrastruktur in Afrika errichtet.11
Mit der Bereitstellung der Infrastruktur und der daraus entstehenden technologischen Abhängigkeit bieten sich für China Optionen politischer Nutzbarmachung.12 So ergibt sich die Möglichkeit, den Informationsfluss zu beobachten, zu kontrollieren oder gar einzuschränken. Mit den beschriebenen wirtschaftlichen Projekten auf dem afrikanischen Kontinent erweitert die chinesische Führung somit ihren geoökonomischen Handlungsspielraum.
Für die Volksrepublik dürfte sich auch die Chance eröffnen, die finanziellen und machtpolitischen Lücken dort auszufüllen, wo der Rückzug der USA aus der Entwicklungszusammenarbeit ein Vakuum hinterlässt. Hier kann Peking eine Brücke bauen zu der Digitalen Seidenstraße und dem Space Information Corridor und anderen Staaten, die schnell wachsende Fähigkeiten im Weltraumsektor anbieten. Zwar stehen amerikanische Dienstleister wie der Marktführer Starlink theoretisch auch in afrikanischen Staaten bereit (es müssen lediglich Abkommen mit den noch nicht »angeschlossenen« Ländern getroffen werden), doch sind die Kosten für die Dienste auf individuelle Endverbraucher ausgelegt und vergleichsweise hoch.13
Chinesisches Weltraumprogramm setzt auf Macht statt auf Markt
Vom Staat initiierte Weltraumaktivitäten und kommerzielle Projekte sind in China aufgrund der besonderen Rolle, die staatseigene Unternehmen dort spielen, nicht klar voneinander zu trennen. Das Gleiche gilt für die Abgrenzung von zivilen und militärischen Zwecken. Die Raumfahrt und die Nutzung des Weltraums dienen schließlich in erster Linie Chinas militärischen Interessen, nämlich der Überwachung, Kommunikation, Aufklärung und möglicherweise der Stationierung von Waffensystemen im Orbit. Die Volksrepublik betrachtet den Weltraum – wie alle anderen politischen Handlungsfelder – aus einer zivil-militärischen Perspektive heraus. Einbezogen sind somit auch jene Infrastrukturprojekte, inklusive des SIC, die mit dem Weltraum in Verbindung stehen.
Die Raumfahrt und die Nutzung des Weltraums dienen in erster Linie Chinas militärischen Interessen.
Das Verhältnis von Macht und Markt, zwischen der wirtschaftlichen und machtpolitischen (geoökonomischen) Dimension der Weltraumprojekte, ist im Fall der Volksrepublik China immer auch im Kontext des Konzepts der »zivil-militärischen Fusion« zu sehen, das 2017 mit Gründung der Zentralkommission für integrierte militärische und zivile Entwicklung auch offiziell zur nationalen Strategie wurde. Bei der Analyse dieses Programms wird schnell deutlich, dass der militärischen Ebene die oberste Priorität zukommt: Die zivil-kommerziellen Sektoren müssen an die militärisch-verteidigungsindustriellen andocken. So soll sichergestellt werden, dass wissenschaftliche und technologische Innovationen gleichzeitig die militärische Entwicklung vorantreiben und – mit Blick auf den Weltraum – ein Transfer weltraumbezogener Technologien und Investitionen vom kommerziellen zum militärischen Sektor stattfindet.14
Das »Dual-Use-Dilemma« gilt in vielen Bereichen der Raumfahrt. So haben Satellitendienste oft intrinsisch neben dem zivilen auch einen militärischen Nutzen, ohne dass die Hardware des Satelliten geändert werden müsste. Auffälligerweise treten zum Beispiel chinesische Erdbeobachtungssatelliten, von denen vermutet wird, dass sie in erster Linie militärischen Zwecken dienen, vor allem im Indo-Pazifik gehäuft auf. Die von ihnen erhobenen Daten lassen sich zur Beobachtung von Parametern des Klimawandels, landwirtschaftlicher Entwicklungen und des Ausmaßes von Naturkatastrophen auswerten.15 Ebenso gut können sie aber auch Truppenbewegungen und die Stationierung mobiler Waffensysteme erkennen. Das US-Verteidigungsministerium spricht bereits davon, dass die Volksbefreiungsarmee »Space Superiority« (»Überlegenheit im Weltraum«) anstrebe, weil damit die Fähigkeit verbunden sei, die im Orbit etablierte Informationssphäre kontrollieren und Gegnern deren Nutzung verweigern zu können. China sei sich bewusst, dass dies eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg auf den Schauplätzen moderner informativer Kriegsführung ist.16 Dafür ist ein robustes Satellitennetzwerk notwendig, das militärischen Zwecken dient. Die zivile (wirtschaftliche) Nutzung des Weltraums ist diesem obersten Ziel untergeordnet.
Entsprechend stützt sich China bei der Entwicklung seiner Weltraumprogramme größtenteils auf staatliche Unternehmen; private Akteure spielen nur eine Nebenrolle. Die kommerziellen Aspekte der Weltraumaktivitäten sind für China gleichwohl bedeutend, denn durch den Aufbau einer profitorientierten Weltraumindustrie kann die Volksrepublik zum Beispiel die Kosten für Raumfahrtdienstleistungen senken, technologische Innovationen fördern und neue Arbeitsplätze schaffen. Daher hat China schon 2014 den Sektor der kommerziellen Raumfahrtindustrie für private Investitionen geöffnet.17 Dieser ist seither zwar gewachsen und hat einige wichtige Durchbrüche erzielt (z. B. bei Satellitenstarts),18 wegen der sicherheitspolitischen Sensibilität des chinesischen Weltraumprogramms bleiben privatwirtschaftliche Unternehmungen in diesem Bereich jedoch unter staatlicher Kontrolle und lediglich ein Anhängsel der staatlichen Raumfahrtindustrie.
Implikationen für Deutschland und Europa
Europäische Staaten, und auch die EU als zusehends autonomer Weltraumakteur, sollten sich vor allem auf zwei Maßnahmen fokussieren: Investitionen in eigene Fähigkeiten und die Initiierung von Partnerschaften auf transparenter Basis. Zum einen muss Europa den eigenen Handlungsspielraum erweitern und Abhängigkeiten von Nicht-EU-Ländern, wie etwa den USA, verringern, wo dies möglich ist. Es ist unumstritten, dass Staaten inzwischen extrem auf die Informationssphäre Weltraum und die durch Satelliten bereitgestellten Dienste angewiesen sind – zivil und wirtschaftlich, aber auch militärisch. So werden zum Beispiel zehn Prozent des Bruttosozialprodukts der EU durch Satellitennavigation überhaupt erst ermöglicht.19 Trotzdem galten weltraumgestützte Dienste in europäischen Hauptstädten lange eher als ein Nice-to-have statt als essentieller Service, für den Investitionen benötigt werden. Die Konsequenz ist, dass Europa im Orbit nur über verstreute Fähigkeiten verfügt, vergleichsweise geringe Investitionen in Raumfahrtaktivitäten getätigt hat und eine Strategie für den Weltraum nur im Ansatz vorweisen kann. Wie auch in anderen Verteidigungsbelangen galt oft die Devise, dass die USA die Fähigkeiten und die Prozesse zur Verfügung stellen werden. In einem extrem dynamisierten geopolitischen Umfeld, in dem vor allem die bestehende, auf dem Beistand der USA lastende Verteidigungsarchitektur in Europa in Frage gestellt wird, erweist sich nun, dass wichtige Investitionslücken geschlossen werden müssen. Der Draghi-Bericht von 2024 hat bereits darauf hingewiesen, dass in den letzten vierzig Jahren nur zwischen 15 und 20 Prozent der Summe in den europäischen Raumfahrtsektor investiert worden sind, die die USA in dieser Zeit aufgewendet haben.20 Daher wäre in erster Linie ein Informationsaustausch mit Drittstaaten von großem Nutzen. Dies könnte zudem eine Vertrauensbasis schaffen für eine zukünftige Vertiefung der Zusammenarbeit, wie zum Beispiel durch die Erweiterung der Weltraumkomponente des EU Government Gateway.21 Das grundlegende Problem in Europa ist, dass sich die EU selbst noch im Aufbau ihrer Fähigkeiten befindet und zum Teil nicht über genügend Expertise und finanzielle Mittel verfügt, um sich selbst autonom aufzustellen. Vor diesem Hintergrund ist es auch für die deutsche Bundesregierung unerlässlich, einen Plan zu erarbeiten, der deutlich macht, wo eigene Fähigkeiten aufgebaut werden können und wo noch Aufholbedarf besteht. Die angekündigte Weltraumsicherheitsstrategie ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.
In einem extrem dynamisierten geopolitischen Umfeld wird für den Weltraumakteur Europa nun klar, dass wichtige Investitionslücken geschlossen werden müssen.
Zudem sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten Pläne entwickeln, um Drittländern Kooperationen und Möglichkeiten zu bieten, sich als verantwortungsvoller Partner zu präsentieren. Eine Vertrauensbasis könnte dadurch geschaffen werden, dass die EU Satellitendienste bereitstellt und Datenströme aufbaut. Das vor kurzem gestartete Africa-EU Space Partnership-Programm ist hierbei ein wichtiger erster Anstoß. Das Projekt ist Teil der EU-Global-Gateway-Initiative und dient vor allem dem Kapazitätsaufbau, auch im Hinblick auf die gerade erst gegründete African Space Agency, die Intensivierung des EU-Afrika-Dialogs und eine Verstärkung der Kooperation mit dem dortigen Privatsektor.22 Gemessen an den umfangreichen Infrastrukturprojekten Chinas wirkt das Programm bescheiden. Dennoch bietet es der EU die Chance, sich als vertrauensvoller und verantwortungsbewusster Partner darzustellen.
Damit Drittländer zu einem späteren Zeitpunkt Teil von Infrastrukturprojekten werden können, müssten innerhalb der EU Transparenz, Mitbestimmungsrechte und gegebenenfalls Kreditstrukturen in einer Weise festgelegt werden, dass Europa nicht seine strategische Autonomie einbüßt. Zudem könnten europäische Staaten sich mehr bemühen, Drittstaaten auch diplomatisch stärker einzubeziehen: Innerhalb der Vereinten Nationen wird noch immer über Rüstungskontrolle und einen nachhaltigen Umgang mit dem Weltraum diskutiert. Vor allem Länder, die selbst nicht über eigene Weltraumsysteme verfügen, haben große Sorgen. Diese gelten zum Beispiel dem Weltraumschrott und den Risiken, die mit den Mega-Konstellationen verbunden sind. Im Zuge der Entwicklungen in diesem Bereich könnte der Orbit bald kein sicherer Raum mehr sein und sich nicht mehr nachhaltig gestalten lassen. Auf diese Sorgen gilt es unbedingt einzugehen, zum Beispiel indem sie in multilateralen Foren angesprochen werden, aber auch dadurch, dass kommerzielle Akteure ihr Verhalten ändern. Letzteres lässt sich wiederum am ehesten durch gesetzgeberisches Handeln der einzelstaatlichen Regierungen bewirken. Der Weltraumgesetzesentwurf der EU-Kommission, der den Akzent vor allem auf die Resilienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit von Weltraumaktivitäten legt, ist ein erster Meilenstein auf dem Weg dorthin.23 Die (noch) nicht im Weltraum präsenten Nationen mit einzubeziehen ist auch insofern wichtig, als deren Regierungen damit ein Platz am Tisch angeboten, ihren Sorgen Gehör verschafft und sie für ein verantwortungsvolles Verhalten im Weltraum gewonnen werden können24 – eine Verhaltensweise, für die China mit seinen intransparenten Manövern und Projekten nicht bekannt ist.
Digital- und Cyberpolitik: Das Streben der EU und Indiens nach digitaler Souveränität
Angesichts geopolitischer Spannungen in ihrer jeweiligen Nachbarschaft, fragiler Lieferketten und technologischer Wettbewerbsdynamiken wollen die EU und Indien ihre Resilienz stärken und Handlungsspielräume ausbauen. Seit den militärischen Zusammenstößen zwischen der indischen und der chinesischen Armee im Jahr 2020 rückt China als »systemischer Rivale« ins Zentrum von Risikobetrachtungen der EU und Indiens. Als geopolitischer Akteur, alternativer Produktionsstandort, wachsender Absatzmarkt und potentieller Partner erlangt Indien neue Relevanz für die Zusammenarbeit mit Europa. Beide Akteure investieren in vertrauenswürdige Infrastrukturen etwa bei 5G/6G-Spektrums-Lizenzen, in der Künstlichen Intelligenz (KI) und in der Cybersicherheit. In diesem Zusammenhang bietet Indien nicht nur einen großen Absatzmarkt, sondern auch ein wachsendes Technologie- und Innovationsökosystem. Dieses ist strategisch bedeutsam für die EU, da es ihr ermöglicht, ihre Bemühungen um die digitale und technologische Souveränität zu untermauern. Im Streben nach digitaler Souveränität ist Geoökonomie als Fortsetzung von Geopolitik mit anderen Mitteln zu verstehen.
Digitalpolitik beschäftigt sich mit der Gestaltung der digitalen Transformation von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat. Cyberpolitik konzentriert sich auf Sicherheit und Stabilität im digitalen Raum, besonders im Cyberspace. Im Zentrum beider Bereiche stehen Technologien wie KI, Cloud Computing, Blockchain, 5G oder das Internet of Things (IoT). Digitalpolitik schafft den Raum, in dem Innovation und Digitalisierung möglich werden. Cyberpolitik schützt diesen Raum, um Vertrauen und Sicherheit zu gewährleisten. Ohne Sicherheit (durch Cyberpolitik) keine nachhaltige Digitalisierung (durch Digitalpolitik) – und ohne digitale Innovation auch keine moderne Sicherheitspolitik. Indien wie die Europäische Union regulieren die Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen und sämtliche auf diesen aufbauenden Applikationen, um Souveränität zurückzugewinnen und ihren jeweiligen Schutzfunktionen nachzukommen.1
Für die EU und Indien gilt gleichermaßen, dass sich in den vergangenen Jahren ein grundlegender Zielkonflikt zwischen einer offeneren Wirtschaftspolitik einerseits und den Anforderungen an nationale Sicherheit bzw. an Binnenmarktschutz andererseits zugespitzt hat. Als Konsequenz stehen Bestrebungen für mehr Souveränität und strategische Entflechtung heute gestärkt da.2 Die Verfügbarkeit digitaler Technologien bildet dabei eine wichtige Machtressource für die sicherheits- und wirtschaftspolitische Handlungsfähigkeit der EU und Indiens.3 Dazu zählt vor allem der Zugang zu moderner Hardware (zum Beispiel zu Halbleiter-Chips sowie zur IT‑ und Netzwerkinfrastruktur) und Software (etwa zu digitalen Plattformen und Apps), aber auch die Kompetenz in Schlüsseltechnologien wie KI, Quantencomputing und Blockchain. Innovationen sowie die damit einhergehenden Fähigkeiten und Anwendungsbereiche befördern dabei stets den Bedarf an einem hohen Maß an Cybersicherheit. Diese Entwicklungen tragen dazu bei, dass Staaten digitale Technologien heute nicht nur als handelbare Waren und Dienstleistungen wahrnehmen, sondern immer häufiger auch als Macht- und Risikofaktoren.4
Seit vielen Jahren verfolgen die EU und Indien das politische Ziel, ihre technologische und digitale Souveränität zu stärken.5 Wesentliche exogene Treiber dabei sind Strukturbedingungen wie der sino-amerikanische Konflikt und regionale Konflikte in Asien und Europa. Doch die endogenen Treiber des Strebens der EU und Indiens nach digitaler Souveränität unterscheiden sich erheblich. Die EU setzt innereuropäisch auf (digitale) Binnenmarktvollendung. In ihren Außenbeziehungen will sie mit den handelspolitischen Ansätzen de-risking, re-shoring oder friend-shoring das allgemeine Ziel erreichen, essentielle Liefer- und Wertschöpfungsketten sowie Ressourcenzugänge zu diversifizieren, um die Stabilität des digitalen Binnenmarkts zu gewährleisten.6 Indien betreibt im Hinblick auf seine Rivalität mit China ebenfalls eine Politik des de-risking und re-shoring, um sich unabhängiger von seinem wichtigsten Lieferanten und zugleich größten Rivalen zu machen. Zudem versucht Indien sich als Profiteur von friend-shoring europäischer Staaten und der USA in Position zu bringen. In diesem Sinne verstehen wir die Geoökonomie hier als Fortsetzung von Geopolitik mit marktpolitischen Instrumenten.
Digitale Souveränität im Vergleich
Die EU und Indien eint zwar ihr Streben nach digitaler Souveränität. Aber das damit einhergehende Bemühen um mehr politische Kontrolle über den Markt äußert sich bei beiden Akteuren höchst unterschiedlich. Das betrifft sowohl die Legitimation von Marktregulierung als auch die Umsetzung politischer Entscheidungen.
Die EU misst digitaler Souveränität nicht erst seit Amtsantritt der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wachsende Bedeutung bei. Diese Zielsetzung stand bereits in den 2000er Jahren auf der digitalen Agenda, mit der sich die EU als globaler Akteur behaupten will. Um Wettbewerbsfähigkeit und Einfluss in Bezug auf digitale Infrastrukturen, Daten und Technologien zu sichern, verfolgt die EU faktisch ein Konzept des »strategischen Abhängigkeitsmanagements«7 gegenüber Drittstaatakteuren. Damit versucht sich die EU an einem schwierigen Spagat, nämlich der Regulierung zwischen der vertraglich verankerten Binnenmarktoffenheit im neoliberalen Verständnis auf der einen Seite und der autoritativen Kontrolle einer möglichen marktverzerrenden Monopolstellung einzelner Unternehmen auf der anderen. Gleichwohl war und ist die politische Ambition der »geopolitischen« Europäischen Kommission seit der Amtsübernahme Ursula von der Leyens gestiegen, wie in den Leitmotiven »offene strategische Autonomie« oder »digitale und technologische Souveränität« der amtierenden Kommission zum Ausdruck kommt.
Digitale und technologische Souveränität ist inzwischen auch ein Credo großer Industrieverbände in Europa.
Nach digitaler und technologischer Souveränität zu streben ist mittlerweile zu einem geflügelten Wort nicht nur der nationalen Industriepolitik, sondern auch der großen Industrieverbände in Europa geworden. Gestützt wird das Verständnis von digitaler Souveränität intern durch integrierte digitale Märkte und informationelle Grundrechte sowie Beteiligungsrechte für Bürger und extern mit der Setzung globaler Standards durch neue bilaterale und multilaterale Partnerschaften. Diese Dynamiken verstärken sich gegenseitig.8 Damit konstituiert sich die EU als relevante Regulierungsmacht gegenüber Marktakteuren aus Drittstaaten, indem sie ihre Attraktivität als Wirtschaftsmacht nutzt und die Bedingungen für den Zugang zum Binnenmarkt an europäische Normen knüpft – von Datenschutz über KI-Ethik bis Cybersicherheit.9
Die Grundprinzipien des EU-Binnenmarkts bilden das Fundament, auf dem Europas Streben nach digitaler Souveränität nach innen wie außen aufbaut. Vier zentrale Prinzipien sind hierbei relevant: Nichtdiskriminierung, gegenseitige Anerkennung, Direktwirkung des EU-Rechts und Sanktionsmechanismen zur Rechtsdurchsetzung.10 Diese Prinzipien stellen sicher, dass auch im digitalen Bereich einheitliche Spielregeln für alle Marktteilnehmer im Binnenmarkt gelten. Insofern gilt zunächst im Grundsatz eine Vendor-Neutralität, das heißt die Gleichbehandlung von Marktteilnehmern ungeachtet ihrer geopolitischen Interessen.
Die genannten Prinzipien wurden in der Vergangenheit während des transatlantischen Konflikts über Datenschutz und -sicherheit nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil, sie bildeten eine wesentliche Machtressource der EU gegenüber den USA, weil die großen US-Hyperscaler, also Cloudanbieter wie Google oder Amazon Web Service, auf den weltweit größten Binnenmarkt angewiesen sind. Sie betreiben skalierbare IT-Infrastrukturen und Dienste, die in Europa und weltweit besonders in den Bereichen Cloud Computing sowie Datenverarbeitung und ‑speicherung nutzbar sind. Umgekehrt sind sie nicht nur Infrastrukturanbieter, sondern im gleichen Maße auch Nutznießer, wenn sie an ihrem Geschäftsmodell festhalten wollen.11
Indien hingegen hat in der Digital- und Cyberpolitik nur wenige Regulierungsvorschriften erlassen. Die aktuell am schnellsten wachsende G20-Wirtschaft mit starken Software- und Outsourcing-Sektoren profitiert im großen Stil von freien Marktzugängen und sucht global Abnehmer für IT-Dienstleistungen. In allen Hardware-Bereichen und in der Entwicklung von KI begibt sich Indien in erhebliche Abhängigkeiten vor allem von China und den Vereinigten Staaten. Seit 2020 hat in Indien die Debatte über eine geoökonomische Wende Fahrt aufgenommen. Im Mai 2020 kam es an der chinesisch-indischen Grenze zu tödlichen Auseinandersetzungen, die einen seit 1962 bestehenden Grenzkonflikt neu entfachten. Die regionale Rivalität der beiden Staaten hat die Bedeutung der indischen Exekutive gestärkt. Diese sucht nun nach neuen Instrumenten, um die wirtschaftliche Abhängigkeit des Landes von China zu verringern und gleichzeitig die Cybersicherheit zu erhöhen. Nach den Zusammenstößen wurde die politische Forderung laut, erst müsse die Grenzfrage geklärt werden, bevor »normale« Handelsbeziehungen mit China möglich seien. Mit anderen Worten: Der geopolitische Konflikt dominiert und diktiert den geoökonomischen Handlungsspielraum. Diese Ereignisse hatten zur Folge, dass Indien eine intensivere Sicherheitskooperation mit vielen neueren Partnern anstrebte, allen voran den USA, Israel und Frankreich, um seine Verteidigungszusammenarbeit zu diversifizieren. Weiterhin bemüht sich Indien, seine strategischen Partner vor allem durch sicherheitspolitische Zusammenarbeit zu mehr Engagement in der indo-pazifischen Region zu motivieren.
In der Diskussion über Verwundbarkeiten durch einseitige Abhängigkeiten von Zulieferern besitzen digitale Technologien, die immer auch Dual-Use-Charakter haben, eine Schlüsselfunktion für die Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsräumen. Sowohl für Indien als auch für die EU impliziert das Bemühen um digitale und technologische Souveränität eine neue politische Balance zwischen Wirtschafts- und Sicherheitsanforderungen in den Bereichen Hardware, Software und Künstliche Intelligenz.12
Hardware
Ein globaler Mangel an Halbleiter-Chips in den Jahren 2020 und 2021 führte zu Produktionsstopps in Branchen von der Automobil- bis zur Medizintechnik und legte offen, wie abhängig Europa von wenigen außereuropäischen Halbleiter-Herstellerländern ist, etwa Taiwan, Südkorea, Japan, China und den USA. Deshalb wurde das Europäische Chip-Gesetz (European Chips Act) auf den Weg gebracht. Die Verordnung trat im September 2023 in Kraft und soll Europas Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz in der Halbleitertechnologie stärken. Der europäische Anteil an der weltweiten Chip-Produktion soll sich durch diese Initiative bis 2030 auf 20 Prozent verdoppeln – ein ambitioniertes Vorhaben angesichts eines europäischen Marktanteils von nur rund 10 Prozent im Jahr 2020. Hierfür sollen bis 2030 öffentliche und private Investitionen von über 43 Milliarden Euro mobilisiert werden, damit Forschungskapazitäten (im Zuge der »Chips for Europe«-Initiative) ausgebaut, neue Halbleiter-Fabriken in Europa errichtet sowie Lieferketten besser kontrolliert werden können.13 Mit dem Chip-Gesetz wurde zudem ein europäischer Halbleiter-Koordinationsmechanismus geschaffen, um Mitgliedstaaten und Industrie an einen Tisch zu bringen und im Krisenfall schnell gemeinsam reagieren zu können.
Neben Halbleitern umfasst die Hardware-Dimension auch die Telekommunikations- und Netzinfrastruktur. Schon 2019 haben die EU-Mitgliedstaaten mit Unterstützung der EU eine 5G-Toolbox erarbeitet, um Risiken infolge nicht vertrauenswürdiger Ausrüster zu minimieren – ein Balanceakt zwischen offenen Märkten und Sicherheitsinteressen. Denn der Ausschluss der chinesischen Unternehmen Huawei und ZTE von 5G/6G-Spektrums-Ausschreibungen in Mitgliedstaaten zeigt, dass das Prinzip der Nichtdiskriminierung (alle Anbieter dürfen prinzipiell liefern) durchaus mit den jeweiligen divergierenden Sicherheitsabwägungen der Mitgliedstaaten kollidieren kann.14 Die EU versucht dieses Problem durch transparente Kriterien wie etwa technische Prüfungen und Diversifizierung zu lösen, sodass Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Binnenmarktrecht ihre kritischen Netzwerkstrukturen absichern können.
Im Zuge des Grenzkonflikts mit China schloss Indien chinesische Konzerne von seiner 5G-Infrastruktur aus.
In Indien steht der politische Prozess im Zusammenhang mit der 5G-Infrastruktur paradigmatisch dafür, dass Macht und Markt in der Digital- und Cyberpolitik neu gedacht werden. Hier waren die chinesischen Anbieter Huawei und ZTE für den Bieterprozess zunächst noch zugelassen. Weil aber der sicherheitspolitische Konflikt mit Peking anhielt, wuchs die Kritik an einer möglichen Beteiligung chinesischer Konzerne. Befürchtet wurden vor allem neue Cybersicherheits- und Abhängigkeitsrisiken.15 Im Kontext der militärischen Eskalation im Grenzkonflikt mit China beschloss der Sicherheitsrat des indischen Kabinetts im Jahr 2020 schließlich strengere Auflagen für den Erwerb von Telekommunikationsausrüstung.16 Diese Maßnahme war ausschlaggebend dafür, dass das Department of Telecommunications des indischen Ministeriums für Informations- und Kommunikationstechnologien die Anbieter als unbedenklich einstufen musste, bevor sie an den finalen Spektrums-Ausschreibungen teilnehmen konnten.17 Von den bietenden Firmen wurden lediglich Huawei und ZTE nicht freigegeben, womit die Telecom Regulatory Authority of India die chinesischen Anbieter nicht für den Netzausbau zulassen konnte. Der Prozess, der zu dieser Entscheidung führte, offenbart die starke Stellung der Exekutive. Zum einen hat sie allein die rechtlichen Normen initiiert, zum anderen besitzt sie die alleinige Zuständigkeit, zu entscheiden, welche chinesischen Anbieter aus dem indischen 5G-Netz ausgeschlossen werden.
Auch in der Halbleiterindustrie versucht Indien eigene Kapazitäten aufzubauen und verstetigt dabei besonders sein Streben nach digitaler Souveränität gegenüber Peking. Neu-Delhi beschloss 2021 die India Semiconductor Mission, mit der die Regierung den Bau heimischer Forschungs- und Produktionsstätten fördert.18 Außenpolitisch fungieren hier vor allem Taiwan und die Vereinigten Staaten als wichtigste Partner. 2023 unterzeichneten die Vereinigten Staaten und Indien ein Memorandum of Understanding (MoU) über eine Partnerschaft zur Lieferkette bei Halbleitern (Semiconductor Supply Chain and Innovation Partnership).19 In der Folge entschieden sich führende amerikanische Firmen wie Micron Technology, Lam Research und Applied Materials dafür, in den indischen Markt zu investieren.20 Auch in Taiwan konnte Indien zuletzt erfolgreich Investitionen einwerben. Während das US-Unternehmen Foxconn bisher lediglich sein Interesse bekundete, schloss die taiwanesische Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) bereits ein Joint Venture mit Tata Electronics für die Herstellung von KI-Chips in Indien.21 Während öffentlich eine Entkopplung (de‑coupling) von China beschworen wird, bleiben strukturelle Abhängigkeiten bei Rohstoffen und Komponenten bestehen.
Software
Große Online-Plattformen, Cloud-Anbieter und datengetriebene Dienste prägen zunehmend Märkte und Gesellschaft in der EU. Aufgrund ihrer marktdominierenden Stellung nehmen sie sogenannte Gatekeeper-Positionen im Binnenmarkt ein, die durch Amplifizierung (Verstärkung der Wirkungsmechanismen) und Microtargeting (gezielte Werbung und Beeinflussung von Konsumenten) tief in die demokratischen Prozesse von Gesellschaften eingreifen. Die EU nutzt ihr Wettbewerbs- und Kartellrecht, um die integrationspolitischen Anforderungen des Binnenmarkts gegenüber allen Marktteilnehmern geltend zu machen. So geraten die großen Gatekeeper in der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur in den Fokus der EU-Regulierungsanforderungen.22 Vor allem US-Konzerne sowie in bestimmten Bereichen chinesische Anbieter und wenige europäische Softwareunternehmen wie SAP dominieren diesen Markt. Die EU sieht sich herausgefordert, einen eigenen Weg zu finden, der Innovation fördert, aber auch europäische Werte verteidigt, wie freien Wettbewerb, Datenschutz und Verbraucherschutz. Der gewählte Regulierungsansatz ist in erster Linie integrationspolitisch im Sinne der Binnenmarktprinzipien motiviert.
Der Digital Markets Act (DMA) und der Digital Services Act sind zentrale Rechtsakte der EU-Digitalstrategie.23 Mit dem DMA hat der Rat 2022 strenge Vorgaben für sogenannte Gatekeeper-Plattformen erlassen (zum Beispiel bestimmte Online-Marktplätze, App-Stores und Suchmaschinen), um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Diese mächtigen Akteure dürfen fortan etwa eigene Dienste nicht unlauter bevorzugen oder Konkurrenten nicht den Zugang verwehren. Beide Rechtsakte untermauern die Binnenmarktprinzipien: gegenseitige Anerkennung (einheitliche Regeln in der gesamten EU), Nichtdiskriminierung (gleiche Pflichten für alle großen Player, gleichgültig welcher Herkunft) und Sanktionierbarkeit (Androhung hoher Bußgelder bei Verstößen). Diese Plattformregeln stellen sicher, dass europäische Firmen faire Marktchancen haben und Nutzer vor Missbrauch geschützt werden. Aus einer geoökonomischen Perspektive, in der wirtschaftliche Abhängigkeiten auch als Sicherheitsrisiko erscheinen, dient die strikte Regulierung unter anderem dazu, die Dominanz von Tech-Giganten in anderen europäischen Lebensbereichen einzudämmen. Demnach bedeutet digitale Souveränität nach Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union eben auch, dass im europäischen Gesetzgebungsprozess digitale Räume nicht gemäß den Geschäftsbedingungen einiger weniger Konzerne, sondern nach demokratisch legitimierten Regeln unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft gestaltet werden sollen.
In Indien umfasst das Streben nach digitaler Souveränität auch Software und Internetplattformen, die möglichst unabhängig von China sind. Die indische Exekutive folgt der Logik nationaler Sicherheit, um eine Präsenz chinesischer Softwareunternehmen auf dem heimischen Markt zu erschweren. Das Verbot von über 200 chinesischen Apps im Sommer 2020 steht exemplarisch für das indische Regierungshandeln im Nachgang zu den militärischen Grenzauseinandersetzungen der beiden Staaten.24 Vor allem die Verbote von TikTok und WeChat sind als politische Botschaften einzuordnen, stehen sie doch für den Erfolg Chinas in der globalen Plattformwirtschaft.25 Zu den verbotenen Apps zählen Produkte großer und wichtiger Digitaldienstleister wie Alipay, dem ebenfalls aus Gründen der »Souveränität und territorialen Integrität […], der Verteidigungsfähigkeit […], der Sicherheit des Staates und der Öffentlichen Ordnung« die Lizenz entzogen wurde. Indien sperrte auch 2025 wieder chinesische Apps und signalisiert damit heimischen Konsumenten und der Regierung in Peking, dass chinesische Software als nicht vertrauenswürdig betrachtet wird. Diese Maßnahmen unterscheiden sich insofern von vergangenen Reaktionen Indiens gegenüber China, als sie weniger protektionistisch und eher sicherheitspolitisch motiviert sind.
Künstliche Intelligenz
KI gilt als eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Hier haben die USA und China aktuell einen großen Vorsprung vor der EU.26 Europa verfolgt in der geopolitischen Konkurrenz eine Doppelstrategie: Es will innovative KI-Entwicklung fördern und gleichzeitig klare Regeln etablieren, damit KI im Einklang mit europäischen Werten eingesetzt wird. Dabei sieht die EU sich mit der Kritik konfrontiert, die europäische KI-Regulierung könne den KI-Innovationen in Europa abträglich sein. Andere argumentieren hingegen, dass durch diese spezialisierten Insellösungen Marktführer in den Bereichen Gesundheit und Umwelttechnik geschaffen werden können.27
Die EU »exportiert« ihre Vorstellungen von ethischer KI: Transparenz, Nichtdiskriminierung und menschliche Kontrolle.
Mit der KI-Verordnung (AI Act) hat die EU im Jahr 2024 den weltweit ersten umfassenden Rechtsrahmen geschaffen, um diese (potentiell) disruptive Technologie zu regulieren. Dieses Gesetzespaket ist risikobasiert aufgebaut: Je nach Einsatzgebiet der KI gelten abgestufte Anforderungen. KI, die mit unvertretbaren Risiken behaftet ist (etwa KI-Systeme zur sozialen Bewertung von Menschen durch den Staat oder manipulative Verfahren, die Menschen schweren Schaden zufügen können), wird EU-weit verboten.
Seit 2023 positioniert sich Europa durch die inklusiven Politikformulierungsprozesse der EU zum AI Act nicht nur nach innen, sondern auch als globaler Normensetzer nach außen.28 Von Beginn an hat die EU dabei ihre ethischen Anforderungen an die KI (human-centered AI) in die entsprechenden bilateralen und multilateralen Dialoge in den Vereinten Nationen, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) und im Europarat eingebracht. Auf diese Weise konnte sie die globalen Normenbildungsprozesse prägen. Während in anderen Wirtschaftsräumen noch diskutiert wird, hat die EU mit ihrer frühzeitigen Initiative Fakten geschaffen, denn globale Unternehmen werden ihre KI-Produkte an den EU-Standards ausrichten müssen, wenn sie 450 Millionen potentielle Verbraucher nicht ausschließen wollen. So »exportiert« die EU ihre Vorstellungen von ethischer KI – nämlich Transparenz, Nichtdiskriminierung und menschliche Kontrolle – in andere Regionen. Das verschafft ihr Soft Power und Einfluss in der globalen Technologie-Governance.
Parallel zur Gesetzgebung hat die EU-Kommission Initiativen wie das AI Innovation Package und Testumgebungen (Sandboxes) für KI etabliert, um die Entwicklung und Umsetzung vertrauenswürdiger KI zu fördern. Ziel ist, »Trustworthy AI made in Europe« zu einem Gütesiegel für Produktsicherheit zu machen. Strenge Regulierung in einem großen Markt (zum Beispiel Kalifornien) bewirkt, dass Unternehmen weltweit höhere Standards übernehmen, um weiterhin Marktzugang zu haben (California-Effekt). Insofern ist anzunehmen, dass die höheren KI-Produktstandards mit einem Wettbewerbsvorteil einhergehen, weil Nutzer und Firmen KI-Lösungen bevorzugen, denen sie vertrauen können. Das frühzeitige Agenda-Setting der EU war vor allem von den Anforderungen der Grundrechtecharta und vom Primärrecht motiviert, nicht in erster Linie ökonomisch. Denn vor wenigen Jahren konnten in Europa allenfalls generative KI-gestützte Sprachmodelle, sogenannte Large Language Models (LLM) wie etwa LLAMA und Mistral, auf dem Markt Fuß fassen. Die DeepL-Übersetzungsdienstleistung ist hierfür ein gutes Beispiel.
Indien kann in der KI-Entwicklung zwar ebenso wenig wie die EU mit den globalen Schwergewichten USA und China mithalten. Doch immerhin ist es in den vergangenen Jahren zum zweitgrößten Herkunftsland von Open-Source-Modellen gleich hinter den Vereinigten Staaten avanciert. Trotzdem konnte bisher keine indische Firma ein LLM erstellen, das beispielsweise mit ChatGPT oder DeepSeek hätte konkurrieren können.29 Mit der India AI Mission von Anfang 2025 entschied sich die Regierung, ein nationales Programm in die Wege zu leiten, um Indien zu einer führenden Nation in der Entwicklung und Anwendung Künstlicher Intelligenz zu machen.30 Erklärtes Ziel ist es, eigene Modelle zu konzipieren und unabhängig von LLMs anderer Staaten zu werden, allen voran jenen Chinas. Doch mit nur etwa einer Milliarde US-Dollar Investitionen in seine KI-Forschung und -Entwicklung droht Indien in Zukunft noch weiter hinter seinen Erzrivalen China zurückzufallen, der eigenen Aussagen zufolge 137 Milliarden US-Dollar investiert haben soll.31 Im Februar 2025 untersagte das indische Finanzministerium seinen Mitarbeitenden zudem, ChatGPT und DeepSeek zu verwenden.32 Über diese Maßnahme hinaus ist Indiens Umgang mit KI bisher nur implizit als geoökonomisch zu deuten. Eher ist er als Navigieren der digitalen Souveränität zu verstehen. Dabei möchte das Land auch seine Partnerschaften mit westlichen Staaten weiter ausdifferenzieren. So richtete es gemeinsam mit dem engen Partner Frankreich im Februar 2025 einen internationalen KI-Gipfel aus und einigte sich zuletzt mit Ländern wie den Vereinigten Staaten und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf eine engere Kooperation. Indien ist hier vor allem an sicheren Lieferketten und ausländischen Direktinvestitionen interessiert.
Ausblick
Die EU und Indien eint die Gewissheit, dass sie relevante Standorte zur Produktion von Hochtechnologie bleiben können, indem sie zusammen ihre digitalpolitische Standortpolitik durch bilateral abgestimmte Arbeitsmarkt- und Wachstumspotentiale voranbringen. Sowohl Indien als auch die EU verstehen ihr Streben nach digitaler Autonomie bzw. digitaler Souveränität als Konzept dafür, ihre jeweilige Wirtschafts- und Marktmacht im geopolitischen Wettbewerb zu steigern.
Der größte Unterschied liegt in ihren divergierenden sicherheitspolitisch begründeten Risikoeinschätzungen. Im Falle Indiens ist das staatliche Eingreifen in den Markt stärker vom Bedürfnis nach nationaler Sicherheit motiviert. Der Markt soll in dieser Logik präventiv gelenkt werden, um aus neuen Unsicherheiten gar nicht erst neue Volatilitäten für die digitale Wirtschaft und den Handel entstehen zu lassen.
Die EU hingegen versucht mit ihrem ökonomisch motivierten de-risking ex post einseitige Abhängigkeiten bei wichtigen Ressourcen und Lieferketten zu diversifizieren, um bereits bestehende Vulnerabilitäten für den Binnenmarkt zu verringern. Es geht also im Kern darum, Marktbedingungen nach den vertraglich festgelegten konstitutiven Binnenmarktprinzipien zu optimieren. Große Gesetzespakete wie der Digitale Kompass 2030, einzelne Rechtsakte wie der European Chips Act, der Digital Markets Act und der AI Act sowie die zahlreichen Toolboxen untermauern den Anspruch der EU, zu einer weltweit führenden »humanzentrierten« Digitalwirtschaft aufzusteigen.33
Ein zentrales Forum für bilaterale Absprachen zwischen der EU und Indien ist der 2023 ins Leben gerufene EU-India Trade and Technology Council (TTC). Im Februar 2025 vereinbarten beide Seiten konkrete Kooperationen, um interoperablere digitale Infrastrukturen zu schaffen und die gegenseitige Anerkennung elektronischer Signaturen für grenzüberschreitende digitale Transaktionen zu ermöglichen.34 In den Bereichen Halbleiterentwicklung und Telekommunikation wollen die EU und Indien bei der Chip-Design-Forschung zusammenarbeiten. Darüber hinaus wurde ein Kooperationsabkommen zwischen der European 6G Smart Networks and Services Association und der indischen Bharat 6G Alliance geschlossen.
Die Kooperationsprojekte verdeutlichen, wie technologische Innovationen und Forschung im Sinne eines strategischen Abhängigkeitsmanagements dort forciert werden, wo sich die EU und Indien im Hinblick auf die wachsende strategische Rivalität zwischen den USA und China eigene Wettbewerbsvorteile erarbeiten können, ohne sich dabei für die eine oder die andere Seite entscheiden zu müssen. Zwar unterscheiden sich die digitalpolitischen Ausgangsbedingungen – hier die liberale prinzipiengebundene Binnenmarktlogik der EU, dort die geopolitisch ausgerichtete ambitionierte Digital- und Cyberpolitik Indiens. Dennoch können die gemeinsamen Initiativen zu den sicherheits- und vertrauensbildenden Normensetzungsprozessen in den Vereinten Nationen ein wichtiger Baustein zur Erhaltung der multilateralen Institutionen sein.35
Währungsmachtpolitik in der Welt der Dollar-Dominanz: China, die EU und die digitalen Zentralbankwährungen
Als Ziel und Aufgabe von Geld- und Währungspolitik gilt gemeinhin, den inneren und äußeren Geldwert zu sichern sowie – in einem weiter gefassten Verständnis – makroökonomische Stabilität zu fördern. Erfahrungen aus der Vergangenheit haben die Mehrheit der G20- und OECD-Staaten dazu veranlasst, die Unabhängigkeit der Zentralbank verfassungsrechtlich zu verankern, um so die Geldpolitik vor politischer Einflussnahme zu schützen. Anders als aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht mitunter suggeriert wird, ist Geld- und Währungspolitik aber keine exklusive technokratische Domäne. Tatsächlich besitzen Geld und Währung über ihre ökonomischen Funktionen hinaus1 eine politische und auch außenpolitische Dimension. Geldemission, Geld- und Währungsordnung sind sowohl wirtschaftliche als auch eminent geoökonomische Angelegenheiten.2 Dies gilt insbesondere, wenn eine nationale Währung jenseits der Landesgrenzen nachgefragt und etwa für Zahlungen, Investitionen oder Reservehaltung genutzt wird. Eine breite internationale Verwendung einer Währung eröffnet der Regierung des Emissionslands geoökonomische Handlungs- und Gestaltungsmacht.
Aktuell der wichtigste Trend im internationalen Finanzsystem ist dessen rasante Digitalisierung. In diesem Zusammenhang bietet die liberale Geoökonomie, die konzeptionell auf technologischem Fortschritt, digitaler Vernetzung und transnationaler Interdependenz beruht, eine theoretische Grundlage für die Analyse der globalen Rolle des Geldes.3 Mit dem geoökonomisch motivierten Einsatz einer dominanten Währung auf den internationalen Märkten wird Währungspolitik zur Währungsmachtpolitik.4 Beispiele von Währungsmachtpolitik sind unter anderem die Ausnutzung außerordentlicher Finanzierungsvorteile, die Stabilisierung von befreundeten Staaten in Krisenzeiten (oder die gezielte Destabilisierung gegnerischer Staaten im Konfliktfall) und der Einsatz von Finanzsanktionen (gegenüber staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren).5
Die globale Währungsordnung wird von Regeln, Konventionen, Institutionen und dem faktischen Geschehen auf den internationalen Finanzmärkten konstituiert und geprägt. Auffällig ist eine ausgeprägte Dollar-Dominanz.6 Allerdings nimmt das Gewicht der Vereinigten Staaten im Welthandel und in der Weltwirtschaft im langfristigen Trend ab, zumal Zweifel an der Verlässlichkeit der US-amerikanischen Geld- und Währungspolitik wachsen. US-Regierungen haben die Dollar-Dominanz immer wieder offensiv für geopolitische Zwecke genutzt.7 Drittländer sind gegenüber der US-amerikanischen Währungsmachtpolitik verwundbar. Dies gilt selbst für die EU und China, obgleich beide ihrerseits mit dem Euro und dem Renminbi (RMB) über internationalisierte Währungen verfügen, ohne dass diese aber eine dem Dollar vergleichbare Position einnehmen würden. Eine Reaktion dieser Akteure, die hauptsächlich auf geoökonomischen Motiven basiert, ist das Projekt des digitalen Zentralbankgelds (DZBG, Central Bank Digital Currency). Das Hauptziel dieser Initiativen besteht darin, die eigene Währungshoheit durch den Einsatz von Technologie zu stärken und zu steigern.8
Vor diesem Hintergrund wirft dieser Beitrag einen vergleichenden Blick auf Grundlagen, Ziele und Instrumente der Währungsmachtpolitiken Europas und Chinas, deren Währungen als internationale Zahlungs- und Reservevehikel zunehmend mit dem Dollar konkurrieren. Welche Unterschiede, Zwänge und Handlungsspielräume lassen sich in der Geldpolitik Chinas und der EU identifizieren und wie wirkt sich das jeweilige Verhältnis zwischen Finanzmärkten und staatlicher Macht auf die Währungsmachtpolitik Europas und Chinas aus? Wie sieht die Politik der aktiven Währungsunterstützung am Beispiel des DZBG-Projekts aus?
China und die EU als währungsmachtpolitische Akteure
In der internationalen Währungsordnung lassen sich die einzelnen Währungen nach der Häufigkeit ihrer Verwendung (im Zahlungsverkehr, zur Wertaufbewahrung, als Referenzmaßstab) abstufen. Innerhalb der sich daraus ergebenden Währungshierarchie sind die Positionen des Euro und des RMB unterschiedlich. Der Euro ist die zweitwichtigste Währung der Welt nach dem US-Dollar. Im Vergleich zu diesen beiden Währungen ist der Verwendungs- und Wirkungskreis des RMB überschaubar. Am Ende des ersten Quartals 2025 besaß der US-Dollar trotz Verlusten immer noch einen Anteil von 57,74 Prozent an allen globalen Devisenreserven, der Euro war mit 20,06 Prozent vertreten und der RMB kam auf 2,12 Prozent.9 Auch im Handel, bei Devisentransaktionen oder bei der Emission von Schuldtiteln ist die Dominanz des Dollars nach wie vor stark. Der Euro nimmt hier einen stabilen zweiten Platz ein, während auf den RMB nur ein sehr kleiner Anteil an diesen Geschäften entfällt.10
Die Position des Euro ist seit vielen Jahren relativ unverändert. Der RMB hingegen befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs.
Ein gemeinsames Merkmal des RMB und des Euro ist, dass es sich um Währungen handelt, deren internationale Verwendung regional begrenzt ist. Allerdings gibt es große Unterschiede, was die Entwicklung ihrer Bedeutung in der internationalen Währungshierarchie betrifft. Die Position des Euro ist seit vielen Jahren relativ unverändert.11 Der RMB hingegen befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs, insbesondere als Währung für Handelsgeschäfte.
Auch institutionell und politisch sind die beiden Währungsräume, also das Gebiet, innerhalb dessen Euro und Renminbi als Zahlungsmittel zirkulieren, strukturell sehr unterschiedlich. China ist ein zentralistischer, auf den System- und Machterhalt der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) ausgerichteter Staat, während die EU als Akteur mit wenig zentralisierter politischer Macht aus 27 souveränen Staaten besteht, von denen erst 20 Teil der Währungsunion sind. Entsprechend unterschiedlich stellt sich die jeweilige Währungsmachtpolitik dar. Während China klar geopolitische Ambitionen hat und darauf ausgerichtete wirtschafts- und währungsmachtpolitische Ziele verfolgt, wirken sich im Falle Europas die politische Vielfalt und die Vielzahl der Wachstumsmodelle negativ auf die Möglichkeit aus, eine kohärente Politik zur stärkeren Internationalisierung des Euro zu formulieren und umzusetzen.12 Eine weitere Schwierigkeit ist die große Anzahl der Akteure in der EU, die an dem Prozess beteiligt sind, und ihre Unterscheidung in supranationale, zwischenstaatliche oder staatliche Player.
Abgesehen von den Initiativen der Europäischen Kommission zur Stärkung der internationalen Rolle des Euro bleibt die EU-Politik in dieser Hinsicht daher passiv.13 Der Grund dafür ist, dass Kosten und Gewinne aus der Internationalisierung der gemeinsamen Währung innerhalb einer Währungsunion ungleichmäßig verteilt wären. Die Haltung Deutschlands als größtem Mitglied war dabei von erheblicher Bedeutung. Schon in der Frühzeit der Gemeinschaftswährung gab es Befürchtungen, dass der Euro als Nebeneffekt einer zunehmenden internationalen Verwendung aufgewertet werden könnte, was deutsche Exporte verteuern würde.14 Außerdem impliziert die zunehmende internationale Bedeutung der Währung auch die Notwendigkeit, die Zentralbank an Stabilisierungsmaßnahmen zu beteiligen.15
Demgegenüber fördern Chinas währungspolitische Hauptakteure aktiv die Internationalisierung des RMB.16 Die Motive der Volksrepublik sind vielfältig. Die Möglichkeit, im Ausland Einkäufe, Zahlungen und Investitionen in RMB zu tätigen, dafür Kredite in RMB aufzunehmen oder Anleihen zu begeben, würde Chinas Bürgern, Unternehmen und Körperschaften erhebliche Kosten und Risiken ersparen, insbesondere Währungsrisiken. Der Druck und die Belastung, staatlicherseits Währungsreserven halten zu müssen (und die dabei entstehenden Vermögensrisiken zu tragen), ließen sich mindern. Potentiell könnte die chinesische Volkswirtschaft an makroökonomischer Stabilität und fiskalischer Resilienz hinzugewinnen und Geldschöpfungserträge (Seigniorage) im Ausland generieren. Geoökonomisch eröffnet die RMB-Internationalisierung China die Möglichkeit, seine geld- und finanzpolitische Souveränität (defensiv) zu sichern bzw. auszubauen und vorhandene Verwundbarkeiten gegenüber den USA abzubauen. Offensiv strebt Peking danach, seinerseits im internationalen Finanz- und Währungssystem den eigenen Handlungs- und Gestaltungsspielraum (zu Lasten des Westens) auszuweiten und das globale System in einer Weise umzugestalten, dass es kompatibler mit den Strukturen des chinesischen Einparteienstaats wird. Dabei sind Geld und Währung seit Gründung der Volksrepublik Kernelemente von Politik und politischer Macht. Die eigene Währung, der Renminbi – das »Geld des Volkes« –, ist ein Eckpfeiler der staatlichen Souveränität, der Identität und des Nationalismus Chinas. Die People’s Bank of China (PBoC), die als Zentralbank die Währungspolitik verantwortet, ist der KPCh und deren Ideologie verpflichtet.17
Allerdings wäre eine konsequente Internationalisierung des RMB für die politische Führung mit ökonomischen Kosten und politischen Risiken verbunden. Kritisch wäre insbesondere die Liberalisierung des Kapitalverkehrs. Denn die vollständige Konvertibilität des RMB ginge mit erheblichen, politisch kaum akzeptablen Risiken für die innere Stabilität der Volksrepublik einher. Angesichts der Blasenbildung im Immobiliensektor und der Vielzahl notleidender Unternehmen und überschuldeter kommunaler Körperschaften sind Krisenszenarien vorstellbar, in denen Chinas finanz- und währungspolitische Hauptakteure infolge von Kapitalflucht die Kontrolle über die Wechselkurse und die Finanzmärkte verlieren. Die Legitimation der KPCh als Sachwalter von Stabilität und Wohlstand stünde in Frage. Aus politischen Gründen unterbleibt daher der entscheidende Schritt zur Konvertibilität. Infolgedessen spielt der RMB auf den Weltfinanz- und Währungsmärkten nicht die Rolle, die dem wirtschaftlichen Gewicht Chinas angemessen wäre.
Im Vergleich zur chinesischen Währung ist der Euro konvertibel und operiert in einem Umfeld, das durch ein hohes Maß an Rechtsstaatlichkeit und Markttransparenz gekennzeichnet ist. Trotz der Existenz eines hochgradig integrierten Binnenmarkts sind die Kapitalmärkte, die für die internationale Rolle der Währung von zentraler Bedeutung sind, stark zersplittert. Obwohl die Europäische Kommission spätestens seit 2015 mit ihrer Ankündigung, eine Kapitalmarktunion voranzubringen, intensive Anstrengungen zur Integration dieses Sektors unternommen hat, sind die Fortschritte in diesem Bereich gering.18 Das Gleiche gilt für den Markt für grenzüberschreitende Zahlungen, wo seit vielen Jahren versucht wird, die Abhängigkeit von US-Unternehmen zu verringern. Diese Fälle zeigen, wie schwierig es für die EU mit ihren fragmentierten Entscheidungsprozessen ist, eine Politik umzusetzen, die im Einklang mit der Marktlogik steht. Denn würde man dieser folgen, so stünden mit einem stärker integrierten Kapitalmarkt potentiell enorme Vorteile in Aussicht, zum Beispiel durch niedrigere Kosten für die Beschaffung von Privatkapital für Investitionen oder die Verzinsung von Schulden. Die politischen Kosten für die Überwindung der Interessen nationaler Regierungen und Wirtschaftsakteure sowie rechtlicher und sprachlicher Barrieren erweisen sich als zu hoch. Dabei würde eine engere Integration des Finanzmarkts in der EU den europäischen Finanzinstituten helfen, eine wichtigere Rolle in der Weltwirtschaft zu spielen. In einer EU-Kapitalmarktunion könnten sich die europäischen Banken und Finanzinstitute konsolidieren, im globalen Wettbewerb besser positionieren und der Anfechtung ihrer Stellung durch Plattformen oder Kryptowährungen leichter widerstehen.
Tabelle 1 (S. 94) zeigt zusammenfassend (und teilweise ergänzend) die wesentlichen Aspekte der Währungsmachtpolitik Chinas und der EU im Vergleich.
Digitales Zentralbankgeld als neues Feld der Währungsmachtpolitik
Der Prozess der Digitalisierung hat einen enormen Einfluss auf die Gestaltung der internationalen Finanz- und Wirtschaftsbeziehungen. Er manifestiert sich in der Entwicklung von digitalen Finanzdienstleistungen und -innovationen wie Kryptowährungen, Stablecoins und digitalen Zentralbankwährungen. Die Schaffung digitaler Währungen durch Zentralbanken wird durch geoökonomische Faktoren angetrieben, zu denen vor allem das Bestreben gehört, die eigene Souveränität im Währungsbereich zu stärken.19 Die Entwicklung digitaler Währungen und der dazugehörigen Infrastruktur in Europa und China ist eine Reaktion auf das gestiegene Bewusstsein der Abhängigkeit vom US‑Dollar in einer Zeit, in der die USA ihre Macht auf den Märkten weiter ausbauen. Aus Sicht der staatlichen Währungsbehörden ist der größte Vorteil des DZBG, dass dieses als Instrument zur Kontrolle über die Emission, Steuerung und Regulierung des eigenen Währungssystems fungieren kann. Diese Souveränität wird zunehmend bedroht, unter anderem durch private Akteure, die Zahlungsplattformen, Kryptowährungen oder Stablecoins kreieren.20
Geoökonomische Faktoren treiben die Schaffung digitaler Währungen durch Zentralbanken an.
Digitales Zentralbankgeld hat das Potential für eine technologische und wirtschaftspolitische Revolution im Bereich der Währungspolitik. Moderne Technologien machen es nicht nur möglich, Zahlungen grenzüberschreitend und über große Entfernungen hinweg in Echtzeit sicher abzuwickeln, sondern durch die Verwendung von Technologien, die der Blockchain ähneln, Geld auch zu programmieren. Auf diese Weise könnten Überweisungen hypothetisch an Bedingungen oder bestimmte Kaufzwecke geknüpft oder regional oder zeitlich begrenzt werden.
Das wäre auch eine Revolution im Hinblick auf die Effizienz des Steuersystems und das Arsenal der Instrumente zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Traditionelle Währungen sind häufig eng an einen bestimmten geographischen Raum gebunden. Auch der Euro und der RMB sind Zahlungsmittel mit einer starken regionalen Konzentration. Ihre DZBG-Variante schafft neue Möglichkeiten für Expansion und Wettbewerb im digitalen Raum. Zwischen China und Europa gibt es jedoch erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Ambitionen und des Entwicklungsstands ihrer digitalen Währungsprojekte.
China und die EU verfolgen aktiv Projekte zur Emission von DZBG, die sich in verschiedenen Stadien befinden. Interessanterweise wurde in den USA nach der Wahl Donald Trumps ein anderer Weg eingeschlagen.21 Mit dem »Genius Act of 2025« hat sich die republikanische Mehrheit entschieden, auf die Entwicklung von Stablecoins zu setzen, die in den traditionellen Finanzmarkt integriert werden.22 Dass sich die USA auf Kosten der Finanzstabilität auf ein möglichst schnelles Wachstum des heimischen Stablecoin-Marktes fokussieren, verlagert nicht nur das Potential für Regulierungskonflikte zwischen der EU und den USA in den Bereich der digitalen Währungen, sondern gefährdet auch die Währungshoheit der EU und potentiell deren Finanzstabilität.23 Ein Zusammenbruch amerikanischer Stablecoins dürfte zwar weniger Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben als auf die europäische; es ist jedoch nicht auszuschließen, dass ein solches Geschehen indirekt auch negative Folgen in China zeitigen würde, beispielsweise in Hongkong.
Vorerst werden die Ambitionen des digitalen Euro-Projekts in Europa durch die Vorgaben stark eingeschränkt, dass Einlagen in den digitalen Euro auf rund 3.000 Euro pro Person begrenzt und die Möglichkeit, ihn zu programmieren, ausgeschlossen worden sind. Im Vergleich zu China sind die Fortschritte auf dem Weg zu einer digitalen Zentralbankwährung noch sehr überschaubar (Grafik 1, S. 96). Die PBoC hatte schon 2014 mit der Arbeit am DZBG begonnen und hat inzwischen reichlich praktisches Erfahrungswissen im digitalen RMB-Zahlungsverkehr akkumuliert.
Ausblick: Der digitale Währungsraum als Schauplatz geoökonomischen Handelns
Augenscheinlich befindet sich die globale Währungsordnung in einem tiefgreifenden Wandel. Die rasante Digitalisierung des Finanzsektors und die wachsende Skepsis gegenüber dem US-Dollar eröffnen ein neues Feld für geoökonomisches Handeln.
Die rasante Digitalisierung des Finanzsektors und die wachsende Skepsis gegenüber dem US-Dollar eröffnen ein neues Feld für geoökonomisches Handeln.
Die Dominanz des US-Dollars wird durch die abnehmende Bedeutung der Vereinigten Staaten auf den internationalen Gütermärkten und das schwindende Vertrauen in die amerikanische Wirtschafts- und vor allem Fiskalpolitik in Frage gestellt. Es ist ungewiss, ob der Dollar und die US-Finanzpolitik auch in einer künftigen Finanzkrise eine stabilisierende Rolle spielen werden. Die rasche Entwicklung von an den Dollar gekoppelten Stablecoins könnte das Standing des Dollars zwar stärken, birgt jedoch auch das Risiko einer Finanzkrise, die das Vertrauen in die US-Währung und die damit verbundenen Vermögenswerte weiter untergraben würde. Vorerst bleibt der US-Dollar aufgrund der Trägheit der Märkte und des Mangels an glaubwürdigen Alternativen die dominierende Währung. Allerdings wird die Vormachtstellung des Dollars im Zuge der abnehmenden Bedeutung Amerikas auf den internationalen Märkten und des schwindenden Vertrauens in die US-Währung, in die Wirtschaftspolitik der Trump-Administration und vor allem in die Schuldentragfähigkeit der USA ausgehöhlt.
Der Euro und der RMB haben aber aufgrund ihrer Schwächen – das Fehlen eines integrierten europäischen Kapitalmarkts und die nicht vollständige Konvertierbarkeit des RMB – kaum Möglichkeiten, ihre Rolle als Investitions- und Anlagemedium auszubauen. Die Spielräume für eine aktive Währungsmachtpolitik bleiben daher begrenzt. Für Europa und China sind weder die derzeit bestehenden Finanzierungsvorteile Amerikas erreichbar noch können Euro und RMB als verfügbare Vehikel für grenzüberschreitende Finanztransaktionen geopolitisch wirksam eingesetzt werden. Für Europa und China kann es vorerst nur darum gehen, ihre strategische Autonomie in Währungsfragen auszubauen, bestehende Verwundbarkeiten zu mindern und ihre internationale Position zu stärken.
Die für die Währungspolitik verantwortlichen Entscheidungsträger weltweit stehen vor einer doppelten Herausforderung: Zum einen müssen sie auf die abnehmende Dollar-Dominanz reagieren, zum anderen ihre Souveränität angesichts der wachsenden Popularität privater Zahlungsplattformen und des Aufstiegs privat emittierter Währungen wahren. Dies stellt insbesondere eine Herausforderung für die EU dar, deren Wirtschaft viel offener ist als die Chinas. Der EU-Binnenmarkt profitiert von Finanzinnovationen, ist aber auch deren negativen Auswirkungen ausgesetzt. Diese erfordern Regulierungsmaßnahmen. In diesem Zusammenhang sollte die EU folgende Prioritäten setzen: Datenschutz, Glaubwürdigkeit als Regulierungsbehörde und Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Offenheit. Insbesondere die Bedeutung, die dem Schutz personenbezogener Daten beigemessen wird, kann der EU einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Demgegenüber dürfte China den digitalen Yuan wahrscheinlich als Instrument zur Kontrolle, Überwachung und Unterdrückung der eigenen Bevölkerung einsetzen. Vor allem aber soll der digitale RMB Chinas Handlungsmöglichkeiten in der Fiskal- und Geldpolitik erweitern, dem Land international eine außen- und industriepolitische Führungsrolle beim Aufbau digitaler grenzüberschreitender Zahlungssysteme einbringen und Handlungsoptionen gegen künftige westliche Finanzsanktionen schaffen.
Zu beachten ist auch, dass eine Stärkung der staatlichen Währungssouveränität nur im Einklang mit den Erwartungen der globalen Finanzmärkte erfolgen kann. Diese gehen nicht nur von der vollen Konvertierbarkeit einer Währung aus, sondern blicken auch darauf, ob es effiziente Marktinstitutionen, liquide Kapitalinstrumente und Möglichkeiten gibt, Risiken auf der Grundlage eines angemessenen Zugangs zu Informationen zu bewerten. Geld – und währungspolitische Maßnahmen, die der Marktlogik zuwiderlaufen, können nur eine begrenzte Wirkung auf die Erhöhung der Relevanz einer Währung in der Weltwirtschaft haben. Daher dürften auch künftig die beschränkte Konvertierbarkeit einer größeren Rolle des RMB, der fragmentierte Kapitalmarkt und die Barrieren des Binnenmarkts einer größeren Rolle des Euro Grenzen setzen.
Welchen Rang der Euro und der RMB in der internationalen Währungshierarchie einnehmen wird und – davon abgeleitet – welche Fähigkeiten zum Ausüben von Währungsmachtpolitik mit diesen beiden Währungen verbunden sein werden, wird letztlich davon abhängen, inwieweit es Europa und China gelingt, die oben genannten strukturellen Hindernisse zu überwinden. Für Europa spricht, dass international agierende Investoren in ihren Diversifizierungsbemühungen eher den rechtsstaatlichen Regeln, Institutionen und transparenten Systemen des alten Kontinents Vertrauen schenken werden. Für China spricht das zentralisierte politische System und das aktive, strategische und planvolle Bemühen der politischen Führung, die internationale Währungsordnung in ihrem Sinne zu verändern.
Wie bilanzexterne Fiskalagenturen Handlungsspielraum zur Finanzierung geoökonomischer Herausforderungen schaffen können
Die Beiträge in dieser Sammelstudie machen deutlich, dass die Bundesrepublik Deutschland zunehmend mit neuen geoökonomischen Herausforderungen konfrontiert ist, die mit einem erhöhten Finanzierungsbedarf einhergehen. Bisher ist dabei insbesondere die Verteidigungspolitik zu einem Treiber tiefgreifender finanzpolitischer Veränderungen geworden. Mit dem Sondervermögen Bundeswehr wurde im Juni 2022 ein Instrument geschaffen, das Pioniercharakter hat. Es markiert den Beginn einer neuen Phase, in der gezielt Ausnahmen von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse ermöglicht werden, um die geopolitischen Herausforderungen im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu bewältigen. Nach der Bundestagswahl 2025 folgte der nächste Schritt, nämlich die Entscheidung, verteidigungspolitische Ausgaben grundsätzlich von der Schuldenbremse auszunehmen. Diese Maßnahmen berücksichtigen jedoch nur einen Teil der geoökonomischen Herausforderungen, vor denen Deutschland und Europa stehen. Die anderen Beiträge im zweiten Teil dieser Sammelstudie zeigen, dass in vielen weiteren Bereichen – etwa bei Rohstoffsicherheit, Energiepolitik oder digitaler Souveränität – erheblicher Handlungsbedarf besteht.
Das fiskalische Ökosystem bietet Spielraum zur finanziellen Bewältigung geoökonomischer Herausforderungen.
Im Hinblick auf geoökonomisches Handeln dient Fiskalpolitik als materielle Grundlage für andere staatliche Handlungsbereiche, in denen »wirtschaftliche Mittel zur Erreichung politischer Ziele eingesetzt werden«.1 Erst mit entsprechenden finanziellen Ressourcen lassen sich sicherheits-, außen- und wirtschaftspolitische Herausforderungen wirksam angehen. Fiskalischer Handlungsspielraum findet sich dabei nicht allein im staatlichen Kernhaushalt, sondern auch bei »bilanzexternen Fiskalagenturen«.2 Sondervermögen wie das für die Bundeswehr sind ein Beispiel dafür, aber auch Entwicklungsbanken wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder kommunale Energieversorger fallen darunter. Gemeinsam bilden der Kernhaushalt und bilanzexterne Fiskalagenturen ein »fiskalisches Ökosystem«, das historisch gewachsen ist und heute zehntausende unterschiedliche Entitäten umfasst.
Um geoökonomischen Herausforderungen gerecht zu werden, können neben den Kernhaushalten auch bilanzexterne Fiskalagenturen eine wichtige Rolle spielen, die bislang in der Debatte allerdings kaum beleuchtet wurden. Im Folgenden wird daher zunächst ein Überblick über das fiskalische Ökosystem in Deutschland gegeben, einschließlich der großen Vielfalt an bilanzexternen Fiskalagenturen auf Bund-, Länder- und kommunaler Ebene. Anschließend werden zwei Vorschläge skizziert und diskutiert, wie sich fiskalischer Handlungsspielraum in der Außen- und Sicherheitspolitik durch bilanzexterne Fiskalagenturen erweitern ließe. Abschließend werden mögliche Zielkonflikte in Bezug auf fiskalische Nachhaltigkeit sowie systemische Finanzstabilität betrachtet.
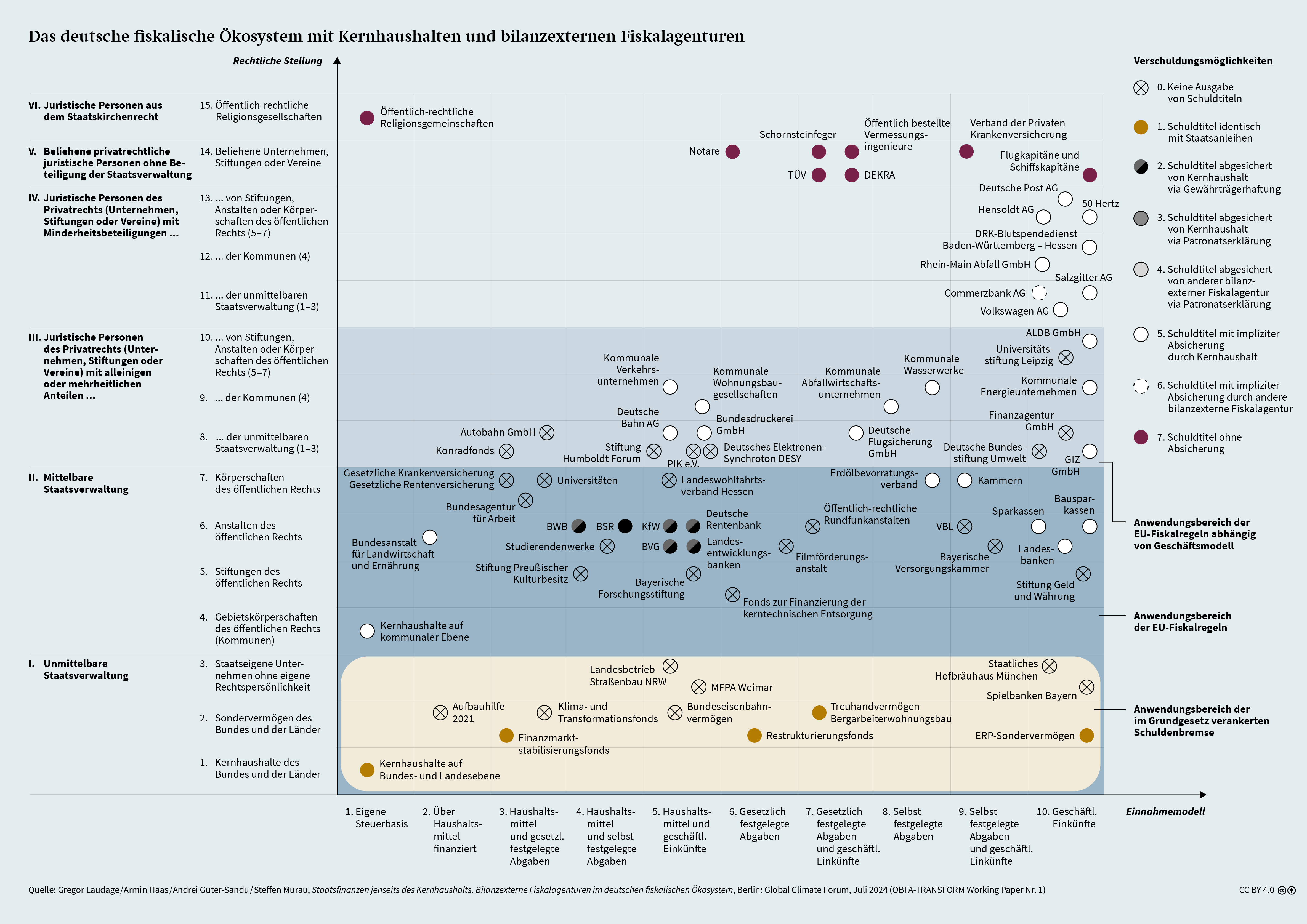
Bilanzexterne Fiskalagenturen im gegenwärtigen deutschen fiskalischen Ökosystem
Grafik 1 gibt einen schematischen Überblick über das gegenwärtige fiskalische Ökosystem in Deutschland, über die Arten von bilanzexternen Fiskalagenturen und über das, was diese ausmacht. Exemplarisch werden in der Grafik 72 verschiedene Entitäten aufgeführt, die Teile des fiskalischen Ökosystems sind. In diesem findet sich der fiskalische Spielraum, der zur Finanzierung von Maßnahmen zur Bewältigung geoökonomischer Herausforderungen benötigt wird.
Das Kategorienschema weist drei Dimensionen auf: die rechtliche Stellung, das Einnahmemodell sowie die Verschuldungsmöglichkeiten einer Institution. Der Bezugspunkt sind die Kernhaushalte des Bundes und der Länder, die über eine eigene Steuerbasis verfügen und sich am Kapitalmarkt verschulden können.
Erstens: Die rechtliche Stellung. Diese Dimension baut auf dem Verständnis des deutschen Verwaltungsrechts auf. Die einzelnen Ebenen sind auf der vertikalen Achse so positioniert, dass ihre Position die Nähe oder die Ferne von den Kernhaushalten des Bundes und der Länder abbildet. Je tiefer eine Ebene angeordnet ist, desto näher ist sie den Kernhaushalten. Die unterste Kategorie I umfasst die unmittelbare Staatsverwaltung, zu der die Kernhaushalte gehören; die nächste Kategorie II die mittelbare Staatsverwaltung. In Kategorie III finden sich juristische Personen, die in Allein- oder im mehrheitlichen Eigentum von Institutionen der Kategorien I bzw. II sind. Kategorie IV enthält Minderheitsbeteiligungen von Institutionen der Kategorien I bzw. II. Kategorie V beinhaltet juristische Personen des Privatrechts, die nicht im Eigentum der öffentlichen Hand sind, aber öffentliche Aufgaben übernehmen. Kategorie VI schließlich umfasst öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften.
Zweitens: Das Einnahmemodell. Diese Dimension zeigt auf der horizontalen Achse ebenfalls die Nähe oder Ferne von den Kernhaushalten an. Die Kategorie 1 ganz links umfasst Institutionen, die über eine eigene Steuerbasis verfügen. Die Kategorien 2 bis 5 schließen Institutionen ein, die über Mittel der Kernhaushalte finanziert werden. Bei Kategorie 2 ist dies die alleinige Quelle von Einnahmen. Bei den Kategorien 3 und 4 kommen noch Abgaben hinzu, die bei Kategorie 3 gesetzlich festgelegt sind, bei Kategorie 4 hingegen durch die Institutionen dieser Kategorie selbst festgelegt werden; bei Kategorie 5 kommen zu den Haushaltsmitteln eigene geschäftliche Einkünfte dazu. In den Kategorien 6 bis 9 finden sich Institutionen, die durch Abgaben finanziert werden. Bei den Kategorien 6 und 7 sind diese Abgaben gesetzlich festgelegt. Bei Kategorie 6 sind diese Abgaben die alleinige Einnahmequelle, während bei Kategorie 7 noch geschäftliche Einkünfte dazukommen. Bei Kategorie 8 und 9 werden die Abgaben durch die Institutionen selbst festgelegt. Bei Kategorie 8 sind diese die alleinige Einnahmequelle, während bei Kategorie 9 noch geschäftliche Einkünfte dazukommen. Kategorie 10 schließlich enthält Institutionen, die sich allein durch geschäftliche Einkünfte finanzieren.
Drittens: Die Verschuldungsmöglichkeiten. Inwiefern sich die Entitäten verschulden können, wird durch verschiedene Arten von Kreisen dargestellt. Institutionen der Kategorie 0 können sich nicht verschulden, während Institutionen der Kategorien 1 bis 7 eigene Schulden aufnehmen können. Bei Kategorie 1 sind die Schuldtitel der Institutionen identisch mit denjenigen der Kernhaushalte. Bei Kategorie 2 sind diese durch Gewährträgerhaftung der Kernhaushalte abgesichert, bei Kategorie 3 durch Patronatserklärung der Kernhaushalte, bei Kategorie 4 durch Patronatserklärung anderer bilanzexterner Fiskalagenturen. Bei den Kategorien 5 und 6 erfolgt die Absicherung nur implizit, also ohne expliziten Rechtsanspruch, und zwar bei Kategorie 5 durch Kernhaushalte, bei Kategorie 6 durch andere bilanzexterne Fiskalagenturen. Kategorie 7 schließlich umfasst Institutionen, deren Schuldtitel nicht abgesichert sind. Ob eine Institution eigene Schulden aufnehmen kann, sagt nicht unbedingt etwas aus über die Nähe oder Distanz zum Kernhaushalt. Obwohl beispielsweise Sondervermögen dem Kernhaushalt am nächsten stehen, können einige von ihnen Schulden aufnehmen, andere nicht.
Diese drei Dimensionen zeigen die Komplexität des deutschen fiskalischen Ökosystems. Insbesondere machen sie deutlich, dass die Unterscheidung zwischen staatlichen und marktwirtschaftlichen Entitäten keineswegs binär ist, sondern der Übergang von Macht zu Markt (und zurück) graduell ist. Die Handlungslogiken, denen eine Entität unterliegt, hängen damit nicht allein davon ab, ob sie nach öffentlichem Recht oder Privatrecht organisiert ist. Vielmehr geht es auch um die genaue Aufgabenstellung, die für eine Entität definiert wird. Insofern können bilanzexterne Fiskalagenturen durchaus für die Finanzierung geoökonomisch definierter Ziele geeignet sein.
Eine wichtige Rolle hierbei spielt ein weiterer Aspekt, der in Grafik 1 in Erscheinung tritt, nämlich inwiefern bilanzexterne Fiskalagenturen dem Anwendungsbereich rechtlicher Schuldenbremsen unterliegen. Zum einen betrifft dies die im deutschen Grundgesetz verankerte Schuldenbremse. Diese folgt einer juristischen Logik, nach der es allein auf die rechtliche Ausgestaltung einer Entität ankommt, ob sie unter die Schuldenbremse fällt. Konkret fallen alle Entitäten der unmittelbaren Staatsverwaltung darunter, unabhängig von ihrem Einnahmemodell. Zum anderen betrifft dies die europäischen Fiskalregeln. Diese folgen einer ökonomischen Logik, wonach dem öffentlichen Defizit Schranken gesetzt werden, unabhängig von der Rechtsform einer Entität. Grundlage hierfür sind die statistischen Bestimmungen des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen. Auf dieser Grundlage gelten die EU-Fiskalregeln für alle Entitäten der unmittelbaren bzw. mittelbaren Staatsverwaltung. Bei juristischen Personen, die im alleinigen oder mehrheitlichen Eigentum der unmittelbaren oder mittelbaren Staatsverwaltung sind, kommt es auf deren Einnahmemodell an, ob auf sie die EU-Fiskalregeln angewandt werden. Sofern sie ihre Einnahmen weitgehend auf Märkten erzielen, ist das nicht der Fall.3 Dies trifft beispielsweise für die Deutsche Bahn AG zu, die nicht den EU-Fiskalregeln unterworfen ist. Die Autobahn GmbH ist es dagegen sehr wohl, obgleich beide Institutionen als Kapitalgesellschaften, die im Besitz des Bundes sind, zur gleichen juristischen Kategorie 8 gehören.
Die in Grafik 1 dargestellten Entitäten stellen allesamt Beispiele dar und sind keinesfalls vollständig. Die Gesamtzahl aller Entitäten geht in die Zehntausende. So gibt es neben den 17 Kernhaushalten auf Bundes- und Länderebene 10.753 Gemeinden und 106 kreisfreie Städte sowie 294 Landkreise. Die Anzahl der Sondervermögen des Bundes und der Länder liegt knapp unter 200 und ist damit noch recht überschaubar. Allerdings bewegt sich die Zahl der Unternehmen im Eigentum der öffentlichen Hand in der Größenordnung von 20.000, wovon 16.000 im Eigentum der Kommunen sind. Die wichtigsten dieser Unternehmen sind in den Bereichen Energieversorgung, Wasserwirtschaft und öffentlicher Verkehr tätig.
Bilanzexterne Fiskalagenturen als Hilfestellung für geoökonomische Ziele
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist das Erfordernis, in der Wirtschafts- und Finanzpolitik umzudenken, um jene geoökonomischen Herausforderungen zu bewältigen, die mit der Rückkehr von Macht in der Weltwirtschaft einhergehen.4 Hier stellt sich vor allem die Frage, inwiefern sich mit Hilfe bilanzexterner Fiskalagenturen Finanzierungsaufgaben bewältigen und der fiskalische Spielraum erweitern lassen. Dabei kann es sich um ganz unterschiedliche Ziele handeln – sei es die staatliche Unterstützung der Energieinfrastruktur, die finanzielle Absicherung von Risiken in der Handelspolitik oder eben die langfristige Aufrüstung des Militärs. Das Koordinatensystem in Grafik 1 ermöglicht es, über unterschiedliche Konstruktionen nachzudenken.
Grundsätzlich ist es ein historisch wiederkehrendes Phänomen, dass Staaten, die sich mit großen Finanzierungsaufgaben konfrontiert sehen, neue bilanzexterne Fiskalagenturen schaffen, um ihren fiskalischen Spielraum zu vergrößern. Bleibt man etwa beim Beispiel der Rüstungsfinanzierung, so waren bereits während des Ersten Weltkriegs mehrere hundert bilanzexterne Fiskalagenturen ein wesentlicher Teil der deutschen Kriegswirtschaft, etwa die Darlehnskassen.5 Die wohl berühmteste deutsche bilanzexterne Fiskalagentur im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg war die Metallurgische Forschungsgesellschaft (Mefo), eine Briefkastenfirma zur verdeckten Finanzierung der deutschen Wiederaufrüstung. Diese Finanzierung musste deshalb verdeckt erfolgen, weil sie gegen den Versailler Vertrag verstieß.6 Aber auch auf der anderen Seite des Atlantiks war es eine bilanzexterne Fiskalagentur, die den USA Anfang der 1930er Jahre half, öffentliche Investitionen zu finanzieren und so durch die Große Depression zu kommen. Während des Zweiten Weltkriegs trug diese Reconstruction Finance Corporation wesentlich zur Kriegsfinanzierung bei. Erst in der Nachkriegszeit wurde sie aufgelöst.
Sollen nun in der Gegenwart bilanzexterne Fiskalagenturen zur Finanzierung von Zielen geoökonomischen Handelns genutzt werden, stellt sich ebenfalls die Frage nach einer geeigneten Konstruktion im fiskalischen Ökosystem. Dabei kann es sich entweder um bereits existierende Entitäten handeln oder um solche, die noch neu zu schaffen wären.
Als erstes Beispiel könnte man eine Entität ins Auge fassen, die als Stiftung, Anstalt oder Körperschaft des öffentlichen Rechts der mittelbaren Staatsverwaltung zugeordnet wird und das Recht hat, Schulden aufzunehmen. Da diese Schulden nicht der deutschen Schuldenbremse unterlägen, hätte diese Entität größeren fiskalischen Spielraum als die Kernhaushalte oder Sondervermögen. Allerdings fielen die Schulden zwingend unter die europäischen Fiskalregeln. Inwiefern diese den finanziellen Spielraum der Entität einschränkten, hinge von der Bewertung der Gesamtverschuldung des öffentlichen Sektors ab. In manchen Situationen mag der Spielraum sehr eng sein, in anderen nicht. Für die Bewertung des Verschuldungsspielraums ist aufgrund der komplexen zugrundeliegenden Methodologie ein weiter Ermessensrahmen nötig.7
Als zweites Beispiel könnte eine Entität in Betracht gezogen werden, die als juristische Person des Privatrechts konstruiert wäre und den oben genannten, schwierig zu greifenden Graubereich zwischen Markt und Staat ausnutzte, um nicht den europäischen Fiskalregeln unterworfen zu werden. Dazu müsste sie entweder mehrheitlich im Eigentum der öffentlichen Hand sein und sich über den Markt finanzieren oder nur im Minderheitsbesitz der öffentlichen Hand sein. Beide Alternativen stünden vor erheblichen Herausforderungen. Im Fall einer Mehrheitsbeteiligung stellt sich die Frage, wie ein Markt aussehen soll und wer ihre nichtstaatlichen Kunden sein könnten. Im Fall einer Minderheitsbeteiligung wäre zu klären, wer die privaten Mehrheitseigner einer solchen Gesellschaft sein könnten und wie das Geschäftsmodell und das Rendite-Risiko-Profil einer solchen Gesellschaft gestaltet werden müssten, um für private Investoren attraktiv zu sein. Solche Konstruktionen könnten zudem staatspolitisch fragwürdig anmuten und würden gesellschaftliche und parlamentarische Mehrheiten erfordern.
Neben dem erweiterten finanziellen Handlungsspielraum böten bilanzexterne Fiskalagenturen die Möglichkeit, spezifische fachliche Expertise zu bündeln. Viele geoökonomische Belange erfordern die enge Verzahnung von außen-, wirtschafts-, technologie- und sicherheitspolitischem Wissen. Eine themenspezifisch organisierte Struktur könnte diese Kompetenzen über Ressortgrenzen hinweg strategisch zusammenführen. So könnte etwa gezielt ein Beitrag zur geoökonomisch relevanten technologischen Entwicklung geleistet werden.8 Langfristig ließe sich auf diese Weise ein institutionelles Gefüge etablieren, das die bestehenden ministeriellen Zuständigkeiten nicht ersetzt, sondern ergänzt. Eine solche Einrichtung könnte flexibler und innovativer operieren, kooperativere Finanzierungsmodelle ermöglichen und ressortübergreifende Handlungsfähigkeit stärken.
Die Frage der fiskalischen Nachhaltigkeit: Fundierung im Finanzsystem
Die Nutzung bilanzexterner Fiskalagenturen zur Finanzierung von Maßnahmen zur Bewältigung geoökonomischer Herausforderungen sollte nicht auf Kosten der Stabilität der Staatsfinanzen gehen. Diese Gefahr ist nicht aus der Luft gegriffen. Denn tatsächlich endete die oben erwähnte Expansion des Geld- und Kreditsystems in beiden Weltkriegen mit einer Zerrüttung der deutschen Staatsfinanzen. Jedoch muss einer fundamentalen Krise des Geld- und Kreditsystems nicht notwendigerweise ein verlorener Krieg vorausgehen, wie die Finanzkrise von 2008 gezeigt hat.
Es gilt, institutionelle Vielfalt zur Steuerung und Finanzierung zu nutzen und dabei das fiskalische Ökosystem stabil zu halten.
Was also bestimmt, ob ein Verschuldungsniveau – nicht nur der Kernhaushalte, sondern des gesamten fiskalischen Ökosystems – fiskalisch nachhaltig ist? Der Ansatz der bestehenden Schuldenregeln ist, Neuverschuldung eng zu begrenzen (wie etwa in der grundgesetzlichen Schuldenbremse) oder eine Schuldenquote vorzugeben (wie etwa der Referenzwert von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts laut den Maastricht-Kriterien). Dies sind Behelfskonstrukte, um exzessive Verschuldung zu vermeiden, aber keine hinreichenden Maßnahmen, die fiskalische Nachhaltigkeit sicherstellen. Tatsächlich ist der entscheidende Punkt, ob und wie sich die von den Entitäten des fiskalischen Ökosystems ausgegebenen Schuldtitel im Finanzsystem platzieren und refinanzieren lassen. Das ist die Frage der »Fundierung«.9
Ob sich Schuldtitel fundieren lassen, hängt nicht allein von der Angebotsseite ab, sondern auch von der Nachfrageseite im Finanzsystem. Die Schuldtitel der öffentlichen Hand erfüllen dabei auch eine wichtige Funktion als öffentliches Gut für Finanzinstitutionen. Sie fungieren etwa als sichere Anlageinstrumente (»safe assets«), auf die sowohl private Haushalte als auch Banken und institutionelle Investoren dringend angewiesen sind. Gerade im Euroraum besteht ein langfristiges Defizit an solchen »safe assets«, was die Rolle Deutschlands als Emittent besonders relevant macht.
Die Fundierung der Schulden ist eine komplexe politische und makrofinanzielle Managementaufgabe, die sich nicht allein durch ex ante getroffene Vorgaben lösen lässt. Sie muss sowohl angebots- als auch nachfrageseitige Faktoren berücksichtigen. Dafür gibt es in Deutschland spezialisierte Institutionen wie etwa die Deutsche Finanzagentur. Sie arbeitet mit der Bietergruppe Bundesemissionen zusammen, die jene Kreditinstitute umfasst, welche die neu ausgegebenen Bundeswertpapiere auf dem Primärmarkt abnehmen und anschließend auf dem Sekundärmarkt weiterverkaufen. Die Finanzagentur bietet Bundeswertpapiere unterschiedlicher Laufzeiten an, um nachfrageseitig unterschiedlichen Anlagepräferenzen gerecht zu werden. Diese gewachsenen Strukturen dienen allesamt dem Ziel einer nachhaltigen Fundierung von Schulden der öffentlichen Hand. Es wird von der Glaubwürdigkeit und Nachvollziehbarkeit der institutionellen Ausgestaltung bilanzexterner Fiskalagenturen abhängen, ob deren Schulden von den Marktteilnehmern als äquivalent zu Schulden der Kernhaushalte eingeschätzt werden.
Fazit
Ein genauer Blick auf das fiskalische Ökosystem offenbart die Komplexität staatlicher Finanzierungsstrukturen, die weit entfernt sind von der stark abstrakten Vorstellung, dass Staatsfinanzen exklusiv den Kernhaushalt betreffen. Die Vielzahl bilanzexterner Fiskalagenturen zeigt, wie unterschiedliche institutionelle Arrangements dazu beitragen können, den fiskalischen Handlungsspielraum zu erweitern, um geoökonomisch motivierte Ziele strategisch zu verfolgen. Vor diesem Hintergrund sollte die Bundesregierung in ihrer zukünftigen Finanz- und Wirtschaftspolitik das Thema Verschuldung im fiskalischen Ökosystem nicht ausschließlich als Defizitproblem, sondern auch als potentes Steuerungsinstrument verstehen. Entscheidend ist dabei die Bereitschaft, sich von vereinfachten Haushaltsnarrativen zu lösen, die institutionelle Vielfalt ernst zu nehmen und das fiskalische Ökosystem konstruktiv dafür zu nutzen, geoökonomische Herausforderungen anzugehen.
Fazit und Handlungsempfehlungen
Hanns Günther Hilpert / Sascha Lohmann
Ausgangspunkt dieser Sammelstudie war der konzeptionell vage Gebrauch des Begriffs »Geoökonomie« in Politik, Wirtschaft und anwendungsbezogener Forschung.1 Vorbei sind die Zeiten, in denen sich ein deutscher Bundespräsident noch gezwungen sah, nach einem Interview zurückzutreten, in dem er sich für den Schutz freier Handelswege notfalls auch mit militärischer Gewalt ausgesprochen hatte und dafür überparteilich heftig kritisiert wurde.2 Im Gegensatz dazu ist der aktuelle Diskurs mitunter in eine allzu martialische Rhetorik von Märkten als Schlachtfelder eines globalen Wirtschaftskriegs eingebettet, in dem wirtschaftliche Entflechtung und Technologieentzug als Waffen in Stellung gebracht würden. Hinter solchem Rauschen vollzieht sich allerdings ein Paradigmenwandel, der dadurch gekennzeichnet ist, dass machtpolitische Erwägungen marktwirtschaftliche Austauschbeziehungen immer stärker durchdringen und sich in der Folge das Verhältnis zwischen Macht und Markt verschiebt. David Ricardos Theorem der komparativen Kostenvorteile als Maßgabe größtmöglicher Spezialisierung in der internationalen Arbeitsteilung gerät zunehmend unter Beschuss.3 Die regelbasierte internationale Ordnung verliert an Strahlkraft, und es entsteht ein Interregnum zwischen abnehmender Interdependenz und wachsender Polarität. Wirtschaft erscheint weniger als Motor gesellschaftlichen Wohlstands, sondern als materielle Voraussetzung staatlicher Macht.4 Dieser Transformationsprozess vollzieht sich in unterschiedlichen Regionen und Ländern und speist sich dort aus den jeweiligen Traditionen.5 Neu an dieser geoökonomischen Zeitenwende ist der hohe Grad der Vernetzung und Verflechtung, der die heutige globalisierte Welt von früheren Epochen unterscheidet und deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik vor gänzlich neue Herausforderungen stellt.
Die Beiträge dieser Sammelstudie machen deutlich, dass die Rückkehr von Macht auf den Markt vielschichtiger ist als ein vermeintlicher Fall des Handelsstaates und seine Ersetzung durch einen wiederauferstehenden nationalen Sicherheitsstaat. Idealtypisch sichert der Handelsstaat nationalen Wohlstand und Weltfrieden durch Welthandel. Seine vorrangige Aufgabe ist es, gute Standortbedingungen für Investoren zu schaffen und die nationalen Spezialisierungsvorteile bestmöglich zur Entfaltung zu bringen. Dies kann aber nicht mehr die Priorität eines Sicherheitsstaates sein, für den nationale Interessen an erster Stelle stehen. Wenn geboten, müssen internationale Wirtschafts- und Finanzbeziehungen entflochten, muss im Ausland zum Schutz (oder gar zur Beförderung) der nationalen Sicherheitsinteressen interveniert werden. Diese idealtypische Trennung zwischen Wirtschaft und Sicherheit fiel empirisch ohnehin nie so streng aus. Während etwa der Handelsstaat die Außenhandelsfreiheit garantierte und absolute Gewinne im Rahmen regel- und normbasierter Zusammenarbeit erzielte, spielten Sicherheitserwägungen als Ausnahmetatbestände seit jeher eine bedeutende Rolle.6
Für Unternehmen haben sich die Kontextbedingungen fundamental verschoben. Die Globalisierung und der technologische Wandel entziehen private Akteure nicht der staatlichen Regulierung und führen nicht zu einem globalen Weltmarkt, auf dem Güter, Kapital, Dienstleistungen und Arbeit frei und friktionslos gehandelt werden. Anstatt einer »Dämmerung staatlicher Souveränität« – wie vom ehemaligen CEO der Citibank Corporation Walter B. Wristen Mitte der 1990er Jahre ausgerufen – werden globalisierte Märkte vermehrt für außen- und sicherheitspolitische Zielsetzungen instrumentalisiert und die freie Marktlogik weltweiter Produktions- und Lieferketten in Fesseln nationaler Sicherheitserwägungen gelegt, besonders von den USA und China, aber auch immer stärker in der EU.7 Dabei löst sich die Trennung zwischen öffentlichen (staatlichen) und privaten (marktwirtschaftlichen) Interessen zunehmend auf. Unternehmen müssen politische Vorgaben berücksichtigen bzw. umsetzen.8
Die Rückkehr von Macht auf den Markt betrifft die exportabhängige und auf freien Handel angewiesene deutsche Wirtschaft existentiell. Verstärkt stehen die auf Gewinnerzielung ausgerichteten autonomen Entscheidungen und Handlungen der deutschen Außenwirtschaft unter dem wichtigen Vorbehalt, dass von ihnen keine Gefährdung der wirtschaftlichen Sicherheit oder der politischen Souveränität Deutschlands ausgehen darf. Machtpolitische Erwägungen grenzen das freie Spiel der Marktkräfte immer weiter ein, und mit jeder geopolitischen Eskalationsspirale wächst die Zahl der Handelshemmnisse wie Zölle und Lizenzierungspflichten. Doch der angestrebte Zugewinn an politischer Autonomie und wirtschaftlicher Sicherheit geht zu Lasten der im Außenwirtschaftsverkehr erreichbaren Wohlstandsgewinne.
Diese geoökonomische Zeitenwende als potentiell disruptive Transformation bildet eine erhebliche Herausforderung für die EU und ihre Mitgliedstaaten. Auf diese Transformation nicht nur zu reagieren, nämlich durch erhöhte Widerstandskraft (Resilienz), sondern sie aktiv mitzugestalten erfordert zunächst die Bereitschaft zu einem außenwirtschaftspolitischen Prioritäten-, wenn nicht gar Paradigmenwechsel. Zwar wurde der Instrumentenkasten staatlicher Akteure für Markteingriffe im Zuge der Covid-19-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zielstrebig ausgebaut. Wirtschaft als Machtressource neben Militär und Diplomatie wurde jedoch allenfalls deklaratorisch Beachtung geschenkt. Der Forderung von Josep Borrell, dem damaligen Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, die EU müsse die »Sprache der Macht erlernen«,9 indem sie ihr wirtschaftliches Potential des Gemeinsamen Binnenmarktes entsprechend einsetze, folgten nur wenige Taten. So erschöpft sich das »geopolitische Erwachen«10 der EU bislang überwiegend in einer Abkehr von dem Anspruch, eine »normative Macht«11 zu sein. Hierin zeigt sich, dass die ideellen Ressourcen geoökonomischen Handelns, das Macht und Markt nicht als zwei getrennte Sphären betrachtet, sondern konsequent zusammendenkt und demgemäß handelt, zu lange brachgelegen haben, vor allem in Deutschland.12
Handlungsempfehlungen für deutsche und europäische Politik
Diese Sammelstudie stellt praxisrelevantes Orientierungs- und Handlungswissen in einer Zeit bereit, in der außen- und sicherheitspolitische Entscheidungsträgerinnen und -träger in Deutschland und Europa immer nachdrücklicher aufgerufen werden, international mehr Verantwortung zu übernehmen.13 Die Autorinnen und Autoren der einzelnen Beiträge zeichnen den in Frequenz und Intensität steigenden Einsatz wirtschaftlicher und technologischer Instrumente über verschiedene Politikfelder hinweg nach, mit denen wirtschafts- und sicherheitspolitische Ziele verfolgt werden, und ziehen für ihr Handlungsfeld eine Reihe konkreter Schlussfolgerungen. Darauf aufbauend werden im Folgenden drei übergeordnete Handlungsempfehlungen für geoökonomisches Handeln der Bundesregierung formuliert. Diese betreffen
|
1) |
den Aufbau ressortübergreifender Strukturen |
|
2) |
die Kommunikation und Koordination mit relevanten Stakeholdern aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie |
|
3) |
die Zusammenarbeit mit anderen bzw. gleichgesinnten Staaten und internationalen Institutionen. |
Aufbau ressortübergreifender Strukturen
Geoökonomisches Handeln ist eine originäre Querschnittsaufgabe. Sie erfordert ressortübergreifende Strukturen innerhalb von Exekutiven auf Ebene der EU und ihrer Mitgliedstaaten, um die noch weitgehend entlang von Ressortgrenzen getrennten Bereiche Wirtschaftspolitik sowie Außen- und Sicherheitspolitik einer gemeinsamen Lagebetrachtung und ‑einschätzung zu unterziehen. Dabei sollten neue Methoden wie eine nationale Risikoanalyse eingeführt und in regelmäßigen Abständen angewandt werden, um ein ressortgemeinsames Lagebild zu erstellen, das als Voraussetzung für geoökonomisches Handeln dienen könnte.14 Komplementär dazu sollten künftige geoökonomisch relevante Entwicklungen systematisch in einer strategischen Vorausschau antizipiert sowie in besonders kritischen Einzelfällen auch in Szenarien und Planspielen wie war gaming15 durchdacht werden. Eingesetzte wirtschaftliche und technologische Instrumente sollten weiterhin standardmäßig evaluiert werden, und zwar hinsichtlich ihrer intendierten und nichtintendierten Wirkungen sowie ihrer Wirksamkeit. In Deutschland wurde mit der Fortentwicklung des Bundessicherheitsrates hin zu einem Nationalen Sicherheitsrat Anfang Mai 2025 bereits eine grundsätzlich geeignete institutionelle Struktur geschaffen. Diese gilt es nun auch mit Blick auf die machtpolitische Aufladung internationaler Wirtschaftsbeziehungen zu entwickeln. Idealerweise sollte der Nationale Sicherheitsrat nicht nur mit der erforderlichen Koordinierungs-, sondern auch mit einer Entscheidungskompetenz ausgestattet sein.
Um eine effizientere und effektivere Ressortabstimmung sowie vernetztes geoökonomisches Denken und Handeln zu erleichtern, sollten einschlägige gesetzliche und verwaltungsrechtliche Grundlagen novelliert sowie administrative Prozesse agiler gemacht werden. Aktuell verfügt die Bundesregierung beispielsweise nur über begrenzte Kompetenzen und Instrumente, um durch Vorgaben, Beschränkungen oder Verbote unmittelbar auf private Unternehmen einzuwirken. Deren grenzüberschreitende Aktivitäten werden von der verfassungsmäßig garantierten Außenhandelsfreiheit geschützt. Eingeschränkt wird diese Freiheit lediglich für die Kontrolle militärischer und zivil-militärischer Güter sowie bestimmter ausländischer Investitionen. Rechtlich außerordentlich bedeutsam sind in diesem Kontext vor allem die Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze. Sie ermächtigen die Bundesregierung, im Verteidigungs-, Spannungs-, Zustimmungs- und Bündnisfall weitreichende planwirtschaftliche Eingriffe in Wirtschaft, Ernährung, Wasser, Post- und Telekommunikationswesen sowie Verkehr vorzunehmen, sofern »Versorgungsschwierigkeiten mit marktgerechten Mitteln nicht überwunden werden können«.16 Im Energiebereich sind weitgehende staatliche Eingriffe in Form von Preisvorgaben wie die sogenannten »Deckel« oder »Bremsen« sowie Enteignungen bereits im Krisenfall zulässig, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Mit einer Novelle des Gesetzes über den Auswärtigen Dienst sowie des Außenwirtschaftsgesetzes sollten mit geoökonomischem Handeln betraute Dienstposten in allen Laufbahnen geschaffen und durch institutionalisierte Fort-, Aus- und Weiterbildung kontinuierlich entwickelt werden. Speziell dem Auswärtigen Amt käme im Sinne eines solchen vernetzten Ansatzes eine Plattform-Funktion zu. Das heißt, dass Angehörige vor allem der höheren Laufbahnen vielgestaltige Netzwerke aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft führen und lenken sollen, anstatt diese nur zu konsultieren.17 Eine solche »geoökonomische Diplomatie«18 sollte über den engen Austausch mit verschiedenen Interessengruppen hinaus auch auf ein großes Reservoir an Personal zurückgreifen können. Diese Personen könnten ressortübergreifend auf verschiedenen Posten rotieren und vielseitige Verwendungen absolvieren, etwa in den Ressorts Verteidigung, Finanzen, Wirtschaft, Gesundheit oder Digitales.
Neben diesen strukturellen Maßnahmen sollte die Nationale Sicherheitsstrategie konzeptionell und operativ weiterentwickelt werden.19 Der Einsatz wirtschaftlicher Instrumente sollte darin näher spezifiziert und enger mit den einschlägigen Strategien auf EU-Ebene verknüpft werden. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Umsetzung der EU-Wirtschaftssicherheitsstrategie sollte dem Zielbild folgen, wirtschaftliche Maßnahmen nach innen und außen kohärenter anzuwenden. Analog zum Einsatz militärischer Gewalt sollte eine Doktrin formuliert werden, in der festgelegt ist, unter welchen Bedingungen defensive und offensive wirtschaftliche Instrumente wie Export- und Investitionskontrolle bzw. ‑screening sowie restriktive Maßnahmen im Rahmen der GASP eingesetzt würden.
Kommunikation und Koordination mit relevanten Stakeholdern
Geoökonomisches Handeln ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an deren Lösung sich auch Wirtschaft und Wissenschaft beteiligen müssen. Bewältigungs- und Widerstandsfähigkeit kann schwerlich verordnet werden. Um sie zu erreichen, müssen unterschiedliche Akteure aus Politik und Wirtschaft zusammenwirken, kompetent unterstützt durch eine Wissenschaft, die willens ist, multidisziplinär nach theoretischen Erkenntnissen und praktischen Lösungen zu suchen. Dafür sind Formate für einen engen und gegebenenfalls auch vertraulichen Austausch von Ideen und Erfahrungen notwendig.20 Jenseits von Rentabilitäts- und Gewinnstreben wird zuvörderst ein Mentalitätswandel in der Wirtschaft, aber auch in Politik und Gesellschaft stattfinden müssen. Ähnlich wie in Finnland müssen ökonomische Resilienz und Wehrhaftigkeit einen ähnlich hohen Stellenwert gewinnen wie etwa Nachhaltigkeit.
Die mit geoökonomischen Fragen befasste Politik der EU und ihrer Mitgliedstaaten bedarf der engen Zusammenarbeit mit privaten Akteuren. Dabei müssen einzelne Unternehmen sowie deren Verbände und Vereinigungen einbezogen werden. In der Gesetzgebung und Verwaltung ist diese Politik auf fundierte und verlässliche Informationen angewiesen. Dafür wären klassische Beteiligungsformate weiterzuentwickeln, etwa Anhörungen im Rahmen parlamentarischer Gesetzgebungs- oder Verwaltungsverfahren. Damit geoökonomische Maßnahmen effektiv umgesetzt werden können, muss die Politik bei der freien Wirtschaft um Zustimmung und Akzeptanz werben. Für die Wirtschaft können nationale sicherheitspolitische Erwägungen eine Zumutung sein, da sie (kurzfristig) die betriebswirtschaftliche Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Daher reicht es nicht, in der Ausgestaltung regulatorischer Maßnahmen marktwirtschaftliche Anreize zu berücksichtigen. Vielmehr gilt es, Profitabilität sicherzustellen, etwa durch geeignete Austauschformate für kurzfristige Anpassungen. Die größten Chancen auf Akzeptanz hat eine geoökonomisch ausgerichtete Politik, die sich bestmöglich an anerkannten Ordnungsprinzipien der sozialen Marktwirtschaft orientiert.
Mit Blick auf die geoökonomischen Zwänge der Gegenwart empfiehlt sich allgemein:
-
Unternehmerische Entscheidungs- und Handlungsfreiheit in der Außenwirtschaft sollte nur so weit eingeschränkt werden, wie es aus sicherheitspolitischen Gründen unbedingt erforderlich ist. Maßnahmen zur Versorgungssicherheit sowie zum Schutz kritischer Infrastrukturen und Technologie sollten nur dann ergriffen werden, wenn sie zum Schutz von Staat und Bevölkerung unumgänglich oder dringend geboten sind.
-
Defensive und offensive Instrumente geoökonomischen Handelns sollten allein auf das Sicherheitsziel ausgerichtet sein. Sie sollten nicht mit anderen Zielen, etwa der Industriepolitik, mit Anliegen der Umwelt- und Klimapolitik oder mit konjunkturpolitischer Stimulierung vermengt werden. Für diese Ziele bedarf es weiterer Instrumente.21
-
Staatliche Maßnahmen sollten möglichst allgemein gehalten sein, beispielsweise in Form von Diversifizierungsquoten oder Konzentrationszöllen. Direkte Interventionen in die Geschäftstätigkeit von Außenwirtschaftsunternehmen sollte es nur in Ausnahmefällen geben. Auf Versorgungssicherheit abzielende Schutzmaßnahmen sollten sich auf den kleinen Bereich an Gütern und Sektoren beschränken, die erstens kurzfristig nicht substituiert werden können, zweitens unmittelbar konsumrelevant sind und drittens bei Lieferausfall negative externe Effekte verursachen.22
-
Gewinn- und Verlustrisiken im Außenwirtschaftsverkehr liegen bei den Investoren, nicht beim Staat, auch wenn Verluste geopolitisch begründet sind. Zwar kann der Staat mittels Investitionsgarantien, Kofinanzierung und politischer Intervention ex ante Risiken mindern und dabei helfen, Geschäfte anzubahnen. Das geschäftliche Risiko und das damit einhergehende geopolitische Risiko tragen jedoch allein die Investoren. Risikobewertung und ‑übernahme ist eine unternehmerische Aufgabe.23
Diese allgemeinen Überlegungen mögen nützlich sein, wenn es um den Aufbau der für engeres Zusammenwirken von Staat und Wirtschaft erforderlichen rechtlichen Kompetenzen, institutionellen Strukturen und administrativen Prozesse geht. Aber im Einzelfall sind immer wieder komplexe Abwägungen vorzunehmen. Das heißt auch, Chancen und Risiken sowie Nutzen und Kosten sorgfältig und neu zu beurteilen. Auf Grundlage eines integrativen Ansatzes sollten dabei Risiken, Anreize und Resilienz zusammengedacht werden. Auf diese Weise lassen sich unterschiedliche Optionen für eine Reaktion auf Produktions- und Lieferkettenrisiken prüfen, etwa Bevorratung, Kapazitätsvorhaltung, industriepolitische Subvention oder gar Wiederansiedelung (near-shoring). Diese Analysen sollten zu einem systematischen Lernen beitragen, das durch nachhaltiges Wissensmanagement in der Verwaltung gefördert und genutzt werden muss.
Lernprozesse sind aber vor allem auch in der Privatwirtschaft vonnöten, da geoökonomisches Denken und Handeln bislang nicht zu den Aufgaben global agierender Unternehmen zählte. Bestenfalls waren eigentümergeführte Firmen daran interessiert, geopolitische Risiken zu berücksichtigen, da diese schnell existenzgefährdend sein können. In der Regel schmälert es Umsatz und Gewinn, wenn geopolitische Interessen in Betracht gezogen werden. Renditestreben und Wettbewerbsdruck sorgen dafür, dass nationale wirtschaftliche Sicherheit im Kalkül nur begrenzt oder gar nicht eingepreist wird. Wirtschaftliche Sicherheit ist ein öffentliches Gut. Aus Unternehmensperspektive erscheint es daher rational, möglichst wenig Aufwand zur Bewahrung nationaler Sicherheit zu betreiben. Dies gilt vor allem dann, wenn der Wettbewerb zu Kostensenkungen zwingt und Unternehmen darauf hoffen können, notfalls durch staatliche Unterstützung gerettet zu werden. Zumindest in Maßen gegensteuern können hier Appelle der Politik an außenwirtschaftlich tätige Unternehmen, ihrer Verantwortung für die heimische Wirtschaft und Gesellschaft gerecht zu werden. Geoökonomischen Trittbrettfahrern sollte bewusst gemacht werden, dass ein solches Handeln ein Reputationsrisiko darstellt.
Anstatt allein auf Freiwilligkeit und globale Arbeitsteilung von Unternehmen zu setzen, sollten Diversifizierungspflichten und Obergrenzen etwa bei Einfuhren vorgegeben und so kalibriert werden, dass marktwirtschaftliche Anreize nach wie vor wirksam bleiben.24 Dafür sind Mechanismen erforderlich, um zu belastbaren Einschätzungen zu gelangen. Einschränkungen oder erhöhte Sorgfalts- und Nachweispflichten reichen allerdings kaum aus, um den Anforderungen einer geoökonomischen Zeitenwende an staatliche Rahmensetzung zu genügen. Darüber hinaus sollten die Kosten geoökonomischer Entscheidungen, zum Beispiel höhere Preise für Erzeugnisse aus heimischer Produktion, transparent und damit besser nachvollziehbar gemacht werden.25
Nicht nur in der Wirtschaft ist Umdenken gefragt, sondern auch in der (anwendungsbezogenen) Wissenschaft. Der ungebrochen dominante und zugleich fatale Trend zunehmender Spezialisierung innerhalb akademischer Fachrichtungen müsste gebremst und teilweise umgekehrt werden. Denn das damit einhergehende Silodenken lässt immer weniger Berührungspunkte zwischen sozialwissenschaftlichen Disziplinen zu, besonders zwischen Politik- und Wirtschaftswissenschaft. Es bedarf transdisziplinärer Ansätze, um geoökonomisches Denken und Handeln anwendungsbezogen zu erforschen. Das wäre im Sinne des Bestrebens, die konventionelle Trennung zwischen Politik-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaft zu überwinden.26 Ferner böte es sich an, den geoökonomischen Wissensbestand aus der Vergessenheit zu holen, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in (außer-)universitären Forschungseinrichtungen in Deutschland und anderen europäischen Einrichtungen erarbeitet wurde. Voraussetzung wäre allerdings, dass es sich um historisch unbelastete Beiträge handelt.
Internationale Zusammenarbeit
Defensives geoökonomisches Handeln zielt darauf ab, außen- und sicherheitspolitisch riskante Abhängigkeiten und die daraus resultierenden Verwundbarkeiten in den außenwirtschaftlichen Verflechtungen zu kontrollieren und einzuhegen. Manche Verflechtungen sollten taktisch begrenzt oder gar zurückgebaut werden. Andere dagegen sollten strategisch im Sinne einer ausgewogenen Risikostreuung gefördert und nach politisch relevanten Kriterien wie Partnern, Rivalen und Gegenspielern diversifiziert werden.27
Vor allem China und die USA nutzen offensiv geoökonomische Instrumente, um außenpolitische und außenwirtschaftliche Ziele zu verfolgen. Die EU hingegen begründet ihren Einsatz von Sanktionen überwiegend defensiv, etwa um Russlands militärischer Aggression gegen die Ukraine wichtige Ressourcen zu entziehen, oder normativ, um Nachhaltigkeits-, Menschenrechts- und Nichtverbreitungsnormen aufrechtzuerhalten. Auf der einen Seite hätte die EU also viel in der Zusammenarbeit mit außereuropäischen marktwirtschaftlichen Demokratien zu gewinnen. Auf der anderen Seite hätte sie wenig von einer intensiveren außenwirtschaftlichen und technologischen Verflechtung zu befürchten.
Auch in den Augen potentieller Partnerländer ist die EU ein weitaus attraktiverer Partner als die mit machtpolitischer Willkür auftretenden USA und China. Eine passgenau untereinander abgestimmte Diversifizierung brächte mehr wirtschaftliche Sicherheit für sämtliche Beteiligten. So könnten etwa die EU, Großbritannien, Kanada, Australien, Japan, Südkorea und Taiwan ihre Handels-, Investitions- und Technologiepolitik untereinander nach innen liberalisieren und nach außen harmonisieren. Damit würden alle ihre Resilienz nachhaltig erhöhen. Zugleich birgt eine außenwirtschaftliche Kooperation mit den ASEAN-Staaten, dem Mercosur, Mexiko und Südafrika kaum geoökonomische Risiken für die EU, sondern könnte im Gegenteil die wirtschaftliche Sicherheit verbessern. Beispiele wären eine koordinierte Vorratshaltung kritischer Güter, gemeinsame Standards bei Entwicklung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen oder gar eine Allianz gegen geoökonomische Angriffe von Dritten. Auf bilateraler Ebene sollten bestehende Austauschformate im Kreis gleichgesinnter G7-Partner ausgebaut werden. Anknüpfungspunkte hierfür ergäben sich vor allem mit Blick auf die jeweils noch weitgehend national definierten Wirtschaftssicherheitsstrategien.28
Deutschland als Exportnation und die EU als Handelsmacht müssen eine Balance zwischen Außenhandelsfreiheit und außen- und sicherheitspolitisch bedingter Regulierung finden, um privatwirtschaftliches Gewinnstreben mit gesamtgesellschaftlichen Erfordernissen wie Versorgungssicherheit in Einklang zu bringen. Um diesen Balanceakt zu bewältigen, könnte es hilfreich sein, auch mit Partnern außerhalb der EU einige Prinzipien wirtschaftlicher Staatskunst (economic statecraft) in einer ausformulierten Doktrin zu definieren, nach denen sich die Verwendung der jeweiligen Instrumente ausrichten würde. Anders als in den elaborierten Doktrinen für den Einsatz militärischer Gewalt sind Äquivalente für den Gebrauch wirtschaftlicher Macht noch stark entwicklungsbedürftig.29
Nicht zuletzt um machtpolitischem Handeln in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen mehr Legitimität zu verschaffen, sollte der Einsatz wirtschaftlicher und technologischer Instrumente stärker verregelt werden. Die in völkerrechtlichen Abkommen und zwischenstaatlichen Verträgen gemeinhin verankerten Ausnahmen für nationale Sicherheitsinteressen eröffnen einen weiten Graubereich, in dem sich die Anwendung wirtschaftlicher Maßnahmen wie Sanktionen und Exportkontrollen bislang weitgehend einer wirksamen Regulierung entziehen konnte. So könnten bewährte Verfahren (best practices) systematisiert sowie freiwillige Selbstverpflichtungen (soft law) als Vorbild genommen werden (wie etwa die Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von Helsinki), um die Berufung auf einschlägige Ausnahmen für den Schutz wirtschaftlicher und nationaler Sicherheit zu begründen.30 Um eine Zivilisierung der internationalen Beziehungen in der geoökonomischen Zeitenwende nicht aus den Augen zu verlieren, sollte die noch junge Diskussion darüber, wie geoökonomisches Handeln stärker an »verantwortlichen«31 oder »positiven«32 Zielsetzungen ausgerichtet werden könnte, um europäische und deutsche Beiträge bereichert werden. Wirtschaftliche und technologische Transformationen, einschließlich der in dieser Sammelstudie untersuchten Rückkehr von Macht auf den Markt, sind von einem inhärenten Spannungsverhältnis zwischen Interdependenz und Polarität gekennzeichnet, die als »quer zueinander stehende oder auch konkurrierende« Entwicklungslinien internationale Politik wohl auch zukünftig prägen werden.33
Nachwort
Hanns Günther Hilpert / Sascha Lohmann
Mit dieser Sammelstudie werden Arbeitsergebnisse der Diskussionsgemeinschaft zur Themenlinie Wirtschaftliche und technologische Transformationen vorgelegt. Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) hat in ihrem Orientierungsrahmen für die Forschung 2024/20261 insgesamt vier Themenlinien definiert, in denen regionale und funktionale Expertise über drei Jahre hinweg mit dem Zweck gebündelt wird, forschungsgruppenübergreifend politisch dringliche und grundlegende Fragen von großer inhaltlicher Komplexität zu analysieren und daraus Empfehlungen für die politische Praxis abzuleiten. Die Themenlinie Wirtschaftliche und technologische Transformationen widmet sich den umfassenden Veränderungen eines disruptiven wirtschaftlichen und technologischen Wandels, der für deutsche und europäische Politik sowohl Handlungszwänge als auch Handlungsmöglichkeiten bedingt. Wirtschaftlicher und technologischer Wandel sind an sich altbekannte Phänomene. Neu und bemerkenswert ist, wie breit, vielfältig und miteinander verknüpft damit einhergehende Transformationsprozesse gegenwärtig verlaufen. Die sich verändernde Natur der Globalisierung, eine Weltwirtschaft, die sich aufgrund von Gewichtsverschiebungen und zunehmender Instrumentalisierung der Außenwirtschaft immer weiter fragmentiert, rapide Fortschritte in digitalen Querschnittstechnologien sowie steigende Anforderungen wie die Dekarbonisierung einer auf fossile Energieträger angewiesenen Wirtschaft, all dies stellt deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik vor neue komplexe Herausforderungen. Als übergeordnetes Forschungsziel gilt daher, die transformativen Entwicklungen besser zu verstehen, Querverbindungen zwischen einzelnen Prozessen zu identifizieren, die jeweilige Bedeutung für operative Politik herauszuarbeiten und praxisrelevante Lösungsansätze zu skizzieren.
Zu den Fokusthemen der Themenlinie zählen unter anderem die Versicherheitlichung der Wirtschaft einschließlich Versorgungssicherheit und Migration, die Rolle digitaler Technologien und des Cyberraums für Sicherheitsordnungen sowie das Handeln staatlicher Akteure unter Einsatz defensiver und offensiver Instrumente in so unterschiedlichen Bereichen wie Handel, Kapital- und Zahlungsverkehr, Technologie, Energie und Gesundheit. Ein wesentlicher Trend der im Rahmen der Themenlinie bearbeiteten wirtschaftlichen und technologischen Transformationen ist die Rückkehr von Macht auf den Markt. Hierbei werden wechselseitige wirtschaftliche Verflechtungen immer stärker durchdrungen von machtpolitischen Erwägungen wie dem Streben nach Souveränität, Kontrolle und nationaler Sicherheit, jedoch nicht gänzlich ersetzt. Die jeweiligen Strategien und Taktiken staatlicher Machtpolitik, die ausschließlich oder überwiegend mit wirtschaftlichen und technologischen Mitteln operiert, sind Teil einer seit Jahrhunderten geübten Praxis politischer Gemeinschaften. Neu und historisch präzedenzlos sind allerdings die Rahmenbedingungen, unter denen gegenwärtig immer häufiger ökonomische und technologische Mittel eingesetzt werden, um außen- und sicherheitspolitische Ziele zu erreichen.
In den ersten anderthalb Jahren der Themenlinie wurden multiperspektivisch und sektorübergreifend die veränderten Rahmenbedingungen einer globalisierten Wirtschaft im Zeitalter intensivierter Großmächtekonkurrenz sowie rasanter Technologieentwicklungen analysiert, welche unter dem Schlagwort »Geoökonomie« in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft immer breiter und intensiver diskutiert werden. Dafür wurden fundamentale Annahmen, nach denen sich Außen- und Sicherheitspolitik, grenzüberschreitender Handel, Auslandsinvestitionen und Technologietransfer vollziehen, auf den Prüfstand gestellt. Zu konstatieren ist ein Paradigmenwandel in den internationalen Beziehungen, der mit den gängigen liberalen Politik- und Wirtschaftstheorien nur schwer zu erfassen ist. Mit der Ablösung des bislang wirkmächtigen liberalen Paradigmas einer friedensfördernden Wirkung wechselseitiger wirtschaftlicher Verflechtungen auf Grundlage eines effizienten Ressourceneinsatzes stehen vermehrt Risiken im Vordergrund, die aus asymmetrischen Abhängigkeiten resultieren. Um damit einhergehende Chancen und Risiken sowie Kosten und Nutzen fundiert beurteilen und Erfolgsaussichten entsprechender Strategien und Taktiken besser abschätzen zu können, erscheint zunächst eine Konzeptionalisierung geoökonomischen Denkens und Handelns dringend und notwendig.
Die zur Halbzeit der Themenlinie Wirtschaftliche und technologische Transformationen in dieser Sammelstudie präsentierten Arbeitsergebnisse werden unter dem Titel Mehr Macht, weniger Markt auf den Punkt gebracht. Die machtpolitische Durchdringung internationaler Wirtschaftsbeziehungen ist seit langem Gegenstand der SWP-Forschungsagenda und hat sich unter anderem in Arbeiten zu den Themen Ost-West-Handel, Technologietransfer, Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Stärke und außenpolitischer Handlungsfähigkeit, Energie- und Rohstoffpolitik sowie Einsatz von Sanktionen niedergeschlagen. Die Autorinnen und Autoren der Einzelbeiträge bauen auf diesen einschlägigen Vorarbeiten von Kolleginnen und Kollegen aus den vergangenen Jahrzehnten auf. In drei Beiträgen wurde zudem externe Expertise aus Wirtschaft und Wissenschaft hinzugezogen. Den für diese Beiträge verantwortlichen Autorinnen und Autoren sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt.
Anhang
Abkürzungen
|
ACER |
Agency for the Cooperation of Energy Regulators (European Union) |
|
ACI |
Anti-Coercion Instrument (Instrument gegen wirtschaftlichen Zwang) |
|
AEUV |
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
|
AFET |
Committee on Foreign Affairs (Auswärtiger Ausschuss im Europäischen Parlament) |
|
AFME |
Association for Financial Markets in Europe |
|
AI |
Artificial Intelligence |
|
AI Act |
KI-Verordnung |
|
ASEAN |
Association of South East Asian Nations (Verband Südostasiatischer Nationen) |
|
BBC |
British Broadcasting Corporation |
|
BGR |
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Hannover) |
|
BMWK |
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz |
|
BRI |
Belt and Road Initiative |
|
CASE |
Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (Center for Social and Economic Research; Warschau) |
|
CBAM |
Carbon Border Adjustment Mechanism |
|
CBDC |
Central Bank Digital Currency (Digitales Zentralbankgeld) |
|
CEO |
Chief Executive Officer |
|
CGS |
Center for Global Studies (Universität Bonn) |
|
Cerfa |
The Study Committee on Franco-German Relations |
|
CIPS |
Cross-Border Inter-Bank Payments System |
|
CO₂ |
Kohlendioxid |
|
COCOM |
Coordinating Committee on Multilateral Export Controls |
|
COFER |
Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves |
|
CRMA |
Critical Raw Materials Act (Europäisches Rohstoffgesetz) |
|
CSIS |
Center for Strategic and International Studies (Washington, D. C.) |
|
DARPA |
Defense Advanced Research Projects Agency (USA) |
|
DERA |
Deutsche Rohstoffagentur |
|
DEVE |
Committee on Development (Entwicklungsausschuss im Europäischen Parlament) |
|
DG CNECT |
Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien innerhalb der Europäischen Kommission |
|
DG COMP |
Generaldirektion Wettbewerb innerhalb der Europäischen Kommission |
|
DG ECFIN |
Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen innerhalb der Europäischen Kommission |
|
DG GROW |
Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU innerhalb der Europäischen Kommission |
|
DG INTPA |
Generaldirektion Internationale Partnerschaften innerhalb der Europäischen Kommission |
|
DG TRADE |
Generaldirektion Handel und wirtschaftliche Sicherheit innerhalb der Europäischen Kommission |
|
DIHK |
Deutsche Industrie- und Handelskammer |
|
DIW |
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (Berlin) |
|
DMA |
Digital Markets Act |
|
DSR |
Digital Silk Road (digitale Infrastruktur-Strategie Chinas) |
|
DZBG |
Digitales Zentralbankgeld |
|
EAD |
Europäischer Auswärtiger Dienst |
|
ECFR |
European Council on Foreign Relations (London) |
|
e-CNY |
Digitaler Yuan (digitales Zentralbankgeld Chinas) |
|
ECOFIN |
Economic and Financial Affairs Council (Rat Wirtschaft und Finanzen) |
|
ECON |
Committee on Economic and Monetary Affairs (Ausschuss für Wirtschaft und Währung im Europäischen Parlament) |
|
EMPL |
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments |
|
ESG |
Environmental, Social and Governance |
|
EU |
Europäische Union |
|
EZB |
Europäische Zentralbank |
|
FAC |
Rat für Auswärtige Angelegenheiten |
|
FAO |
Food and Agriculture Organization (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) |
|
FOCAC |
Forum on China-Africa Cooperation (Forum für China-Afrika-Kooperation) |
|
G7 |
Gruppe der Sieben (die sieben führenden westlichen Industriestaaten) |
|
G20 |
Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer |
|
GAP |
Gemeinsame Agrarpolitik der EU |
|
GASP |
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (EU) |
|
GATT |
General Agreement on Tariffs and Trade |
|
GIGA |
German Institute for Global and Area Studies (Hamburg) |
|
GIZ |
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit |
|
GPS |
Global Positioning System |
|
HR/VP |
Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik/Vizepräsident der Europäischen Kommission |
|
iCET |
Initiative on Critical and Emerging Technology |
|
IEA |
International Energy Agency |
|
IEEP |
Institute for European Environmental Policy (Brüssel/London) |
|
ILRS |
International Lunar Research Station |
|
IMCO |
Committee on Internal Market and Consumer Protection (Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz im Europäischen Parlament) |
|
IMF |
International Monetary Fund (Internationaler Währungsfonds) |
|
INTA |
Ausschuss für internationalen Handel des Europäischen Parlaments |
|
IoT |
Internet of Things |
|
IP |
Internationale Politik |
|
IStGH |
Internationaler Strafgerichtshof der Vereinten Nationen |
|
ITRE |
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie des Europäischen Parlaments |
|
JURI |
Committee on Legal Affairs (Rechtsausschuss im Europäischen Parlament) |
|
KfW |
Kreditanstalt für Wiederaufbau |
|
KI |
Künstliche Intelligenz |
|
KMU |
Kleine und mittlere Unternehmen |
|
KPCh |
Kommunistische Partei Chinas |
|
LLM |
Large Language Model (Art von KI-Modellen) |
|
LNG |
Liquefied Natural Gas (verflüssigtes Erdgas) |
|
MDB |
Multilateral Development Bank (Multilaterale Entwicklungsbank) |
|
Mercosur |
Mercado Común del Sur (Gemeinsamer Markt des Südens) |
|
METI |
Ministry of Economy, Trade and Industry (Japan) |
|
MoU |
Memorandum of Understanding |
|
MSP |
Minerals Security Partnership |
|
MSSG |
Executive Steering Group on Shortages and Safety of Medicinal Products (Lenkungsgruppe für Engpässe bei Arzneimitteln) |
|
NASA |
National Aeronautics and Space Administration (USA) |
|
OECD |
Organisation for Economic Co-operation and Development (Paris) |
|
OSZE |
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa |
|
PBoC |
People’s Bank of China (Zentralbank Chinas) |
|
PSMC |
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (Taiwan) |
|
RMB |
Renminbi |
|
RUSI |
Royal United Services Institute (London) |
|
SIC |
Space Information Corridor (Komponente der Digitalen Seidenstraße Chinas) |
|
SME |
Small and Medium-Sized Enterprise |
|
SPRIND |
Bundesagentur für Sprunginnovationen (Leipzig) |
|
SVG |
Selbstversorgungsgrad |
|
TRAN |
Ausschuss für Verkehr und Tourismus des Europäischen Parlaments |
|
TSMC |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company |
|
TTC |
Trade and Technology Council (Handels- und Technologierat) |
|
USA |
Vereinigte Staaten von Amerika |
|
USDA |
United States Department of Agriculture |
|
VAE |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
VBA |
Volksbefreiungsarmee (VR China) |
|
VN |
Vereinte Nationen |
|
WHO |
World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation) |
|
WTO |
World Trade Organization (Welthandelsorganisation) |
|
ZTE |
Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited (chinesisches Technologieunternehmen) |
Die Autorinnen und Autoren
Dr. Michael Bayerlein
Health Policy Scientist
Global Health Policy Lab (GHPL), Charité Center for Global Health, Charité Universitätsmedizin Berlin
Dr. habil. Annegret Bendiek
Senior Fellow in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dorothée Falkenberg
Programme Manager, Brüsseler Büro der SWP
Dr. Nadine Godehardt
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Asien, Brüsseler Büro der SWP
Rocco Görhardt
Masterstudent European Studies an der Universität Göteborg, vormals Praktikant in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. Armin Haas
Mitarbeiter der Emmy-Noether-Forschungsgruppe The Political Economy of Financing Large-Scale Transformations am Global Climate Forum, Berlin (GCF)
Dr. Hanns Günther Hilpert
Gastwissenschaftler in der Forschungsgruppe Asien (Ko-Leitung der Themenlinie Wirtschaftliche und technologische Transformationen bis Juni 2025)
Moritz Kapff
Mitarbeiter der Emmy-Noether-Forschungsgruppe The Political Economy of Financing Large-Scale Transformations am Global Climate Forum, Berlin (GCF)
Dr. Sascha Lohmann
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Amerika (Ko-Leitung der Themenlinie Wirtschaftliche und technologische Transformationen)
Prof. Dr. Hanns W. Maull
Non-Resident Senior Fellow der SWP
Dr. Melanie Müller
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten (Ko-Leitung der Themenlinie Kooperation im Kontext systemischer Rivalität)
Dr. Steffen Murau
Leiter der Emmy-Noether-Forschungsgruppe The Political Economy of Financing Large-Scale Transformations am Global Climate Forum, Berlin (GCF)
Dr. Jacopo Maria Pepe
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Globale Fragen
Dr. Christian Pfeiffer
Manager Government Affairs EMEA, Zimmer Biomet; Deputy Director, Zukunft-Fabrik.2050
Dr. agr. Bettina Rudloff
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe EU / Europa (Ko-Leitung der Themenlinie Wirtschaftliche und technologische Transformationen ab Juli 2025
Dr. Tobias Scholz
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Asien
Dr. Angela Stanzel
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Asien
Prof. Dr. iur. Dr. h. c. Peter-Tobias Stoll
Gastwissenschaftler in der Forschungsgruppe Globale Fragen bis Juli 2025 und Professor für öffentliches Recht und Völkerrecht (Internationales Wirtschaftsrecht) an der Georg-August-Universität Göttingen
Juliana Süß
Wissenschaftlerin in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik
Dr. oec. Paweł Tokarski
Wissenschaftler in der Forschungsgruppe EU / Europa
Dr. Pedro Alejandro Villarreal Lizárraga
Gastwissenschaftler in der Forschungsgruppe Globale Fragen
Dr. Daniel Voelsen
Leiter der Forschungsgruppe Globale Fragen und Koordinierender Leiter des Forschungsclusters Cybersicherheit und Digitalpolitik
Literaturhinweise
Hanns W. Maull
Noch Zivilmacht. Die Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland
SWP-Studie 13/2025, September 2025
Alexandra Paulus / Daniel Voelsen
Digitale Abhängigkeit: Welchen Einfluss die Technologie- und Cyberpolitik der USA auf Europa hat
SWP-Podcast P21/2025, 4.9.2025
Eva Willer
Verbindungsländer als außenwirtschaftliche Brückenbauer in der geoökonomischen Zeitenwende
Themenlinie Wirtschaftliche und technologische Transformationen, Arbeitspapier Nr. 01, August 2025
Laura von Daniels
Handels-Krieg und ‑Frieden.
Drei Szenarien und welche Handlungsmöglichkeiten die EU und die Bundesregierung in den Verhandlungen mit US-Präsident Trump haben
SWP-Aktuell 34/2025, Juli 2025
Jacopo Maria Pepe
Energie zwischen Markt und Geopolitik:
Der Fall LNG. Herausforderungen für die EU und Deutschland seit Russlands Krieg in der Ukraine
SWP-Studie 4/2025, März 2025
Bettina Rudloff
Die EU zwischen unilateralen Nachhaltigkeitsansätzen und Handelsabkommen. Wege zu besseren Partnerschaften
SWP-Studie 2/2025, Januar 2025
Inga Carry / Melanie Müller / Meike Schulze
The EU’s External Raw Materials Strategy: Key Field for Action
Research Division Africa and Middle East, Working Paper Nr. 01/2025
Hanns Günther Hilpert / Sascha Lohmann / Hanns W. Maull
Deutschland und die geoökonomische Zeitenwende – kluge Machtpolitik gefragt
In: Barbara Lippert / Stefan Mair (Hg.), Neue Verhältnisse – schwierige Beziehungen. Europa – USA – »Globaler Süden«. SWP-Studie 24/2024, Dezember 2024, S. 43–46
Hanns Günther Hilpert / Paweł Tokarski
Die Digitalisierung des Zentralbankgelds. Chinas Vorpreschen – Europas Zögern
SWP-Aktuell 51/2024, Oktober 2024, 8 Seiten
Hanns Günther Hilpert
SWP-Studie 9/2024, März 2024
Endnoten
- *
-
Die Herausgeber bedanken sich bei Kim Jensen, studentische Hilfskraft der Themenlinie Wirtschaftliche und technologische Transformationen, für die hilfreiche Unterstützung bei Recherche und Formatierung.
- 1
-
Dort bezieht man sich auf die »existierenden geoökonomischen und sicherheitspolitischen Spannungen in der internationalen Politik«. Deutscher Bundestag, 20. Wahlperiode, Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU/CSU. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 109, 115 und 143h), 10.3.2025 (Bundestags-Drucksache 20/15096), S. 1.
- 2
-
Hanns Günther Hilpert/Sascha Lohmann/Hanns W. Maull, »Deutschland und die geoökonomische Zeitenwende – kluge Machtpolitik gefragt«, in: Barbara Lippert/Stefan Mair (Hg.), Neue Verhältnisse – schwierige Beziehungen. Europa – USA – »Globaler Süden«, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Dezember 2024 (SWP-Studie 24/2024), S. 43–46, doi: 10.18449/2024S24; Stefan Fröhlich, Märkte, Macht und Wandel. Deutschlands geoökonomische Zeitenwende, Wiesbaden 2024.
- 3
-
Siehe den Beitrag von Christian Pfeiffer in dieser Studie, S. 19ff. Vgl. auch Felix Mallin/James D. Sidaway, »Critical Geoeconomics: A Genealogy of Writing Politics, Economy and Space«, in: Transactions of the Institute of British Geographers, 49 (2023) 1; David T. Murphy, The Heroic Earth: Geopolitical Thought in Weimar Germany, 1918–1933, Kent, OH, 1997.
- 4
-
Christian Pfeiffer, Geoeconomics in International Relations: Neorealist and Neoliberal Conceptualizations, Abingdon 2024, S. 154–162.
- 5
-
Vgl. Edward N. Luttwak, »From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce«, in: The National Interest, (1990) 20, S. 17–23; Valerie M. Hudson/ Robert E. Ford/David Pack/Eric R. Giordano, »Why the Third World Matters, Why Europe Probably Won’t: The Geoeconomics of Circumscribed Engagement«, in: Journal of Strategic Studies, 14 (1991) 3, S. 255–298.
- 6
-
Vgl. Sören Scholvin/Mikael Wigell, »Geo-Economic Power Politics: An Introduction«, in: Mikael Wigell/Sören Scholvin/ Mika Aaltola, Geo-Economics and Power Politics in the 21st Century: The Revival of Economic Statecraft, Abingdon 2019, S. 1–13 (4–8).
- 7
-
»Geo-Ökonomie bedeutet, die außen- und sicherheitspolitischen Überlegungen auch in die Wirtschaftspolitik mit einzubeziehen.« Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Rede beim Wirtschaftstag der 21. Konferenz der Leiterinnen und Leiter der deutschen Auslandsvertretungen, Berlin, 5.9.2023, <https://www. youtube.com/watch?v=kHImhPvwR6Y> (eingesehen am 13.10.2025); »Interdependenz birgt auch Risiken. Und auf Handel folgt nicht automatisch demokratischer Wandel.« Rede von Außenministerin Annalena Baerbock beim Wirtschaftstag der 20. Konferenz der Leiterinnen und Leiter der deutschen Auslandsvertretungen, Berlin, 6.9.2022, <https:// www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/wirtschaftstag-2550254> (eingesehen am 13.10.2025).
- 8
-
Friedrich Merz, »Außenpolitische Grundsatzrede«, Körber Global Leaders Dialogue, 23.1.2025, <https://koerber-stiftung. de/mediathek/friedrich-merz-zu-aussen-und-europapolitischen-prioritaeten-fuer-deutschland/> (eingesehen am 13.10.2025).
- 9
-
Dieser lässt sich in Abgrenzung zum Wettbewerb definieren als dessen »außerhalb der gesellschaftlichen Moral- und ökonomischen Effizienzvorstellungen stehende[r] Zwilling«. Ulrich Blum, Wirtschaftskrieg. Rivalität ökonomisch zu Ende denken, Wiesbaden 2020, S. 9.
- 10
-
»Wirtschaftsmacht beruht auf der ausgeprägten Fähigkeit, zu lernen, sich selbst zu verändern.« Hanns W. Maull, »Wirtschaftsmacht: Überlegungen zu den Gestaltungsmöglichkeiten Japans und der Bundesrepublik in den internationalen Beziehungen«, in: Albrecht Zunker (Hg.), Weltordnung oder Chaos? Beiträge zur internationalen Politik, Festschrift zum 75. Geburtstag von Professor Klaus Ritter, Baden-Baden 1993 (Internationale Politik und Sicherheit, Bd. 35), S. 302–316 (308); Norbert Kloten, »Die Bundesrepublik als Weltwirtschaftsmacht«, in: Karl Kaiser/Hanns W. Maull (Hg.), Deutschlands neue Außenpolitik, Bd. 1: Grundlagen, 3. Aufl., München 1997 (Internationale Politik und Wirtschaft, Bd. 59), S. 63–80.
- 11
-
Gilbert Ziebura, Weltwirtschaft und Weltpolitik 1922/24–1931. Zwischen Rekonstruktion und Zusammenbruch, Frankfurt a. M. 1984, S. 23–32.
- 12
-
Thomas Oatley, »Toward a Political Economy of Complex Interdependence«, in: European Journal of International Relations, 25 (2019) 4, S. 957–978.
- 13
-
Zu den damit einhergehenden Erkenntnisinteressen wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts intensiv geforscht. Die Ergebnisse sind allerdings weitestgehend verschüttet, nicht zuletzt aufgrund der jeweiligen normativen Prämissen aus Kaiserzeit und Drittem Reich.
- 14
-
»[D]ie Geoökonomisierung globaler Interdependenzen ist ein vielschichtiger und nicht auf die Rückkehr der Geopolitik reduzierbarer Epochenwandel.« Milan Babić, Geoökonomie. Anatomie der neuen Weltordnung, Berlin 2025, S. 16.
- 15
-
»[S]urvival concerns almost always trump prosperity concerns when those goals are in conflict since you cannot prosper if you do not survive.« John J. Mearsheimer, »War and International Politics«, in: International Security, 49 (2025) 4, S. 7–36 (17).
- 16
-
John H. Herz, »Idealist Internationalism and the Security Dilemma«, in: World Politics, 2 (1950) 2, S. 157–180 (163).
- 17
-
Egon Bahr, »Wandel durch Annäherung«, Rede in der Evangelischen Akademie Tutzing, 15.7.1963. Für eine umfassendere Darstellung der friedensfördernden Wirkungen wechselseitiger wirtschaftlicher Verflechtungen siehe exemplarisch John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace, New York 1919, sowie Robert O. Keohane/Joseph S. Nye, Jr., Power and Interdependence, 4. Aufl., Boston u. a. 2012.
- 18
-
»The re-politicisation of the economy signals the end of the context that maintained the economics hegemony witnessed during the neoliberal era or the postwar period of high Keynesianism.« Rune Møller Stahl, »The End of Economics Hegemony? Studying Economic Ideas in a Post-neoliberal World«, in: Review of International Political Economy, 32 (2025) 4, S. 1266–1283 (1278).
- 19
-
So etwa vom Präsidenten der Deutschen Bundesbank: Joachim Nagel, »Geoeconomic Fragmentation: Handling Inflation Pressures and Volatility, Increasing Resilience«, Speech at Tokyo University, 18.11.2024, <https://www. bundesbank.de/en/press/speeches/geoeconomic-fragmen tation-handling-inflation-pressures-and-volatility-increasing-resilience-944408> (eingesehen am 13.10.2025). Siehe auch Shekhar Aiyar u. a., Geoeconomic Fragmentation and the Future of Multilateralism, Washington, D. C.: Internationaler Währungsfonds, 15.1.2023 (Staff Discussion Notes Nr. 2023/001), <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/SDN/2023/ English/SDNEA2023001.ashx> (eingesehen am 13.10.2025).
- 20
-
Elke Thiel, »Zum Verhältnis von Wirtschafts- und Sicherheitspolitik in den atlantischen Beziehungen«, in: Stiftung Wissenschaft und Politik (Hg.), Polarität und Interdependenz. Beiträge zu Fragen internationaler Politik, Baden-Baden 1978, S. 85–96.
- 21
-
Zugespitzt formuliert: »EU policymakers and politicians now pray at the altar of geoeconomics.« Matthias Matthijs/ Sophie Meunier, »Europe’s Geoeconomic Revolution: How the EU Learned to Wield Its Real Power«, in: Foreign Affairs, 102 (2023) 5, S. 168–179 (168).
- 22
-
Statistisches Bundesamt, »Gaspreise für Haushalte im 2. Halbjahr 2024 um 3,5% gestiegen«, Pressemitteilung Nr. 123, Wiesbaden, 31.3.2025, <https://www.destatis.de/DE/ Presse/Pressemitteilungen/2025/03/PD25_123_61243.html>.
- 23
-
Statistisches Bundesamt, »Kennzahlen zur Außenwirtschaft«, Stand 9.10.2024, <https://www.destatis.de/DE/ Themen/Wirtschaft/Globalisierungsindikatoren/Tabellen/01_02_03_44_VGR.html> (eingesehen am 13.10.2025).
- 24
-
Dies betrifft den Rahmen für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Union (3/2019), das Instrument für den Schutz der Union und ihrer Mitgliedstaaten vor wirtschaftlichem Zwang durch Drittländer (11/2023), die Empfehlung des Rates zur Koordinierung der Reaktion – auf Unionsebene – auf Störungen kritischer Infrastrukturen von erheblicher grenzüberschreitender Bedeutung (12/2022) und die gemeinsame Europäische Strategie für wirtschaftliche Sicherheit (9/2023), siehe Europäische Kommission, Gemeinsame Mitteilung an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat und den Rat über eine »Europäische Strategie für wirtschaftliche Sicherheit«, Brüssel, 20.6.2023, JOIN(2023) 20 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023JC0020> (eingesehen am 13.10.2025), zudem den Aktionsplan des Rates zur überarbeiteten EU-Strategie für Maritime Sicherheit (10/2023) sowie die Empfehlung der Kommission über sichere und resiliente Seekabelinfrastrukturen (2/2024).
- 25
-
Hanns W. Maull, Strategische Rohstoffe: Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit des Westens, Berlin/Boston 1987 (Internationale Politik und Wirtschaft, Bd. 53), S. 8.
- 26
-
Peter Rudolf, Sanktionen in der internationalen Politik. Zum Stand der Forschung, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2006 (SWP-Studie 30/2006), <https://www.swp-berlin.org/publikation/sanktionen-in-der-internationalen-politik> (eingesehen am 13.10.2025); ders., Wirkungen und Wirksamkeit internationaler Sanktionen. Zum Stand der Forschung, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, April 2024 (SWP-Studie 13/2024), doi: 10.18449/2024S13.
- 27
-
Hans Kundnani, »Germany as a Geo-economic Power«, in: The Washington Quarterly, 34 (2011) 3, S. 31–45; Stephen F. Szabo, Germany, Russia, and the Rise of Geo-Economics, London 2014; Jens van Scherpenberg, »Wirtschaftliche Reformpolitik – Grundlage außenpolitischer Handlungsfähigkeit«, in: Ausblick: Deutsche Außenpolitik nach Christoph Bertram, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, September 2005 (SWP-Studie), S. 13–17.
- 28
-
Hierbei wird auf einschlägigen Vorarbeiten der Stiftung Wissenschaft und Politik aufgebaut. Vgl. Uwe Nerlich, Großmachtkonkurrenz und Weltwirtschaftsordnung, Ebenhausen: Stiftung Wissenschaft und Politik, 1977.
- *
-
Dieser Beitrag basiert in wesentlichen Teilen auf: Christian Pfeiffer, Geoeconomics in International Relations: Neorealist and Neoliberal Conceptualizations, London 2024.
- 1
-
Vgl. hierzu die Parallelen zum Begriff der »Internationalen Ordnung«, der, wie Hanns W. Maull in seinem Beitrag in dieser Studie (S. 24ff) ausführt, ebenfalls von Ideologien abhängt, welche die Prinzipien, Normen und Regelwerke politischer Ordnungen prägen.
- 2
-
Veit Bachmann/Gerad Toal, »Geopolitics – Thick and Complex. A Conversation with Gerard Toal«, in: Erdkunde – Archive for Scientific Geography, 73 (2019) 2, S. 143–155.
- 3
-
Arthur Dix, »Forderungen des globalen Zeitalters: Geopolitik und Geoökonomie«, in: Weltpolitik & Weltwirtschaft, 1 (1925) 1, S. 34–39 (37).
- 4
-
Arthur Dix, »Wirtschaftsstruktur und Geopolitik«, in: Volkswirtschaftliche Blätter, 26 (1927) 7/9, S. 465–484 (477).
- 5
-
Siehe den Beitrag von Hanns W. Maull in dieser Studie, S. 24ff.
- 6
-
Michael W. Doyle, »Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs«, in: Philosophy & Public Affairs, 12 (1983) 3, S. 205–235.
- 7
-
Robert D. Blackwill/Jennifer M. Harris, War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft, Cambridge, MA, 2016.
- 8
-
Hanns W. Maull weist in seinem Beitrag auf die Gefahr hin, dass Innenpolitik unter das Diktat realer oder imaginierter äußerer Bedrohungen gestellt wird (»Sicherheitsstaatlichkeit«), und zeigt im Abschnitt »Geoökonomische Handlungsoptionen liberaler Demokratien« (S. 28f) alternative Entwicklungspfade auf.
- 9
-
Bruce Douglass, »The Common Good and the Public Interest«, in: Political Theory, 8 (1980) 1, S. 103–117 (109).
- 10
-
Gearóid Ó Tuathail, »Japan as Threat: Geo-economic Discourses on the USA-Japan Relationship in US Civil Society, 1987–1991«, in: Colin H. Williams (Hg.), The Political Geography of the New World Order, London/New York 1993, S. 181–209 (193).
- 11
-
In seinem Beitrag in dieser Studie beschreibt Hanns W. Maull im Abschnitt »Liberale Ordnungen« (S. 25ff) die Grundpfeiler einer liberalen innerstaatlichen Ordnung: Rechtsstaatlichkeit, politische Partizipation durch gewählte Parlamente sowie die Verpflichtung auf Freiheits- und Menschenrechte.
- 12
-
Kim B. Olsen, The Geoeconomic Diplomacy of European Sanctions: Networked Practices and Sanctions Implementation, Leiden 2022, S. 71.
- 13
-
Simon Bulmer/William E. Paterson, Germany and the European Union: Europe’s Reluctant Hegemon?, London 2019, S. 228.
- 14
-
Vgl. hierzu Maulls Ausführungen in seinem Beitrag in dieser Studie, Abschnitt »Geoökonomische Ordnungsentwürfe« (S. 27f), wo er Machtpolitik in Form von Subversion, Zwang und Gewalt als Kennzeichen kurzfristig orientierter geoökonomischer Ordnungsentwürfe hervorhebt.
- 15
-
Siehe auch Hanns W. Maulls Beitrag in dieser Studie, Abschnitt »Liberale Ordnungen« (S. 25ff).
- 16
-
Chinesische Alternative zum westlich-liberalen Washington Consensus, geprägt durch staatlich gelenkte Wirtschaftspolitik und autokratischen Pragmatismus.
- 17
-
Edward Luttwak, »The Coming Global War for Economic Power: There Are No Nice Guys on the Battlefield of Geo-Economics«, in: The International Economy, 7 (1993) 5, S. 18–67 (67).
- 1
-
Edward Luttwak, »From Geopolitics to Geo-Economics. Logic of Conflict, Grammar of Commerce«, in: The National Interest, (1990) 20, S. 17–23 (19). Luttwak schreibt diese Formulierung fiktiv Clausewitz zu.
- 2
-
Diese Aktivitäten sind die Domäne der Wirtschaftsgeographie und der Raumwirtschaftslehre bzw. der New Economic Geography. Zur Bedeutung des Raumes in der Geopolitik vgl. die Beiträge von Nadine Godehardt, S. 30ff, und Christian Pfeiffer, S. 19ff, in dieser Studie.
- 3
-
Vgl. aber Christian Pfeiffer, Geoeconomics in International Relations: Neorealist and Neoliberal Conceptualizations, London/ New York 2024, der zeigen kann, dass es neben den »realistischen« auch »liberale« Entwürfe der Geoökonomie gibt; vgl. auch seinen Beitrag in dieser Studie, S. 19ff.
- 4
-
Vgl. etwa »›Es regiert der reine Tumult‹« (Interview mit Herfried Münkler), in: Süddeutsche Zeitung, 7.3.2025, <https:// www.sueddeutsche.de/kultur/herfried-muenkler-interview-trump-ukraine-li.3185266?reduced=true> (eingesehen am 23.7.2025); Alexander Cooley/Daniel H. Nexon, »Das Ende der liberalen Weltordnung. America First und der Multilateralismus autoritärer Mächte«, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, (Februar 2025) 2, S. 51–58.
- 5
-
Hanns W. Maull, »Die internationale Ordnung: Bestandsaufnahme und Ausblick«, in: SIRIUS, 4 (2020) 1, S. 3–23, doi: 10.1515/sirius-2020-1002.
- 6
-
Es ist somit irreführend, von einer »multipolaren« Weltordnung zu sprechen: Multipolarität beschreibt Machtrelationen zwischen Staaten, definiert aber per se keinerlei inhaltliche Vorgaben einer internationalen Ordnung. Es lassen sich deshalb sehr unterschiedliche multipolare Weltordnungen vorstellen und auch historisch nachweisen. Vgl. Barry Buzan/Richard Little, International Systems in World History. Remaking the Study of International Relations, Oxford 2000; Ulrich Menzel, Die Ordnung der Welt, Frankfurt a.M. 2015.
- 7
-
Diese internationale Ordnung betrifft deshalb genau genommen zwei Gesellschaften – die Weltgesellschaft der derzeit rund acht Milliarden Menschen und die Gesellschaft der rund zweihundert Staaten der Staatengemeinschaft. Die Charta der Vereinten Nationen und das Völkerrecht adressieren beide Gesellschaften.
- 8
-
Hanns W. Maull, »Introduction: The International Order: A Framework for Analysis«, in: ders. (Hg.), The Rise and Decline of the Post-Cold War International Order, Oxford 2018, S. 1–18.
- 9
-
Wally Adeyemo/Joshua Zoffer, »The Global Trading System Needs New Rules, Not Tariffs«, in: The Economist, 25.3.2025, <https://www.economist.com/by-invitation/ 2025/03/25/the-global-trading-system-needs-new-rules-not-tariffs-say-wally-adeyemo-and-joshua-zoffer> (eingesehen am 23.7.2025).
- 10
-
Die erratische Außenhandelspolitik der gegenwärtigen US-Regierung stellt allerdings die Funktion des Dollars als Leitwährung und damit auch die gegenwärtige Währungsordnung in Frage. Vgl. hierzu den Beitrag von Hanns Günther Hilpert und Paweł Tokarski in dieser Studie, S. 90ff.
- 11
-
Steven Levitzky/Lucan A. Way, »Der Staat als Waffe: Trumps kompetitiver Autoritarismus«, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, (März 2025) 3, S. 47–58, <https:// www.blaetter.de/ausgabe/2025/maerz/der-staat-als-waffe-trumps-kompetitiver-autoritarismus> (eingesehen am 23.7.2025).
- 12
-
Ähnlich Milan Babić, Geoökonomie. Anatomie der neuen Weltordnung, Berlin 2025.
- 13
-
Vgl. hierzu G. John Ikenberry/Inderjeet Parmar/Doug Stokes, »Introduction: Ordering the World? Liberal Internationalism in Theory and Practice«, in: International Affairs, 94 (2018) 1, S. 1–5, <https://academic.oup.com/ia/article/ 94/1/1/4762723> (eingesehen am 5.9.2025).
- 14
-
Jeff D. Colgan/Robert O. Keohane, »The Liberal Order Is Rigged«, in: Foreign Affairs, 96 (2017) 3, S. 36–45, <https:// www.foreignaffairs.com/articles/world/2017-04-17/liberal-order-rigged> (eingesehen am 5.9.2025).
- 15
-
Daniel Deudney/G. John Ikenberry, »The Nature and Sources of Liberal International Order«, in: Review of International Studies, 25 (1999) 2, S. 179–196, <https://library. fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/8357287.pdf> (eingesehen am 5.9.2025); G. John Ikenberry, The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order, Princeton, NJ, 2012.
- 16
-
Siehe hierzu den Beitrag von Daniel Voelsen in dieser Studie, S. 36ff.
- 17
-
Siehe hierzu die Beiträge in dieser Studie von Bettina Rudloff und Rocco Görhardt, S. 64ff, sowie von Peter-Tobias Stoll und Dorothée Falkenberg, S. 45ff.
- 18
-
Die innovative Sozialgesetzgebung Bismarcks im wilhelminischen Deutschland illustriert dies. Zur Ideologie des Nationalismus vgl. Anthony D. Smith, Nationalism. Theory, Ideology, History, 2. Aufl., Oxford 2010.
- 19
-
Zur internationalen Ordnungspolitik der Volksrepublik China vgl. Rush Doshi, The Long Game. China’s Grand Strategy to Displace American Order, Oxford 2021.
- 20
-
Kristine Lee/Alexander Sullivan, People’s Republic of the United Nations. China’s Emerging Revisionism in International Organizations, Washington, D. C.: Center for a New American Security, 2019, <https://www.cnas.org/publications/reports/ peoples-republic-of-the-united-nations> (eingesehen am 5.9.2025).
- 21
-
Alexander Cooley, »Russia Stakes Global Ambitions on Regional Dominance«, in: Leslie Vinjamuri (Hg.), Competing Visions of International Order. Responses to US Power in a Fracturing World, London: Chatham House, 2025, S. 22–32, <https:// www.chathamhouse.org/2025/03/competing-visions-international-order> (eingesehen am 5.9.2025).
- 22
-
Eine Ausnahme stellten die Erdölkrisen der 1970er Jahre dar, in denen die Verwundbarkeit der westlichen Industriestaaten gegenüber Versorgungsstörungen zu politischen Gegenmaßnahmen führte, beispielsweise zur Gründung der Internationalen Energieagentur. Diese lässt sich als energiewirtschaftliches Gegenstück zur westlichen Verteidigungsallianz der Nato charakterisieren.
- 23
-
Daniel W. Drezner/Henry Farrell/Abraham L. Newman (Hg.), The Uses and Abuses of Weaponized Interdependence, Washington, D. C., 2021.
- 24
-
Siehe hierzu in dieser Studie die Beiträge von Daniel Voelsen, S. 36ff, Bettina Rudloff und Rocco Görhardt, S. 65ff, sowie von Peter-Tobias Stoll und Dorothée Falkenberg, S. 45ff.
- 25
-
Der Prototyp hierfür sind die USA zur Zeit des Kalten Krieges, aber auch des »globalen Kriegs gegen den Terror« von George W. Bush. Siehe Michael J. Glennon, National Security and Double Government, Oxford 2015; Jane Mayer, The Dark Side. The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on American Ideals, New York 2008; Charlie Savage, Takeover. The Return of the Imperial Presidency and the Subversion of American Democracy, New York 2007.
- 26
-
Hanns W. Maull, Raw Materials, Energy and Western Security, London/Basingstoke 1984, S. 7–49.
- 27
-
Markus K. Brunnermeier, Die resiliente Gesellschaft. Wie wir künftige Krisen besser meistern können, Berlin 2021.
- 28
-
Karl Aiginger/Dani Rodrick, »Rebirth of Industrial Policy and an Agenda for the Twenty-First Century«, in: Journal of Industry, Competition, and Trade, 20 (2020), S. 189–207, doi: 10.1007/s10842-019-00322-3; Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths, Revised Edition, New York 2015.
- 1
-
Zentralität steht für die Machtposition globaler Akteure wie Staaten oder Unternehmen in bestimmten Netzwerkstrukturen oder Ökosystemen. Der Grad der Zentralität eines Akteurs bemisst sich daran, inwieweit er die Netzwerke oder Ökosysteme kontrolliert und beispielsweise von sich abhängig macht. Dabei bleibt der Schwerpunkt oft auf der Machtkomponente. Deutlich niedriger rangiert die Frage, wie die gewonnene Zentralität den Zusammenhang zwischen Macht und Raum neu strukturieren kann. Dabei impliziert der Fokus auf die Zentralität von Akteuren im Grunde bereits eine räumliche Logik, da es häufig weniger um die Kontrolle über klassisches Territorium geht, sondern mehr um die Kontrolle von Netzwerken und Systemen, die über abgegrenzte Gebiete hinausreichen. Vgl. Seth Schindler u. a., »The Second Cold War: US-China Competition for Centrality in Infrastructure, Digital, Production, and Finance Networks«, in: Geopolitics, 29 (2024) 4, S. 1083–1120, doi: 10.1080/ 14650045.2023.2253432.
- 2
-
So ergeben sich Beschreibungen der Geoökonomie als »Studienfach, das die Zusammenhänge zwischen Geopolitik und Ökonomie untersucht.« Siehe bei Cathrin Mohr/Christoph Trebesch, Geoeconomics, Kiel: Kiel Institute for the World Economy, Januar 2025 (Working Paper Nr. 2279), S. 1, <https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Dateiverwaltung/IfW-Publications/fis-import/8fd80157-9e5c-4d8b-96c4-f0f8e2 fca597-KWP_2279.pdf> (zuletzt eingesehen am 6.4.2025).
- 3
-
Siehe zu einer ähnlichen Problematik Susanne Buckley-Zistel, Raum in den Internationalen Beziehungen. Ein Überblick, Wiesbaden 2021, hier bes. S. 8, doi: 10.1007/978-3-658-32951-8. Anknüpfungspunkte bieten Arbeiten aus der Wirtschaftsgeographie, in denen räumliche Faktoren analysiert werden, die für die Wirtschaft eine Rolle spielen, und Raum ebenso als soziales Produkt verstanden wird (zum Beispiel im Rahmen der New Economic Geography). Der Zusammenhang zwischen Raum und Macht bleibt jedoch zumeist vage. Siehe den detaillierten Überblick über verschiedene Raumkonzepte in der Wirtschaftsgeographie von Lech Suwala: »Concepts of Space, Refiguration of Spaces, and Comparative Research: Perspectives from Economic Geography and Regional Economics«, in: Forum: Qualitative Sozialforschung/ Forum: Qualitative Social Research, 22 (2021) 3, doi: 10.17169/fqs-22.3.3789.
- 4
-
Christopher Clayton/Matteo Maggiori/Jesse Schreger, A Framework for Geoeconomics, Stanford, CA: Institute for Economic Policy Research, Januar 2024 (Working Paper Nr. 24/1) <https://siepr.stanford.edu/publications/working-paper/ framework-geoeconomics> (zuletzt eingesehen am 6.4.2025).
- 5
-
Vgl. frühere Texte der politischen und kritischen Geographie, in denen dies problematisiert wird: John Agnew, »The Territorial Trap: The Geographical Assumptions of International Relations Theory«, in: Review of International Political Economy, 1 (1994) 1, S. 53–80, doi: 10.1080/096922 99408434268; Gearóid Ó Tuathail, »Borderless Worlds? Problematising Discourses of Deterritorialisation«, in: Nurit Kliot/David Newman (Hg.), Geopolitics at the End of the Twentieth Century. The Changing World Political Map, London 2001, S. 139–154, doi: 10.4324/9781315039770; Karoline Postel‑Vinay, »The Historicity of the International Region: Revisiting the ›Europe and the Rest‹ Divide«, in: Geopolitics, 12 (2007) 4, S. 555–569, doi: 10.1080/14650040701546046.
- 6
-
Daniel Lambach, »Space, Scale, and Global Politics: Towards a Critical Approach to Space in International Relations«, in: Review of International Studies, 48 (2022) 2, S. 282–300, doi: 10.1017/S026021052100036X.
- 7
-
Siehe die Einleitung zu dieser Studie, S. 7ff.
- 8
-
Siehe hierzu Stuart Elden, »Secure the Volume: Vertical Geopolitics and the Depth of Power«, in: Political Geography, 34 (2013), S. 35–51, doi: 10.1016/j.polgeo.2012.12.009. Für die Kritik an Territorium als einem fixierten Raum siehe Agnew, »The Territorial Trap« [wie Fn. 5].
- 9
-
»Territory can be understood as […] both political and technology in a broad sense: techniques for measuring land and controlling terrain.« Siehe Elden, »Secure the Volume« [wie Fn. 8], S. 36.
- 10
-
Damit rückt auch die Materialität des Raumes in den Vordergrund, beispielsweise bei Li: »The move towards materiality has not only highlighted how the terrain is prefigured in the contestation and control of a state’s territory […] but also that de facto territorial sovereignty is often manifested as the control of ›volume‹ through technoscientific means and governance through ›volumetrics‹ […].« Andy Hanlun Li, »Volumising Territorial Sovereignty: Atmospheric Sciences, Climate, and the Vertical Dimension in 20th Century China«, in: Political Geography, 111 (2024) 103106, S. 1–11 (2), doi: 10.1016/j.polgeo.2024.103106.
- 11
-
Siehe Franck Billé (Hg.), Voluminous States: Sovereignty, Materiality, and the Territorial Imagination, Durham/London 2020, doi: 10.1215/9781478012061.
- 12
-
Siehe den Beitrag von Angela Stanzel und Juliana Süß in dieser Studie, S. 75ff.
- 13
-
Mit dem Ausdruck »terrestrische Falle« verknüpfen die Autoren zwei Annahmen: Zum einen, dass Politik nur auf der Erde stattfindet, und zum anderen, dass Politik den Regeln und Bedingungen lebensfreundlicher Erdbedingungen folgt. Im Zeitalter der volumetrischen Wende beschränken diese Annahmen das Verständnis politischer Prozesse, die sich nun eben auch auf Räume jenseits der Erde ausdehnen. Siehe Enrike van Wingerden/Darshan Vigneswaran, »The Terrestrial Trap: International Relations beyond Earth«, in: Review of International Studies, 50 (2024) 3, S. 600–618, doi: 10.1017/S0260210524000184.
- 14
-
Siehe ebd. Siehe auch den Beitrag von Christian Pfeiffer in dieser Studie, S. 19ff.
- 15
-
Siehe Henry Farrell/Abraham Newman, Underground Empire. How America Weaponized the World Economy, Dublin 2023. Untergrund-Imperium bezieht sich dabei auf die wirtschaftlichen und technologischen Strukturen, die quasi »unsichtbar« den Charakter des Imperiums ausmachen – dies im Gegensatz zu klassischen Eroberungsimperien oder Kolonialmächten.
- 16
-
Dirk van Laak, Alles im Fluss. Die Lebensadern unserer Gesellschaft – Geschichte und Zukunft der Infrastruktur, Frankfurt a.M. 2018.
- 17
-
Siehe zum Prozess der Peripherisierung Manfred Kühn, »Peripheralization: Theoretical Concepts Explaining Socio-Spatial Inequalities«, in: European Planning Studies, 23 (2015) 2, S. 367–378, doi: 10.1080/09654313.2013.862518.
- 18
-
Dies schließt weder die Bereitschaft noch die Modernisierung der Streitkräfte zur Vorbereitung kriegerischer Auseinandersetzungen aus. Wichtig an dieser Stelle ist, dass es eine ganze Reihe nichtmilitärischer Mittel gibt, mit denen China sowohl die eigene Autonomie stärkt als auch zunehmend Abhängigkeiten schafft.
- 19
-
Siehe Gunter Schubert, »Chinas Zukunft – Imperium, nicht Hegemonie«, in: Leviathan, 49 (2021) 4, S. 545–559, doi: 10.5771/0340-0425-2021-4; Tobias ten Brink/Wiebke Rabe, »Imperiale Modernisierung: Der Wandel des chinesischen Entwicklungsmodells«, in: Politikum, 11 (2025) 1, S. 4–13, <https://www.wochenschau-verlag.de/Der-China-Faktor/60133> (eingesehen am 1.8.2025).
- 20
-
Siehe Jesse Rodenbiker, »Ecological Militarization: Engineering Territory in the South China Sea«, in: Political Geography, 106 (2023) 102932, doi: 10.1016/j.polgeo.2023. 102932.
- 21
-
Siehe hierzu Xuewu Gu u. a., China’s Engagement in Africa: Activities, Effects and Trends, Bonn: Center for Global Studies (CGS), Juni 2022 (CGS Global Focus), <https://www.cgs-bonn. de/cms/wp-content/uploads/2022/07/CGS-China_Africa_Study-2022.pdf> (eingesehen am 1.8.2025).
- 1
-
Vgl. als einen Einstieg in die umfassende, wenn auch eher wellenförmig, selbst oft durch technologische Entwicklungen geprägte Debatte u. a. Daniel W. Drezner, »Technological Change and International Relations«, in: International Relations, 33 (2019) 2, S. 286–303.
- 2
-
Vgl. hierzu James C. Scott, Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, New Haven, CT/London 1998.
- 3
-
Siehe beispielhaft Europäische Kommission, Gemeinsames Weißbuch zur europäischen Verteidigung – Bereitschaft 2030, JOIN(2025) 120 final, Brüssel, 19.3.2025, Abschnitt 2, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX %3A52025JC0120&qid=1747980902610>.
- 4
-
Zur konzeptionellen Bestimmung der Begriffe »Geoökonomie« und »Geopolitik« siehe die Einleitung zu dieser Studie von Hanns Günther Hilpert und Sascha Lohmann, S. 7ff., sowie den Beitrag von Christian Pfeiffer, S. 19ff. Siehe auch Daniel Voelsen, »Die geopolitische Vereinnahmung des Digitalen«, in: Internationale Politik (online), 1.11.2020 (IP Special 3/2020), S. 20–25, <https://internationalepolitik.de/de/die-geopolitische-vereinnahmung-des-digitalen> (eingesehen am 12.10.2023).
- 5
-
Vgl. zur räumlichen Dimension geoökonomischer Deutungsmuster auch den Beitrag von Nadine Godehardt in dieser Studie, S. 30ff.
- 6
-
Mit Blick auf deutsche Bundesregierungen sei hier beispielhaft verwiesen auf die erstmals 2018 veröffentlichte Strategie Künstliche Intelligenz, die Blockchain-Strategie von 2019 und das Handlungskonzept Quantentechnologien von 2023. Vgl. auch den Beitrag von Annegret Bendiek und Tobias Scholz in dieser Studie, S. 81ff. Für einen Einblick in ausgewählte KI-Strategien siehe Laura Galindo/Karine Perset/ Francesca Sheeka, An Overview of National AI Strategies and Policies, Paris: OECD, 2021 (OECD Going Digital Toolkit Notes), doi: 10.1787/c05140d9-en.
- 7
-
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), »About DARPA«, <https://www.darpa.mil/about> (eingesehen am 17.7.2025).
- 8
-
SPRIND GmbH, »Unsere zweite Gründerzeit«, SPRIND Magazin (online), 4.12.2024, <https://www.sprind.org/worte/ magazin/unsere-zweite-gruenderzeit> (eingesehen am 17.7.2025).
- 9
-
Ingeborg Maus, Über Volkssouveränität. Elemente einer Demokratietheorie, Berlin 2019.
- 10
-
Vgl. hierzu auch die Einleitung zu dieser Studie von Hanns Günther Hilpert und Sascha Lohmann, S. 7ff.
- 11
-
Michael C. Horowitz, »What to Know about the New U.S. AI Diffusion Policy and Export Controls«, Council on Foreign Relations (Blog), 13.1.2025, <https://www.cfr.org/blog/ what-know-about-new-us-ai-diffusion-policy-and-export-controls> (eingesehen am 17.7.2025).
- 12
-
Chris Miller, Chip War. The Fight for the World’s Most Critical Technology, London/New York/Sydney/Toronto/New Delhi 2022.
- 13
-
Matthias Schulze/Daniel Voelsen, »Einflusssphären der Digitalisierung«, in: Barbara Lippert/Volker Perthes (Hg.), Strategische Rivalität zwischen USA und China. Worum es geht, was es für Europa (und andere) bedeutet, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Februar 2020 (SWP-Studie 1/2020), S. 32–36.
- 14
-
»Microsoft verspricht Europa Schutz vor politischen Risiken«, in: Handelsblatt (online), 30.4.2025, <https:// www.handelsblatt.com/technik/it-internet/handelskonflikt-microsoft-verspricht-europa-schutz-vor-politischen-risiken/100125166.html> (eingesehen am 17.7.2025).
- 15
-
Zeyi Yang, »Why the Chinese Government Is Sparing AI from Harsh Regulations – for Now«, in: MIT Technology Review (online), 9.4.2024, <https://www.technologyreview.com/ 2024/04/09/1091004/china-tech-regulation-harsh-zhang/> (eingesehen am 18.7.2025).
- 16
-
Cecilia Kang, »Biden Administration Sprints to Tie Up Tech Loose Ends«, in: New York Times (online), 10.12.2024, <https://www.nytimes.com/2024/12/10/technology/biden-tech-regulation.html> (eingesehen am 18.7.2025).
- 17
-
Ausführlicher dazu: Daniel Voelsen, Technologiepolitik unter Trump II. Der einstige Partner wird zur Gefahr für Europas Wirtschaft und Demokratie, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, April 2025 (SWP-Aktuell 14/2025), doi: 10.18449/ 2025A14.
- 18
-
Vgl. hierzu auch den Beitrag von Peter-Tobias Stoll und Dorothée Falkenberg in dieser Studie, S. 45ff.
- 1
-
Robert D. Blackwill/Jennifer M. Harris, War by Other Means. Geoeconomics and Statecraft, Cambridge, MA, 2016, S. 9, doi: 10.2307/j.ctt1c84cr7.
- 2
-
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), Artikel 207 Absatz 1, in: Amtsblatt, Nr. 115, 9.5.2008, S. 140f, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/ HTML/?uri=CELEX:12008E207>.
- 3
-
Johan Adriaensen/Evgeny Postnikov (Hg.), A Geo‐economic Turn in Trade Policy? EU Trade Agreements in the Asia‐Pacific, Cham 2022, doi: 10.1007/978-3-030-81281-2; Anthea Roberts/ Henrique Choer Moraes/Victor Ferguson, »Toward a Geoeconomic Order in International Trade and Investment«, in: Journal of International Economic Law, 22 (2019) 4, S. 655–676, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3389163>.
- 4
-
Im Sinne des Kompass für Wettbewerbsfähigkeit, der die Arbeit der Kommission in der laufenden Legislatur (2024–2029) leiten soll. Europäische Kommission, Ein Kompass für eine wettbewerbsfähige EU, COM(2025) 30 final, Brüssel, 29.1.2025, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/ ?uri=CELEX%3A52025DC0030>.
- 5
-
Peter-Tobias Stoll, »Secondary Economic Sanctions. What Role for the WTO?«, in: Tom Ruys/Cedric Ryngaert/Felipe Rodríguez Silvestre (Hg.), The Cambridge Handbook of Secondary Sanctions and International Law, Cambridge 2024, S. 241–264 (255 ff), doi: 10.1017/9781009365840.
- 6
-
Tobias Stoll, Die Freihandelsabkommen der EU. Neue Herausforderungen und Potentiale, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Juni 2025 (SWP‑Studie 9/2025), doi: 10.18449/ 2025S09.
- 7
-
Lars Brozus/Felix Heiduk/Daniel Voelsen, Verlässliche Partnerschaften in der internationalen Politik. Deutschlands Partner, Partner Deutschland, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Mai 2025 (SWP‑Studie 8/2025), doi: 10.18449/2025S08.
- 1
-
Vgl. Hanns W. Maull, Oil and Influence: The Oil Weapon Examined, London: International Institute for Strategic Studies, 1975.
- 2
-
Siehe auch den Beitrag von Peter-Tobias Stoll und Dorothée Falkenberg in dieser Studie, S. 45ff.
- 3
-
Jacopo Maria Pepe, Energie zwischen Markt und Geopolitik: Der Fall LNG. Herausforderungen für die EU und Deutschland seit Russlands Krieg in der Ukraine, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, März 2025 (SWP-Studie 4/2025), S. 8–9, doi: 10.18449/2025S04. Insbesondere zu den russisch-deutschen Energiebeziehungen aus einer geoökonomischen Perspektive siehe Stephen Szabo, Germany, Russia, and the Rise of Geo-Economics, London u. a.: Bloomsbury, 2014.
- 4
-
International Energy Agency (IEA), Energy Supply Security. Emergency Response of IEA Countries, Paris, Juni 2014, S. 13, <https://iea.blob.core.windows.net/assets/73908149-4d6e-4f10-b626-d55c60ab3bd7/ENERGYSUPPLYSECURITY2014.pdf> (eingesehen am 27.6.2025).
- 5
-
Mathieu Blondeel/Michael J. Bradshaw/Gavin Bridge/ Caroline Kuzemko, »The Geopolitics of Energy System Transformation: A Review«, in: Geography Compass, 15 (2021) 7, S. 1–22.
- 6
-
Thijs van de Graaf/Benjamin K. Sovacool, Global Energy Politics, Cambridge 2020, S. 54–64.
- 7
-
Jacopo Maria Pepe, Geopolitik und Energiesicherheit in Europa: Wie geht es weiter?, Brüssel: FES JustClimate, 2023, S. 9–13.
- 8
-
»Der europäische Grüne Deal. Erster klimaneutraler Kontinent werden«, Brüssel: Europäische Kommission (online), 2019, <https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/ priorities-2019-2024/european-green-deal_de> (eingesehen am 15.4.2025); Maria Pastukhova/Jacopo Maria Pepe/Kirsten Westphal, Die EU-Energiediplomatie – Aufwertung und Neuausrichtung für eine neue Ära, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Juli 2025 (SWP-Aktuell 65/2020), doi: 10.18449/ 2020A65.
- 9
-
Statista, Dependency on Natural Gas Imports in the European Union from 1990 to 2023, 18.7.2025, <https://www.statista. com/statistics/1293942/natural-gas-import-dependency-in-the-european-union/>; Statistisches Bundesamt (Destatis), Energieabhängigkeit der EU, Berlin, 21.1.2025, <https://www.destatis. de/Europa/DE/Thema/Umwelt-Energie/Energieabhaengigkeit. html?utm_source>; Umweltbundesamt, Primärenergiegewinnung und -importe, Berlin, 20.12.2024, <https://www.umwelt bundesamt.de/daten/energie/primaerenergiegewinnung-importe> (eingesehen jeweils am 5.9.2025).
- 10
-
European Commission, »Commission Supports European Photovoltaic Manufacturing Sector with New European Solar Charter«, Brüssel, 15.4.2024, <https://energy.ec.europa. eu/news/commission-supports-european-photovoltaic-manufacturing-sector-new-european-solar-charter-2024-04-15_en> (eingesehen am 15.4.2025); Dawud Ansari/Julian Grinschgl/Jacopo Maria Pepe, Elektrolyseure für die Wasserstoffrevolution, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Oktober 2022 (SWP-Aktuell 58/2022), doi: 10.18449/2022A58.
- 11
-
Statista, Number of LNG Import Terminals in Europe by Type in 2023, 18.3.2025, <https://www.statista.com/statistics/ 1101746/lng-import-terminals-by-type-europe/> (eingesehen am 15.4.2025); Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), Market Monitoring Report 2024: Analysis of the European LNG Market Developments, Ljubljana, 19.4.2024, S. 22.
- 12
-
Europäische Kommission, REPowerEU: Ein Plan zur raschen Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland und zur Beschleunigung des ökologischen Wandels, Brüssel, 18.5.2022, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ api/files/document/print/de/ip_22_3131/IP_22_3131_DE.pdf> (eingesehen am 15.4.2025).
- 13
-
Europäische Kommission, »EU investiert mehr als 1,2 Mrd. EUR in grenzüberschreitende Infrastruktur«, Pressemitteilung, Brüssel, 31.1.2025, <https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/de/ip_25_377> (eingesehen am 15.4.2025).
- 14
-
European Commission, Critical Raw Materials Act, <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/critical-raw-materials-act_en>; dies., Deal für eine saubere Industrie. Ein Plan für eine wettbewerbsfähige und klimaneutrale EU, Brüssel, 26.2.2025, <https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/clean-industrial-deal_de> (eingesehen jeweils am 15.4.2025).
- 15
-
Jacopo Maria Pepe, »Der Schutz kritischer maritimer Energieinfrastrukturen: Bedeutung, Risiken, Prioritäten«, in: Daniel Voelsen (Hg.), Maritime kritische Infrastrukturen. Strategische Bedeutung und geeignete Schutzmaßnahmen, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Februar 2024 (SWP-Studie 3/2024), S. 27–37, doi: 10.18449/2024S03.
- 16
-
»Opening Statement of Commissioner Jørgensen in the European Parliament Plenary Debate on Accelerating the Phase-out of Russian Gas and Other Russian Energy Commodities in the EU«, European Commission, Straßburg, 12.3.2025, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ detail/en/speech_25_764> (eingesehen am 15.4.2025).
- 17
-
Siehe auch den Beitrag von Daniel Voelsen in dieser Studie, S. 36ff.
- 18
-
European Commission, Critical Infrastructure and Cybersecurity, <https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/ critical-infrastructure-and-cybersecurity_en> (eingesehen am 15.4.2025); Europäische Union, »Verordnung (EU) 2019/452 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 zur Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen in der Union«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (21.3.2019) L 79 I/1, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019 R0452>; sowie »Richtlinie (EU) 2022/2557 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über die Resilienz kritischer Einrichtungen«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (27.12.2022) L 333, S. 164–196, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022 L2557> (eingesehen am 15.4.2025).
- 19
-
»Delegierte Verordnung (EU) 2023/1184 der Kommission vom 10. Februar 2023 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates durch die Festlegung einer Unionsmethode mit detaillierten Vorschriften für die Erzeugung flüssiger oder gasförmiger erneuerbarer Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs für den Verkehr«, in: Amtsblatt der Europäischen Union, (20.6.2023) L 157, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:32023R1184>; »Delegierte Verordnung (EU) 2023/1185 der Kommission vom 10. Februar 2023 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung eines Mindestschwellenwertes für die Treibhausgaseinsparungen durch wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe und einer Methode zur Ermittlung der Treibhausgaseinsparungen durch flüssige oder gasförmige erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs für den Verkehr sowie durch wiederverwertete kohlenstoffhaltige Kraftstoffe«, in: ebd., <https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32023R1185> (eingesehen jeweils am 15.4.2025).
- 1
-
Inga Carry/Nadine Godehardt/Melanie Müller, Die Zukunft europäisch-chinesischer Rohstofflieferketten. Drei Szenarien für das Jahr 2030 – und was sich daraus ergibt, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, März 2023 (SWP-Aktuell 15/2023), doi: 10.18449/2023A15.
- 2
-
Deutsche Rohstoffagentur (DERA), »Rohstoffe in China«, Berlin, 16.6.2025, <https://www.bgr.bund.de/DERA/DE/ Laufende-Projekte/Rohstoffpotenzialbewertung/Rohstoffe %20in%20China/lp-china_node.html> (eingesehen am 16.6.2025).
- 3
-
Cornelius Bähr u. a., Kritisch für die Wertschöpfung – Rohstoffabhängigkeit der deutschen Wirtschaft, Frankfurt a.M./Köln/ Karlsruhe, 1.3.2024 (Studie für die KfW-Bankengruppe), S. 28, <https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzern themen/Research/PDF-Dokumente-Studien-und-Materialien/ Studie-Rohstoffabhaengigkeit_IWC_ISI.pdf> (eingesehen am 27.6.2025).
- 4
-
Carry/Godehardt/Müller, Die Zukunft europäisch-chinesischer Rohstofflieferketten [wie Fn. 1].
- 5
-
Europäische Kommission, »Critical Raw Materials«, 16.6.2025 (Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs), <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/ raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_ en#fifth-list-2023-of-critical-raw-materials-for-the-eu> (eingesehen am 16.6.2025).
- 6
-
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Eckpunktepapier: Wege zu einer nachhaltigen und resilienten Rohstoffversorgung, Berlin, 3.1.2023 (Rohstoffe und Ressourcen), <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/ Downloads/E/eckpunktepapier-nachhaltige-und-resiliente-rohstoffversorgung.html> (eingesehen am 16.6.2025).
- 7
-
Melanie Müller, »Das große Graben«, in: Internationale Politik, (2024) 2, S. 18–24.
- 8
-
Meike Schulze, Rohstoffversorgung in Zeiten geoökonomischer Fragmentierung. Die EU muss die außenpolitische Dimension ihrer Rohstoffpolitik stärken, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, April 2024 (SWP-Aktuell 22/2024), doi: 10.18449/ 2024A22.
- 9
-
Europäische Kommission, »Selected Strategic Projects under the CRMA«, Brüssel 2025 (Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs), <https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma/selected-projects_en> (eingesehen am 16.6.2025).
- 10
-
Europäische Kommission, »47 strategische Projekte ausgewählt: Zugang zu kritischen Rohstoffen sichern und diversifizieren«, Pressemitteilung, Brüssel, 25.3.2025, <https://germany.representation.ec.europa.eu/news/47-strategische-projekte-ausgewahlt-zugang-zu-kritischen-rohstoffen-sichern-und-diversifizieren-2025-03-25_de> (eingesehen am 16.6.2025).
- 11
-
Felix Dorn, »Lithium aus Portugal: Unsere Energiewende, ihr Problem«, in: Spektrum (online), 21.12.2023, <https://www.spektrum.de/news/rohstoffe-lithiumbergbau-in-portugal-entzweit-die-gemueter/2202120> (eingesehen am 16.6.2025); Oliver Noyan, »Lokaler Widerstand als Hindernis für EU-Pläne für kritische Rohstoffe«, in: Euractiv (online), 13.1.2023, <https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/lokaler-widerstand-als-hindernis-fuer-eu-plaene-fuer-kritische-rohstoffe/> (eingesehen am 16.6.2025); Karl Urban, »Kritische Metalle: Die Energiewende bekommt ein Rohstoffproblem«, in: Spektrum (online), 3.4.2022, <https://www.spektrum.de/news/fuer-die-energiewende-werden-die-rohstoffe-knapp/2005387> (eingesehen am 16.6.2025).
- 12
-
Emma Watkins/Emma Bergeling/Eline Blot, Circularity and the European Critical Raw Materials Act. How Could the CRMA Better Promote Material Circularity?, Brüssel/London: Institute for European Environmental Policy (IEEP), Oktober 2023 (Briefing), S. 11, <https://ieep.eu/wp-content/uploads/2023/10/ Circularity-and-the-European-Critical-Raw-Materials-Act-IEEP-2023.pdf> (eingesehen am 27.6.2025).
- 13
-
Simon M. Jowitt/Timothy T. Werner/Zhehan Weng/Gavin M. Mudd, »Recycling of the Rare Earth Elements«, in: Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 13 (2018), S. 1–7.
- 14
-
Vasileios Rizos/Edoardo Righetti/Amin Kassab, »Understanding the Barriers to Recycling Critical Raw Materials for the Energy Transition: The Case of Rare Earth Permanent Magnets«, in: Energy Reports, 12 (2024), S. 1673–1682.
- 15
-
Samuel Carrara/Patrícia Alves Dias/Beatrice Plazzotta/ Claudiu Pavel, Raw Materials Demand for Wind and Solar PV Technologies in the Transition towards a Decarbonised Energy System, Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2020, doi: 10.2760/160859.
- 16
-
Frédéric Simon, »Kritische Rohstoffe: Recycling laut Industrie ›kein Allheilmittel‹«, in: Euractiv (online), 8.3.2023, <https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/ kritische-rohstoffe-recycling-laut-industrie-kein-allheilmittel/> (eingesehen am 16.6.2025); European Court of Auditors (Hg.), EU Action on Ecodesign and Energy Labelling: Important Contribution to Greater Energy Efficiency Reduced by Significant Delays and Non-compliance, Brüssel: Europäische Union, 2020 (Special Report, Nr. 01/2020), <https://www.eca.europa.eu/Lists/ ECADocuments/SR20_01/SR_Ecodesign_and_energy_labels_ EN.pdf> (eingesehen am 27.6.2025).
- 17
-
Lee Bailey/Laury Haytayan/Thomas Scurfield, »As Saudi Arabia and the UAE Expand Foreign Mining Interests, How Can Producing Countries Prepare?«, 17.9.2024 (Blog Post), <https://resourcegovernance.org/articles/saudi-arabia-and-uae-expand-foreign-mining-interests-how-can-producing-coun tries-prepare> (eingesehen am 16.6.2025); Meike Schulze/ Mark Schrolle, Saudi-Arabien: Aufstrebender Akteur in mineralischen Lieferketten. Kein sicherer Pfeiler für Europas Diversifizierungsstrategie, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Oktober 2024 (SWP-Aktuell 54/2024), doi: 10.18449/2024A54.
- 18
-
United States Department of State, »Minerals Security Partnership«, Washington, D. C., 8.1.2025, <https://2021-2025.state.gov/minerals-security-partnership/> (eingesehen am 16.6.2025).
- 19
-
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), »Diversifizierung der Lieferketten kann vorteilhaft für Unternehmenserfolg sein«, Pressemitteilung, Berlin, 15.11.2023, <https://www.diw.de/de/diw_01.c.885249.de/ diversifizierung_der_lieferketten_kann_vorteilhaft_fuer_ unternehmenserfolg_sein.html> (eingesehen am 16.6.2025); Galina Kolev-Schaefer u. a., Resilienz der deutschen Lieferketten nach der Zeitenwende, Berlin/Köln 2025 (Studie des EPICO KlimaInnovation e. V. in Zusammenarbeit mit dem Institut der deutschen Wirtschaft), <https://www.iwkoeln.de/ studien/galina-kolev-schaefer-juergen-matthes-thilo-schaefer-resilienz-der-deutschen-lieferketten-nach-der-zeitenwende. html> (eingesehen am 27.6.2025).
- 20
-
»Deutsche Unternehmen investieren noch stärker in China«, Tagesschau (online), 13.8.2024, <https://www. tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/deutsche-direkt investitionen-china-100.html> (eingesehen am 16.6.2025).
- 21
-
Ernst & Young (EY) (Hg.), Staatliche Instrumente zur Erhöhung der Versorgungssicherheit von mineralischen Rostoffen, o. O., 31.8.2022 (Endbericht), <https://www.bmwk.de/ Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/studie-staatliche-instrumente-versorgungssicherheit.pdf?__blob= publicationFile&v=4> (eingesehen am 27.6.2025); Hanns Günther Hilpert/Stormy-Annika Mildner, »Problemstellung und Empfehlungen«, in: dies. (Hg.), Nationale Alleingänge oder internationale Kooperation? Analyse und Vergleich der Rohstoffstrategien der G20-Staaten, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik/Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), 7.2.2013 (SWP-Studie 1/2013), S. 7–9 (9), <https:// www.swp-berlin.org/publikation/rohstoffstrategien-der-g20-staaten> (eingesehen am 16.6.2025); »Wenn schon der Staat Rohstofflager plant, ist die Idee vielleicht nicht so schlecht!«, Noble BC, 16.6.2023, <https://noble-bc.de/insights/news/wenn-schon-der-staat-rohstofflager-plant-ist-die-idee-vielleicht-nicht-so-schlecht> (eingesehen am 17.6.2025).
- 22
-
Siehe den Beitrag von Bettina Rudloff und Rocco Görhardt in dieser Studie, S. 64ff.
- 23
-
Gabriel Felbermayr, »Gleichgewicht des Schreckens: Wann Zölle hilfreich sein können«, in: WirtschaftsWoche (online), 6.8.2024, <https://www.wiwo.de/politik/ausland/ handelsstreit-gleichgewicht-des-schreckens-wann-zoelle-hilfreich-sein-koennen/29923878.html> (eingesehen am 16.6.2025).
- 24
-
Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) (Hg.), Diversifizierung von Lieferketten, Berlin, April 2024 (DIHK-Ideenpapier), <https://www.dihk.de/resource/blob/116726/ 003faf3406551196866dc1e7dbebc1ed/dihk-ideenpapier-diversifizierung-data.pdf> (eingesehen am 27.6.2025).
- 25
-
Europäische Kommission, »Gemeinsamer Gaseinkauf: Erste Ausschreibung gestartet«, Pressemitteilung, Brüssel, 10.5.2023, <https://germany.representation.ec.europa.eu/ news/gemeinsamer-gaseinkauf-erste-ausschreibung-gestartet-2023-05-10_de> (eingesehen am 16.6.2025).
- 1
-
Johann Heinrich von Thünen, Der isolirte Staat in Beziehung auf Landwirthschaft und Nationalökonomie, Bd. 1, 2. Aufl., Rostock 1842, S. 384.
- 2
-
Wilhelm Abel, Geschichte der deutschen Landwirtschaft vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, Stuttgart 1962 (Deutsche Agrargeschichte, Bd. 2).
- 3
-
Robert. E. Evenson/Douglas Gollin, »Assessing the Impact of the Green Revolution, 1960 to 2000«, in: Science, 300 (2003) 5620, S. 758–762; Jennifer Clapp, Titans of Industrial Agriculture. How a Few Giant Corporations Came to Dominate the Farm Sector and Why It Matters, Cambridge, MA, 2025, doi: 10.7551/ mitpress/15661.001.0001.
- 4
-
Theodora Karanisa/Yasmine Achour/Ahmed Ouammi/ Sami Sayadi, »Smart Greenhouses as the Path towards Precision Agriculture in the Food-Energy and Water Nexus: Case Study of Qatar«, in: Environment Systems and Decisions, 42 (2022), S. 521–546, doi: 10.1007/S10669-022-09862-2.
- 5
-
Thomas Hobbes, Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Commonwealth Ecclesiastical and Civil, Kap. 24: »Of the Nutrition, and Procreation of a Commonwealth«, Project Gutenberg, E-Book, 2021 (Erstveröffentlichung 1651); Carl von Clausewitz, Vom Kriege, hg. Oliver Corff, Berlin: Clausewitz-Gesellschaft, 2010, Buch 6, S. 297 und S. 374, <https:// www.clausewitz-gesellschaft.de/wp-content/uploads/2014/12/ VomKriege-a4.pdf> (eingesehen am 22.4.2025).
- 6
-
Sarah Luisa Brand, Das Recht auf Nahrung in bewaffneten Konflikten, Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte, September 2024 (Information Nr. 50), S. 6, <https://www. institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/ Publikationen/Information/Information_Das_Recht_auf_ Nahrung_in_bewaffneten_Konflikten.pdf> (eingesehen am 22.4.2025).
- 7
-
Jana Wiedemann, »Krisenresilienz der deutschen Ernährungsnotfallvorsorge im Kontext von Pandemie und Ukraine-Krieg«, in: Anna Daun/Thomas Jäger/Dirk Freudenberg (Hg.), Politisches Krisenmanagement, Bd. 4: Gleichzeitigkeit – Zusammenwirken – Kontrolle, Wiesbaden 2024, S. 223–245, doi: 10.1007/978-3-658-44002-2.
- 8
-
Lukas Kornher/Kristina Mensah/Luis Czilwa/Bettina Rudloff, »Ernährungssicherheit in globalisierten Märkten in Zeiten geopolitischer Unsicherheit – Konzepte, geostrategische Ansätze und Szenarien«, in: Die Zukunft der Agrarwirtschaft. Ernährungssicherheit, Innovation und Transformation im globalen Kontext, Frankfurt a.M.: Edmund Rehwinkel-Stiftung der Landwirtschaftlichen Rentenbank, 2025 (Schriftenreihe der Rentenbank, Bd. 41), S. 7–60, <https://www.rentenbank. de/export/sites/rentenbank/dokumente/Rentenbank_Schriftenreihe_Band41.pdf> (eingesehen am 20.6.2025); Jennifer Clapp, »Food Self-Sufficiency: Making Sense of It, and When It Makes Sense«, in: Food Policy, 66 (Januar 2017), S. 88–96, doi: 10.1016/j.foodpol.2016.12.001.
- 9
-
Emily Zarevich, »The Flour War«, in: JSTOR Daily, 1.3.2024, <https://daily.jstor.org/the-flour-war/> (eingesehen am 30.4.2025); John Bohstedt, »Food Riots and the Politics of Provisions from Early Modern Europe and China to the Food Crisis of 2008«, in: The Journal of Peasant Studies, 43 (2016) 5, S. 1035–1067, doi: 10.1080/03066150.2016.1170009.
- 10
-
Bettina Rudloff/Kristina Mensah/Christine Wieck/ Olayinka Kareem/Jose Ma Luis Montesclaros/David Orden/ Neils Sonddergaard/Wusheng Yu, Geostrategic Aspects of Policies on Food Security in the Light of Recent Global Tensions: Insights from Seven Countries, International Agricultural Trade Research Consortium, September 2024, doi: 10.22004/ag.econ.343001.
- 11
-
Zarevich, »The Flour War« [wie Fn. 9].
- 12
-
Europäische Kommission, EU Agricultural Outlook, 2024–2035, Brüssel: Directorate-General for Agriculture and Rural Development, 2024, <https://agriculture.ec.europa.eu/ document/download/48b04248-de6c-4608-bbcf-f2c9e0e d9d2b_en?filename=agricultural-outlook-2024-report_ en.pdf> (eingesehen am 20.6.2025).
- 13
-
Europäische Kommission, State of Food Security in the EU: A Qualitative Assessment of Food Supply and Food Security in the EU within the Framework of the EFSCM, Spring 2025 – Nr. 4, April 2025, S. 4, <https://agriculture.ec.europa.eu/document/ download/908f9e34-1881-4f4d-99f8-7d34ebb9b94e_en? filename=efscm-assessment-spring-2025_en.pdf> (eingesehen am 19.8.2025).
- 14
-
Für Migration etwa Ahmad Sadiddin/Andrea Cattaneo/ Marinella Cirillo/Meghan Miller, »Food Insecurity as a Determinant of International Migration: Evidence from Sub-Saharan Africa«, in: Food Security, 11 (2019), S. 515–530; Bettina Rudloff, »Aufstand der Ausgehungerten. Preisexplosionen, Versorgungskrisen, Hungeraufstände: Was wir tun können«, in: Internationale Politik, 9 (2009), S. 38–44, <https:// internationalepolitik.de/system/files/article_pdfs/11_Rudloff. pdf> (eingesehen am 18.8.2025); Naomi Hossain/Patta Scott-Villiers, »How ›Food Riots‹ Work, and Why They Matter for Development«, in: Naomi Hossain/Patta Scott-Villiers (Hg.), Food Riots, Food Rights and the Politics of Provisions, London 2017, S. 177–194, doi: 10.4324/9781315175249-9.
- 15
-
Fabio Parasecoli/Mihai Varga, »War in the Ukrainian Fields: The Weaponization of International Wheat Trade«, in: Economic Sociology. Perspectives and Conversations, 24 (2023) 2, S. 4–12.
- 16
-
Ronjini Ray/Jamshed Ahmad Siddiqui, »Unilateral Economic Sanctions and Food Security«, in: Journal of International Trade Law and Policy, 22 (2023) 3, S. 229–246; Dapo Akande/ Emanuela-Chiara Gillard, »Conflict-Induced Food Insecurity and the War Crime of Starvation of Civilians as a Method of Warfare. The Underlying Rules of International Humanitarian Law«, in: Journal of International Criminal Justice, 17 (2019) 4, S. 753–779.
- 17
-
Bettina Rudloff, »Nahrungsversorgungsrisiken im Sanktionsumfeld strategisch begrenzen«, in: Janis Kluge (Koord.), Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Internationale Perspektiven und globale Auswirkungen, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 11.7.2022 (360 Grad), <https://www.swp-berlin.org/ publikation/wirtschaftssanktionen-gegen-russland-internationale-perspektiven-und-globale-auswirkungen> (eingesehen am 28.7.2025).
- 18
-
John Reidy, »Saudi Arabia to Import More Wheat«, in: World Grain, 22.10.2024, <https://www.world-grain.com/ articles/20614-saudi-arabia-to-import-more-wheat> (eingesehen am 20.6.2025); United States Department of Agriculture (USDA), Foreign Agricultural Service, Grain and Feed Update – Algeria, 23.1.2025, <https://apps.fas.usda.gov/ newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain%20and%20Feed%20Update_Algiers_Algeria_AG2025-0001.pdf> (eingesehen am 28.7.2025); USDA, Foreign Agricultural Service, Grain and Feed Update – Nigeria, 2.10.2024, <https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/Download ReportByFileName?fileName=Grain%20and%20Feed%20 Update_Lagos_Nigeria_NI2024-0012.pdf> (eingesehen am 28.7.2025); USDA, Foreign Agricultural Service, Grain and Feed Update – Morocco, 23.1.2025, <https://apps.fas.usda.gov/ newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain%20and%20Feed%20Update_Rabat_Morocco_MO2025-0001.pdf> (eingesehen am 28.7.2025); Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAOSTAT Statistical Database: Detailed Trade Matrix, Rom 2025, <https://www.fao.org/ faostat/en/#data/TM> (eingesehen am 20.6.2025).
- 19
-
Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, »Flächenstilllegung ausgesetzt: Die Folgen für Landwirtschaft und Umwelt«, 8.7.2025, <https://www.landwirtschaft.de/umwelt/ natur/biodiversitaet/flaechenstilllegung-ausgesetzt-die-folgen-fuer-landwirtschaft-und-umwelt> (eingesehen am 20.8.2025).
- 20
-
Bettina Rudloff, Trade Rules and Food Security. Scope for Domestic Support and Food Stocks, Bonn/Eschborn: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), September 2015, <https://d-nb.info/1097638340/34> (eingesehen am 18.8.2025).
- 21
-
Zarevich, »The Flour War« [wie Fn. 9].
- 1
-
Moritz Rudolf, Chinas Gesundheitsdiplomatie in Zeiten von Corona. Die Seidenstraßeninitiative (BRI) in Aktion, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Januar 2021 (SWP-Aktuell 5/2021), doi: 10.18449/2021A05.
- 2
-
Hampus Holmer, »Global Health Politics: Multipolarity Is the New Reality«, in: Think Global Health (online), 30.9.2024, <https://www.thinkglobalhealth.org/article/global-health-politics-multipolarity-new-reality>. Diese und sämtliche folgenden Internetquellen wurden am 30.7.2025 eingesehen.
- 3
-
Dazu auch einschlägige Dokumente der Bundesregierung: Verantwortung für Deutschland. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 21. Legislaturperiode, Berlin, April 2025, <https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitions vertrag2025.de/files/koav_2025.pdf>; Wehrhaft. Resilient. Nachhaltig. Integrierte Sicherheit für Deutschland. Nationale Sicherheitsstrategie, Berlin, Juni 2023, <https://www.nationalesicherheits strategie.de/Sicherheitsstrategie-DE.pdf>; Strategie der Bundesregierung zur globalen Gesundheit, Berlin, Oktober 2020, <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/ Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Broschueren/Globale Gesundheitsstrategie_Web.pdf>.
- 4
-
Michael Bayerlein/Branwen J. Hennig/Beate Kampmann, »Deutschlands Rolle in der Globalen Gesundheit nach der Bundestagswahl 2025: Entsprechen die Bestrebungen den Erfordernissen?«, Global Health Hub Germany (online), 2.4.2025, <https://www.globalhealthhub.de/de/news/detail/ deutschlands-rolle-in-der-globalen-gesundheit-nach-der-bundestagswahl-2025-entsprechen-die-bestrebungen-den-erfordernissen>.
- 5
-
Daniel F. Runde, U.S. Foreign Assistance in the Age of Strategic Competition, Washington, D. C.: Center for Strategic and International Studies, Mai 2020, <https://csis-website-prod.s3. amazonaws.com/s3fs-public/publication/20514_Runde_ ForeignAssistance_v3_FINAL.pdf>.
- 6
-
Seow Ting Lee, »Vaccine Diplomacy: Nation Branding and China’s COVID-19 Soft Power Play«, in: Place Branding and Public Diplomacy, 19 (2023) 1, S. 64–78, doi: 10.1057/s41254-021-00224-4.
- 7
-
Maria Cheng, »U.S. Is Pulling Funding from Gavi, Global Group That Has Paid for More Than a Billion Kids to Get Vaccinated«, in: PBS News (online), 26.6.2025, <https://www. pbs.org/newshour/health/u-s-is-pulling-funding-from-gavi-global-group-that-has-paid-for-more-than-a-billion-kids-to-get-vaccinated>.
- 8
-
Siehe die Einleitung zu dieser Studie von Hanns Günther Hilpert und Sascha Lohmann, S. 7ff.
- 9
-
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Securing Medical Supply Chains in a Post-Pandemic World, Paris 2024 (OECD Health Policy Studies), S. 19, doi: 10.1787/119c59d9-en.
- 10
-
The White House, Delivering Most-Favored-Nation Prescription Drug Pricing to American Patients, Executive Order, Washington, D. C., 12.5.2025, <https://www.whitehouse.gov/ presidential-actions/2025/05/delivering-most-favored-nation-prescription-drug-pricing-to-american-patients/>.
- 11
-
Lenkungsgruppe für Engpässe bei Arzneimitteln (MSSG), MSSG Recommendations to Strengthen Supply Chains of Critical Medicinal Products, Amsterdam: Europäische Arzneimittel-Agentur, 19.4.2024, <https://www.ema.europa.eu/en/ documents/other/mssg-recommendations-strengthen-supply-chains-critical-medicinal-products_en.pdf>.
- 12
-
Siehe den Beitrag von Bettina Rudloff und Rocco Görhardt in dieser Studie, S. 64ff.
- 13
-
MSSG Recommendations to Strengthen Supply Chains of Critical Medicinal Products [wie Fn. 11].
- 14
-
Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations, »Annex 10: Good Reliance Practices in the Regulation of Medical Products: High Level Principles and Considerations«, in: dass., Fifty-fifth Report, Genf: Weltgesundheitsorganisation, Oktober 2021 (WHO Technical Report Series Nr. 1033), <https://www.who.int/publications/m/ item/annex-10-trs-1033>.
- 15
-
Siehe den Beitrag von Peter-Tobias Stoll und Dorothée Falkenberg in dieser Studie, S. 45ff.
- 16
-
Siehe den Beitrag von Christian Pfeiffer in dieser Studie, S. 19ff.
- 17
-
Inga Carry, Rohstoffpartner Chile: Mehr als nur ein Lieferant, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Mai 2025 (SWP-Aktuell 21/2025), doi: 10.18449/2025A21.
- 18
-
Anna Lotte Böttcher/Katja Pohlmann, »Supporting Local Vaccine Production in Africa«, in: Development and Cooperation (online), 10.10.2024, <https://www.dandc.eu/en/article/order-reduce-africas-dependence-global-supply-chains-germany-working-partners-support-local>.
- 19
-
Siehe Rat der Europäischen Gemeinschaften, »Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 betreffend die Transparenz von Maßnahmen zur Regelung der Preisfestsetzung bei Arzneimitteln für den menschlichen Gebrauch und ihre Einbeziehung in die staatlichen Krankenversicherungssysteme«, in: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, (11.2.1989) L40, S. 8–11, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0105>.
- 1
-
The State Council Information Office of the People’s Republic of China, China’s Space Program: A 2021 Perspective, Peking, 28.1.2022, <https://english.www.gov.cn/archive/ whitepaper/202201/28/content_WS61f35b3dc6d09c94e48 a467a.htmlj>; auch die Etappen auf dem Weg zur Verwirklichung des »Chinesischen Traums« hat Xi schon festgelegt: »Erreichen der Jahrhundertziele der Volksbefreiungsarmee bis 2027, grundsätzliche Verwirklichung der Modernisierung der Landesverteidigung und der Streitkräfte bis 2035 und vollständiger Ausbau der Streitkräfte zu Weltklasse-Streitkräften bis Mitte des 21. Jahrhunderts«, siehe »Xi Focus: PLA Striving to Build World-class Military under Xi’s Leadership«, Xinhua, 2.8.2022, <https://english.news.cn/20220802/a1990d 2381244c06899751bab3ce739d/c.html> (Übersetzung der Autorinnen). Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Internetquellen zuletzt am 15.9.2025 aufgerufen.
- 2
-
»The space dream is part of the dream to make China stronger« (Xi Jinping), zit. nach Tian Shaohui, »Backgrounder: Xi Jinping’s Vision for China’s Space Development«, Xinhua, 24.4.2017, <http://www.xinhuanet.com/english/2017-04/24/c_136232642.htm>.
- 3
-
Shi Yinhong, »China’s Complicated Foreign Policy«, European Council on Foreign Relations (ECFR) (online), 31.3.2015, <https://ecfr.eu/article/commentary_chinas_complicated_ foreign_policy311562/>.
- 4
-
Vgl. den Beitrag von Nadine Godehardt, S. 30ff.
- 5
-
Juliana Süß, »Guo Wang: China’s Answer to Starlink?«, London: Royal United Services Institute (RUSI) (online), 3.5.2023, <https://www.rusi.org/explore-our-research/ publications/commentary/guo-wang-chinas-answer-starlink> (eingesehen am 10.9.2025).
- 6
-
Siehe den Beitrag von Nadine Godehardt in dieser Studie, S. 30ff.
- 7
-
Benjamin Silverstein, »China’s Space Dream Is a Legal Nightmare«, in: Foreign Policy, 21.4.2023, <https://foreign policy.com/2023/04/21/china-space-law-treaty-djibouti-obock-launch-facility-ost/>.
- 8
-
Victoria Samson/Laetitia Cesari, Global Counterspace Capabilities Report, Washington, D. C.: Secure World Foundation, April 2025, <https://www.swfound.org/publications-and-reports/2025-global-counterspace-capabilities-report>.
- 9
-
Joey Roulette/Eduardo Baptista/Sarah El Safty/Joe Brock, »China Builds Space Alliances in Africa as Trump Cuts Foreign Aid«, Reuters, 11.2.2025, <https://www.reuters.com/ investigations/china-builds-space-alliances-africa-trump-cuts-foreign-aid-2025-02-11/>.
- 10
-
Ebd.
- 11
-
Makena Young/Akhil Thadani, Low Orbits, High Stakes. All-In on the LEO Broadband Competition, Washington, D. C.: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 14.12.2022, <https://www.csis.org/analysis/low-orbit-high-stakes>.
- 12
-
Siehe den Beitrag von Nadine Godehardt in dieser Studie, S. 30ff.
- 13
-
Im Mai 2025 betrug der niedrigste Tarif für die Nutzung eines Starlink-Terminals in Juba, Südsudan, beispielsweise einmalig 389 US-Dollar für die Hardware und mindestens 30 US-Dollar als Monatsgebühr, vgl. Starlink, »Verfügbarkeitskarte«, <https://www.starlink.com/de/map> (eingesehen am 22.7.2025).
- 14
-
Siehe den Beitrag von Daniel Voelsen in dieser Studie, S. 36ff.
- 15
-
»China Space Activity Overview: 2024 Insights«, New Space Economy (online), 4.10.2024, <https://newspaceeconomy. ca/2024/10/04/china-space-activity-overview-2024-insights/ ?utm_source=chatgpt.com>.
- 16
-
US Department of Defense, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2024. Annual Report to Congress, Washington, D.C., Dezember 2024, <https:// media.defense.gov/2024/Dec/18/2003615520/-1/-1/0/MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA-2024.PDF>.
- 17
-
National Development and Reform Commission, Guojia minyong kongjian jichu sheshi zhong chang qi fazhan guihua (2015–2025) [Nationaler mittel- und langfristiger Entwicklungsplan für die zivile Weltrauminfrastruktur (2015–2025)], 2015, <https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201510/W020190905497791202653.pdf>.
- 18
-
Vgl. Yuexia Han u. a., »A PIE Analysis of China’s Commercial Space Development«, in: Human and Social Sciences Communications, 28.10.2023, <https://www.nature.com/ articles/s41599-023-02274-w>.
- 19
-
European Commission, The Draghi Report on EU Competitiveness. Part-B: In-depth Analysis and Recommendations, 9.9.2024, S. 173, <https://commission.europa.eu/document/download/ ec1409c1-d4b4-4882-8bdd-3519f86bbb92_en>.
- 20
-
Ebd., S. 176.
- 21
-
European Commission, »Government Gateway. Information on the Roll-out of the Government Gateway Strategy, Partnerships, Projects and Funding Opportunities«, Brüssel, o. D., <https://international-partnerships.ec.europa.eu/ policies/global-gateway_en>.
- 22
-
European Commission, »Africa-EU Space Partnership Programme«, Brüssel, o. D., <https://international-partner ships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/africa-eu-space-partnership-programme_en>.
- 23
-
Juliana Süß/Vanessa Vohs, »Kein rechtsfreier Weltraum«, in: Internationale Politik (online), 8.7.2025, <https:// internationalepolitik.de/en/kein-rechtsfreier-weltraum>.
- 24
-
Vgl. Daniel Voelsen, Internet aus dem Weltraum. Wie neuartige Satellitenverbindungen die globale Internet‑Governance verändern könnten, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Februar 2021 (SWP-Studie 2/2021), doi: 10.18449/2021S02.
- 1
-
Siehe hierzu Annegret Bendiek/Isabella Stürzer, »Neofunktionalistische Mechanismen der digitalen Agenda: Von der Digitalmarktintegration zur externen Wirkung europäischer Cyberpolitiken«, in: Raphael Bossong/Nicolai von Ondarza (Hg.), Stand der Integration, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, April 2024 (SWP-Studie 11/2024), S. 63–72, doi: 10.18449/2024S11; für Indien siehe hierzu Soumya Awasthi/Abhishek Sharma, Rethinking India’s Cyber Readiness in the Age of Information Warfare, Neu-Delhi: Observer Research Foundation, Mai 2025, <https://www.orfonline.org/ expert-speak/rethinking-india-s-cyber-readiness-in-the-age-of-information-warfare>. Diese und sämtliche folgenden Internetquellen wurden am 5.8.2025 eingesehen.
- 2
-
Für eine Übersicht über alle relevanten digitalpolitischen Rechtsakte siehe Kai Zenner/J. Scott Marcus/Kamil Sekut, A Dataset of International Legal and Policy Instruments for the Digital World, Brüssel: Centre for European Policy Studies, Mai 2025, <https://www.ceps.eu/ceps-publications/a-dataset-of-international-legal-and-policy-instruments-for-the-digital-world/?mc_cid=a9b38fe64f&mc_eid=ce07fd0dad>.
- 3
-
Vgl. Eric Rosenbach/Lea Baltussen/Eleanor Crane/Ethan Kessler, Critical and Emerging Technologies Index, Cambridge, MA: Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs, Juni 2025, <https://www.belfercenter. org/critical-emerging-tech-index>. Zur Relevanz digitaler Partnerschaften siehe Maria Niestadt, »The EU’s Digital Partnerships«, European Parliamentary Research Service, 6.6.2025, <https://epthinktank.eu/2025/06/06/the-eus-digital-partnerships/>; für Indien siehe Sauradeep Bag, From BharatNet to Starlink: Rewiring India’s Digital Future, Neu-Delhi: Observer Research Foundation, Mai 2025, <https://www. orfonline.org/expert-speak/from-bharatnet-to-starlink-rewiring-india-s-digital-future>.
- 4
-
Grundlegend hierzu Sheila Jasanoff (Hg.), States of Knowledge. The Co-production of Science and the Social Order, London 2004.
- 5
-
Zum Begriff der digitalen Souveränität in Bezug auf die EU siehe Annegret Bendiek/Jürgen Neyer, »Europas digitale Souveränität. Bedingungen und Herausforderungen internationaler politischer Handlungsfähigkeit«, in: Michael Oswald/Isabelle Borucki (Hg.), Demokratietheorie im Zeitalter der Frühdigitalisierung, Wiesbaden 2020, S. 103–125, doi: 10.1007/978-3-658-30997-8_6.
- 6
-
Für eine entsprechende Übersicht der Rechtsakte der EU siehe J. Scott Marcus/Kamil Sekut/Kai Zenner, A Dataset on EU Legislation for the Digital World, Brüssel: Bruegel, 20.7.2023 (update 6.6.2024), <https://www.bruegel.org/dataset/dataset-eu-legislation-digital-world>; Emily Benson/Max Bergmann/ Federico Steinberg, The Transatlantic Tech Clash: Will Europe »De‑Risk« from the United States?, Washington, D. C.: Center for Strategic and International Studies, Mai 2025, <https://www. csis.org/analysis/transatlantic-tech-clash-will-europe-de-risk-united-states>.
- 7
-
Annegret Bendiek, No New Cold War: Give Strategic Interdependence a Chance, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2018 (SWP Point of View), <https://www.swp-berlin.org/publikation/no-new-cold-war-give-strategic-interdependence-a-chance-1>.
- 8
-
Vgl. Annegret Bendiek/Isabella Stürzer, »The Brussels Effect, European Regulatory Power and Political Capital: Evidence for Mutually Reinforcing Internal and External Dimensions of the Brussels Effect from the European Digital Policy Debate«, in: Digital Society, 2 (2023) 5, doi: 10.1007/ s44206-022-00031-1.
- 9
-
Siehe hierzu aktuell Ludovica Favarotto, Data, Deals, and Partnership: The European Union’s Rise as a Digital Trade Leader, Mailand: Italian Institute for International Political Studies, April 2025, <https://www.ispionline.it/en/publication/data-deals-and-partnership-the-european-unions-rise-as-a-digital-trade-leader-205847>.
- 10
-
Annegret Bendiek, Deutsche Cybersicherheit in Europa, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Januar 2023 (Arbeitspapier Forschungsgruppe EU/Europa 01/2023), <https:// www.swp-berlin.org/publications/products/arbeitspapiere/ Deutsche_Cybersicherheit_in_Europa_BT20012023_Bendiek_AP.pdf>; Deutscher Bundestag, »Sachverständige werben für Straffung der Verantwortlichkeiten bei Cybersicherheit«, Ausschuss für Digitales, Öffentliche Anhörung, Berlin, 25.1.2023, <https://www.bundestag.de/dokumente/ textarchiv/2023/kw04-pa-digitales-928536>.
- 11
-
Vgl. Meredith Broadbent, Reading Tea Leaves on Transatlantic Digital Trade with Europe, Mailand: Italian Institute for International Political Studies, April 2025, <https:// www.ispionline.it/en/publication/reading-tea-leaves-on-transatlantic-digital-trade-with-europe-205861>; Nikolaus von Bernuth, »The Premise of Good Faith in Platform Regulation. On the Changing Conditions of the Digital Services Act’s Regulatory Approach«, Verfassungsblog, 14.4.2025, <https://verfassungsblog.de/the-premise-of-good-faith-in-platform-regulation-dsa/>.
- 12
-
Rajat Kathuria/Amaia Sánchez-Cacicedo, Tapping into the Momentum: The EU-India Trade and Technology Council, Neu-Delhi: Heinrich-Böll-Stiftung, Mai 2025, <https://www.boell. de/sites/default/files/2025-06/tapping-into-the-momentum-the-eu-india-trade-and-technology-council.pdf>.
- 13
-
Der weltweit führende Chip-Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) kündigte 2024 an, eine große Halbleiterfabrik in Dresden zu bauen, ermöglicht durch 5 Milliarden Euro Fördermittel aus Deutschland und der EU im Rahmen des European Chips Act. Frankreich und Italien investieren ebenfalls in neue Chip-Fabriken (Erweiterungen beim europäischen Halbleiterhersteller STMicroelectronics), oft kofinanziert durch das EU-Programm. Gemeinsam soll Europa die notwendige Größenordnung erreichen, um zu den USA (mit ihrem CHIPS and Science Act) und China (mit seiner Strategie Made in China 2025) in der Halbleiterproduktion aufzuschließen.
- 14
-
Siehe hierzu aktuell Tim Nicholas Rühlig, The »Huawei Saga« in Europe Revisited. German Lessons for the Rollout of 6G, Paris: The French Institute of International Relations (Ifri), 2.6.2025 (Notes du Cerfa, Nr. 187), <https://www.ifri.org/sites/ default/files/2025-06/ifri_ruhlig_huawei_saga_europe_ 2025.pdf>.
- 15
-
Vgl. Harsh V Pant/Aarshi Tirkey, »The 5G Question and India’s Conundrum«, in: Orbis, 64 (2020) 4, S. 571–588, doi: 10.1016/j.orbis.2020.08.006.
- 16
-
Arvind Gupta, The New National Security Directive Will Strengthen Telecom Security, Neu-Delhi: Vivekananda International Foundation, 20.12.2020, <https://www.vifindia.org/ 2020/december/20/the-new-national-security-directive-will-strengthen-telecom-security>.
- 17
-
Sujan Chinoy, »Boost for India’s Telecom Security: New Directive Cuts Reliance on Foreign Equipment, Including from Dubious Sources«, in: The Times of India, 28.12.2020, <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/toi-edit-page/ boost-for-indias-telecom-security-new-directive-cuts-reliance-on-foreign-equipment-including-from-dubious-sources/?utm_ source=chatgpt.com>.
- 18
-
The Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology, »India Semiconductor Mission«, <https://ism.gov.in/>.
- 19
-
U.S. Department of Commerce, »Secretary Raimondo Announces U.S.-India Semiconductor Supply Chain and Innovation Partnership MOU in New Delhi«, Washington, D. C., 15.3.2023, <https://www.commerce.gov/news/blog/ 2023/03/secretary-raimondo-announces-us-india-semi conductor-supply-chain-and-innovation>.
- 20
-
Rudra Chaudhuri/Konark Bhandari, The U.S.–India Initiative on Critical and Emerging Technology (iCET) from 2022 to 2025: Assessment, Learnings, and the Way Forward, Washington, D. C.: Carnegie Endowment for International Peace, 23.10.2024, <https://carnegieendowment.org/research/2024/ 10/the-us-india-initiative-on-critical-and-emerging-technology-icet-from-2022-to-2025-assessment-learnings-and-the-way-forward?lang=en>.
- 21
-
Anushka Saxena, »Contemporary Dynamics of an India-Taiwan Partnership«, in: South Asian Voices, 2.4.2024, <https:// southasianvoices.org/geo-f-in-n-india-taiwan-partnership-04-02-2024/>.
- 22
-
Anna-Lisa Wirth, »A Real Ban on Dark Patterns – Why Co-regulation Is Not Enough«, Berlin: Hertie School Centre for Digital Governance, 11.4.2025, <https://www.hertie-school.org/en/content/detail/content/a-real-ban-on-dark-patterns-why-co-regulation-is-not-enough>.
- 23
-
Polona Car, »Digital Markets Act Enforcement: State of Play«, European Parliamentary Research Service, April 2025, <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2025/772826/EPRS_ATA(2025)772826_EN.pdf>; von Bernuth, »The Premise of Good Faith in Platform Regulation« [wie Fn. 11].
- 24
-
Daniel AJ Sokolov, »Indien sperrt bereits über 200 chinesische Apps«, in: heise online, 26.11.2020, <https://www. heise.de/news/Indien-sperrt-bereits-ueber-200-chinesische-Apps-4971277.html>.
- 25
-
Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, »Government of India Blocks 43 Mobile Apps from Accessing by Users in India. MEITY Issues Order for Blocking Apps under Section 69A of the Information Technology Act«, Pressemitteilung, Neu-Delhi, 24.11.2020, <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx? PRID=1675335>.
- 26
-
Vgl. Benjamin Boudreaux/Gregory Smith/Edward Geist/ Leah Dion, Insights from Nuclear History for AI Governance, Santa Monica, CA: RAND Corporation, Mai 2025, <https://www. rand.org/pubs/perspectives/PEA3652-1.html>; Felix Sieker/ Alek Tarkowski/Lea Gimpel/Cailean Osborne, Public AI White Paper – A Public Alternative to Private AI Dominance, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, Mai 2025, doi: 10.11586/2025040; Michael J. D. Vermeer, Could AI Really Kill Off Humans?, Santa Monica, CA: RAND Corporation, 9.5.2025, <https://www. rand.org/pubs/commentary/2025/05/could-ai-really-kill-off-humans.html>; Cy McGeady/Rebecca Riess, Great Power Competition: Surveying Global Electricity Strategies for AI, Washington, D. C.: Center for Strategic and International Studies, 8.5.2025, <https://www.csis.org/analysis/great-power-competition-surveying-global-electricity-strategies-ai>.
- 27
-
Siehe hierzu exemplarisch Julia Christina Hess, »Eine Gigafactory reicht vorerst: Besonnen statt groß denken!«, Interface, 5.5.2025, <https://www.interface-eu.org/ publications/eine-gigafactory-reicht-vorerst-besonnen-statt-gross-denken>; Raluca Csernatoni, The EU’s AI Power Play: Between Deregulation and Innovation, Washington, D. C.: Carnegie Endowment for International Peace, Mai 2025, <https:// carnegieendowment.org/research/2025/05/the-eus-ai-power-play-between-deregulation-and-innovation?lang=en>.
- 28
-
European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, »AI Act«, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai#:~:text=The%20AI%20Act%20is%20the, play%20a%20leading%20role%20globally>.
- 29
-
Nestor Maslej u. a., Artificial Intelligence Index Report 2025, Stanford, CA: Stanford University, AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, April 2025, <https:// hai-production.s3.amazonaws.com/files/hai_ai_index_ report_2025.pdf>.
- 30
-
Santosh Kumar/Ritu Kataria/Saurabh Kalia, »India’s AI Revolution. A Roadmap to Viksit Bharat«, Presseerklärung, Neu-Delhi: Ministry of Electronics and Information Technology, Press Information Bureau, Government of India, 6.3.2025, <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID= 2108810&utm>.
- 31
-
Nikhil Inamdar, »India Seeks AI Breakthrough – But Is It Falling Behind?«, BBC, 18.2.2025, <https://www.bbc.com/ news/articles/cp8qglr9r74o>.
- 32
-
»Indian Finance Ministry Bans ChatGPT, DeepSeek for Employees amid Data Security Concerns«, Firstpost, 5.2.2025, <https://www.firstpost.com/india/indian-finance-ministry-bans-chatgpt-deepseek-for-employees-amid-data-security-concerns-13859900.html>.
- 33
-
European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, »Key Outcomes of the Second EU-India Trade and Technology Council«, Brüssel: DIGIBYTE, 28.2.2025, <https://digital-strategy.ec.europa. eu/en/news/key-outcomes-second-eu-india-trade-and-technology-council#:~:text=In%20line%20with%20their %20shared,of%20both%20economies%20and%20societies>.
- 34
-
Ebd.
- 35
-
Hannes Ebert, »Prospects and Perils for EU-India Cybersecurity Cooperation«, German Marshall Fund, o.D., <https:// www.gmfus.org/news/prospects-and-perils-eu-india-cyber security-cooperation#:~:text=First%2C%20the%20EU%20and %20India,health%20sector%2C%20and%20further%20its>.
- 1
-
Als Tauschmittel, Wertaufbewahrungsmittel, Recheneinheit und Schuldmaßstab.
- 2
-
Siehe dazu grundlegend: Stefan Eich, The Currency of Politics. The Political Theory of Money from Aristotle to Keynes, Princeton, NJ, 2022; Jonathan Kirshner, »Money Is Politics«, in: Review of International Political Economy, 10 (2003) 4, S. 645–660.
- 3
-
Siehe den Beitrag von Christian Pfeiffer in dieser Studie, S. 19ff.
- 4
-
Benjamin J. Cohen, Currency Power. Understanding Monetary Rivalry, Princeton, NJ, 2015.
- 5
-
Siehe Jonathan Kirshner, Currency and Coercion. The Political Economy of International Monetary Power, Princeton, NJ, 2015; Ulrich Blum, Wirtschaftskrieg. Rivalität ökonomisch zu Ende denken, Berlin 2020, S. 745–747, 769–773.
- 6
-
Zur Dollar-Dominanz siehe zum Beispiel Carol Bertaut/ Bastian von Beschwitz/Stephanie Curcuru, The International Role of the U.S. Dollar – 2025 Edition, Washington, D. C.: Board of Governors of the Federal Reserve System, 18.7.2025 (FEDS Notes), doi: 10.17016/2380-7172.3856. (Sofern nicht anders angegeben, wurden alle Internetquellen zuletzt am 24.9.2025 aufgerufen.)
- 7
-
Siehe zum Beispiel Benn Steil/Robert E. Litan, Financial Statecraft: The Role of Financial Markets in American Foreign Policy, New Haven, CT/London 2006; Sascha Lohmann, »Währungspolitik«, in: Thomas Jäger (Hg.), Die Außenpolitik der USA. Eine Einführung, Wiesbaden 2017, S. 203–221, doi: 10.1007/978-3-531-93392-4.
- 8
-
Siehe den Beitrag von Daniel Voelsen in dieser Studie, S. 36ff.
- 9
-
Internationaler Währungsfonds, »Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER)«, IMF Data, <https://data.imf.org/en/Data-Explorer?datasetUrn=IMF.STA: COFER(7.0.0)> (eingesehen am 9.9.2025).
- 10
-
Atlantic Council, Dollar Dominance Monitor, <https:// www.atlanticcouncil.org/programs/geoeconomics-center/ dollar-dominance-monitor/>.
- 11
-
Paweł Tokarski, »Der Euro im internationalen Finanzsystem: Realitätscheck in einer Dollar-Welt«, in: Integration, 46 (2023) 4, S. 333–350.
- 12
-
Paweł Tokarski, Deutschland, Frankreich und Italien im Euroraum. Ursprünge, Merkmale und Folgen der begrenzten Konvergenz, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Dezember 2018 (SWP‑Studie 25/2018), <https://www.swp-berlin.org/ publikation/euroraum-begrenzte-konvergenz>.
- 13
-
Paweł Tokarski, Der Euro angesichts der Dollar-Dominanz. Zwischen strategischer Autonomie und struktureller Schwäche, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Oktober 2023 (SWP-Studie 11/2023), doi: 10.18449/2023S11.
- 14
-
Sebastian Dullien, »The German Barrier to a Global Euro«, European Council on Foreign Relations (online), 30.8.2018, <https://ecfr.eu/article/commentary_german_barrier_global_ euro_maas/>.
- 15
-
Marek Dabrowski, Increasing the International Role of the Euro. A Long Way to Go, Warschau: Center for Social and Economic Research (CASE), 2020 (CASE Reports 502), <https:// hdl.handle.net/10419/261105>.
- 16
-
Hanns Günther Hilpert, Chinas währungspolitische Offensive. Die Herausforderung der Internationalisierung und Digitalisierung des Renminbi, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, März 2024 (SWP‑Studie 9/2024), doi: 10.18449/2024S09.
- 17
-
Knut Benjamin Pißler, »History and Legal Framework of the People’s Bank of China«, in: Frank Rövekamp/Moritz Bälz/Hanns Günther Hilpert (Hg.), Central Banking and Financial Stability in East Asia, Cham u. a. 2015, S. 11–24.
- 18
-
Siehe zum Beispiel Enrico Letta, Much More Than a Market: Speed, Security, Solidarity – Empowering the Single Market to Deliver a Sustainable Future and Prosperity for All EU Citizens, Brüssel: European Commission, 2024, <https://www. consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf>; Association for Financial Markets in Europe (AFME), Capital Markets Union. Key Performance Indicators – Seventh Edition. Unlocking Capital Markets for a Competitive Europe, November 2024, <https://www.afme.eu/ Portals/0/DispatchFeaturedImages/AFME_CMU_KPIs2024_06-1.pdf>.
- 19
-
Maria Demertzis/Josh Lipsky, »The Geopolitics of Central Bank Digital Currencies«, in: Intereconomics, 58 (2023) 4, S. 173–177; Lucia Quaglia/Amy Verdun, »The Geoeconomics of Central Banks Digital Currencies (CBDCs): The Case of the European Central Bank (ECB)«, in: New Political Economy, 30 (2025) 5, S. 1–13.
- 20
-
Nikou Asgari, »EU Speeds Up Plans for Digital Euro after US Stablecoin Law«, in: Financial Times, 22.8.2025.
- 21
-
Die Executive Order vom 23.1.2025 verbietet die Arbeit an DZBGs in den USA und bezeichnet diese von der Zentralbank ausgegebene Geldform als Bedrohung für die Stabilität des Finanzsystems und die Souveränität der USA, siehe »Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology«, Washington, D. C.: The White House, 23.1.2025, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/ 01/strengthening-american-leadership-in-digital-financial-technology/>.
- 22
-
United States Congress, Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act of 2025 (GENIUS Act of 2025), Public Law No. 119–27, 18.7.2025, S. 1582, <https://www. congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/1582/text>.
- 23
-
Paweł Tokarski, Stablecoin-Regulierung in den USA: Druck auf Europa wächst, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Juli 2025 (SWP Kurz gesagt), <https://www.swp-berlin.org/ publikation/stablecoin-regulierung-in-den-usa-druck-auf-europa-waechst>.
- 1
-
Zitat aus Christian Pfeiffers Beitrag in dieser Studie, S. 21.
- 2
-
Vgl. Gregor Laudage/Armin Haas/Andrei Guter-Sandu/ Steffen Murau, Staatsfinanzen jenseits des Kernhaushalts. Bilanzexterne Fiskalagenturen im deutschen fiskalischen Ökosystem, Berlin: Global Climate Forum, Juli 2024 (OBFA-TRANSFORM Working Paper Nr. 1).
- 3
-
Für eine exakte Erläuterung der Klassifikation von Institutionen gemäß den EU-Fiskalregeln vgl. Laudage/Haas/ Guter-Sandu/Murau, Staatsfinanzen jenseits des Kernhaushalts [wie Fn. 2], S. 23ff.
- 4
-
Siehe die Einleitung der Herausgeber zu dieser Studie, S. 7ff.
- 5
-
Vgl. Armin Haas/Andrei Guter-Sandu/Olan McEvoy/ Steffen Murau, All Quiet on the Fiscal Front? Off-Balance-Sheet Fiscal Agencies in the German War Economy, 1914–1918, Berlin: Global Climate Forum, Juli 2025 (OBFA-Transform Discussion Paper Nr. 7).
- 6
-
Vgl. Armin Haas/Friederike Reimer/Andrei Guter-Sandu/ Steffen Murau, The Mefo Operation. A Macro-Financial Analysis of Camouflaged Sovereign Borrowing through Off-Balance-Sheet Fiscal Agencies, 1933–1945, Berlin: Global Climate Forum, August 2024 (OBFA-TRANSFORM Working Paper Nr. 2).
- 7
-
Vgl. Vanessa Endrejat, »Off-Balance-Sheet Policies to the Rescue. The Role of Statistical Expertise for European Public-Private Partnerships«, in: Competition & Change, 28 (2024) 3–4, S. 515–535, doi: 10.1177/10245294241245512.
- 8
-
Siehe den Beitrag von Daniel Voelsen in dieser Studie, S. 36ff.
- 9
-
Andrei Guter-Sandu/Armin Haas/Steffen Murau, »Green Macro-Financial Governance in the European Monetary Architecture. Assessing the Capacity to Finance the Net-Zero Transition«, in: Competition & Change (online), 17.10.2024, doi: 10.1177/10245294241275103.
- 1
-
Dieser Befund gilt auch für andere zentrale Begriffe der Außen- und Sicherheitspolitik, die ebenso wenig konzeptualisiert und überwiegend deklaratorisch verwendet werden. Vgl. den Hinweis auf eine »nahezu inflationäre Verwendung von Begriffen wie ›geostrategisch‹ und ›geopolitisch‹ durch den Europäischen Rat, was die EU noch keineswegs zu einem wirklich strategischen Akteur macht«. Mathias Jopp, »Der Europäische Rat und die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Spagat zwischen Einstimmigkeit und Effizienz«, in: Integration, 48 (2025) 2, S. 171–183 (183).
- 2
-
»Meine Einschätzung ist aber, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen negativ durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen.« »Köhler: Mehr Respekt für deutsche Soldaten in Afghanistan« (Interview), Deutschlandfunk Kultur, 22.5.2010, <https://www.deutschland funkkultur.de/koehler-mehr-respekt-fuer-deutsche-soldaten-in-afghanistan-100.html> (eingesehen am 31.7.2025).
- 3
-
Harvard Kennedy School, »Ricardo Is Dead. Long Live Fair, Balanced, and Reciprocal Trade. A Presentation on U.S. Trade Policy by Dr. Peter Navarro, Director of the White House Office of Trade and Manufacturing Policy«, Cambridge, MA, 25.4.2019, <https://iop.harvard.edu/events/ricardo-dead-long-live-fair-balanced-and-reciprocal-trade> (eingesehen am 31.7.2025).
- 4
-
»In the realm of military competition, the instruments of power are missiles, planes, warships, bombs, tanks and divisions. In the realm of economic competition, the instruments of power are productive efficiency, market control, trade surplus, strong currency, foreign exchange reserves, ownership of foreign companies, factories and technology.« Samuel P. Huntington, »Why International Primacy Matters«, in: International Security, 17 (1993) 4, S. 68–83 (73), doi: 10.2307/2539022.
- 5
-
Eric Helleiner, The Neomercantilists. A Global Intellectual History, Ithaca, NY, 2021.
- 6
-
Und sie werden den Vertragsstaaten der WTO gemäß Art. XX des GATT-Vertrags auch grundsätzlich zugestanden.
- 7
-
Europäische Kommission, Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council on »European Economic Security Strategy«, JOIN(2023) 20 final, Brüssel, 20.6.2023, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ ?uri=celex:52023JC0020>.
- 8
-
Čedomir Nestorović, Geopolitics and Business. Relevance and Resonance, Cham 2023, S. 307–309, doi: 10.1007/978-3-031-45325-0.
- 9
-
Josep Borrell, »The Difficult Process of Learning to ›Speak the Language of Power‹«, in: European External Action Service, Blog of the High Representative/Vice-President (online), 29.11.2024, <https://www.eeas.europa.eu/eeas/difficult-process-learning-speak-language-power_en> (eingesehen am 31.7.2025).
- 10
-
Sofia Vandenbosch/Kerttuli Lingenfelter/Carolyn Moser, »Law and Governance Variations of Europe’s Geopolitical Awakening«, Verfassungsblog (online), 28.10.2024, doi: 10.59704/b1a5127f403ec766.
- 11
-
Ian Manners, »Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?«, in: Journal of Common Market Studies, 40 (2002) 2, S. 235–258, doi: 10.1111/1468-5965.00353.
- 12
-
»Der Einsatz wirtschaftspolitischer Instrumente für geopolitische Zwecke widerspricht zunächst traditionellem deutschen ordnungspolitischen Denken, dessen Väter das Prinzip eines Ordnungsrahmens für offene Märkte vom Nationalstaat auf eine regelbasierte Weltwirtschaft übertrugen.« Gerald Braunberger, »Krieg mit anderen Mitteln«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.7.2025, <https://www.faz.net/ aktuell/wirtschaft/donald-trump-und-die-zoelle-krieg-mit-anderen-mitteln-110610494.html> (eingesehen am 31.7.2025).
- 13
-
Vgl. Stiftung Wissenschaft und Politik/German Marshall Fund of the United States (Hg.), Neue Macht, neue Verantwortung. Elemente einer deutschen Außen- und Sicherheitspolitik für eine Welt im Umbruch, Berlin/Washington, D. C., 2013, S. 2, <https://www.swp-berlin.org/publikation/neue-macht-neue-verantwortung-neue-aussenpolitik> (eingesehen am 31.7.2025).
- 14
-
Daniela Schwarzer/Thomas Kleine-Brockhoff/Stefan Mair, »Sicherheitspolitik mit Strategie«, in: Tagesspiegel, 25.6.2025, <https://www.tagesspiegel.de/politik/sicherheitspolitik-mit-strategie-deutschland-braucht-eine-nationale-risikoanalyse-13913455.html> (eingesehen am 1.8.2025).
- 15
-
Emily Kilcrease, No Winners in This Game. Assessing the U.S. Playbook for Sanctioning China, Washington, D. C.: Center for a New American Security, Dezember 2023, <https://www.cnas. org/publications/reports/no-winners-in-this-game> (eingesehen am 31.7.2025).
- 16
-
Deutscher Bundestag, 4. Wahlperiode, Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der gewerblichen Wirtschaft sowie des Geld- und Kapitalverkehrs, Bonn, 14.1.1963 (Bundestags-Drucksache IV/892), S. 8, <https://dserver.bundestag.de/btd/04/008/0400892.pdf> (eingesehen am 31.7.2025).
- 17
-
Thomas Bagger, »Netzwerkpolitik. In einer veränderten Welt wachsen dem Auswärtigen Dienst neue Rollen zu«, in: Internationale Politik, 68 (2013) 1, S. 44–50 (49f), <https:// internationalepolitik.de/system/files/article_pdfs/IP_01-2013_Bagger.pdf> (eingesehen am 31.7.2025).
- 18
-
Kim. B. Olsen, The Geoeconomic Diplomacy of European Sanctions. Networked Practices and Sanctions Implementation, Leiden/ Boston 2022 (Diplomatic Studies Bd. 19), S. 160, <https://brill. com/view/title/62972> (eingesehen am 31.7.2025).
- 19
-
Vgl. Holger Janusch, »Außenhandel als Achillesferse der deutschen Sicherheit: Wirtschaftliche Resilienz und Abschreckung in der Nationalen Sicherheitsstrategie«, in: Holger Janusch/Thomas Dörfler (Hg.), Integrierte Sicherheit für Deutschland? Die Nationale Sicherheitsstrategie der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2025 (ZfP. Zeitschrift für Politik, Sonderband 13), S. 163–180 (177–179).
- 20
-
Jaša Veselinovič, »A Knowledge Regime Fit for Geoeconomics? The Changing Production, Consumption and Practices of Policy Knowledge in the EU«, in: European Foreign Affairs Review, 29 (2024) 2, S. 177–204, doi: 10.54648/eerr 2024008.
- 21
-
Vgl. zur sogenannten Tinbergen-Regel Jan Tinbergen, On the Theory of Economic Policy, Amsterdam 1952.
- 22
-
Siehe Gabriel Felbermayr/Martin Braml, Der Freihandel hat fertig. Wie die neue Welt(un)ordnung unseren Wohlstand gefährdet, Wien 2024, S. 153–158.
- 23
-
Ähnlich siehe Friedrich Merz, »Außenpolitische Grundsatzrede«, Körber Global Leaders Dialogue, 23.1.2025, <https:// www.cducsu.de/themen/aussenpolitische-grundsatz rede> (eingesehen am 31.7.2025).
- 24
-
Die maximal zulässige Obergrenze für die Einfuhr von Erdgas aus einem Land, die unter Bundeskanzler Helmut Schmidt im Bundessicherheitsrat vereinbart wurde, betrug lange Zeit 30 Prozent. Siehe Reinhard Bingener/Markus Wehner, Die Moskau-Connection. Das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit, 5. Aufl., München 2023, S. 78.
- 25
-
Bradley Martin, Supply Chain Uncertainty. Building Resilience in the Face of Impending Threats, Santa Monica, CA: RAND Corporation, Dezember 2024, S. 13, <http://www.rand.org/t/ RRA2558-1> (eingesehen am 31.7.2025).
- 26
-
Die Forderung nach Überwindung künstlich gezogener Grenzen zwischen sozialwissenschaftlichen Disziplinen ist nicht neu. Bereits Mitte der 1970er Jahre wurde »Hyperspezialisierung« von Politik- und Wirtschaftswissenschaft sowie »gegenseitige Abschottung der Fachdisziplinen« beklagt. Gilbert Ziebura, Weltwirtschaft und Weltpolitik 1922/24–1931. Zwischen Rekonstruktion und Zusammenbruch, Frankfurt a.M. 1984, S. 24; vgl. Susan Strange, »International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect«, in: International Affairs, 46 (1970) 2, S. 304–315.
- 27
-
Karl Kaiser, »Deutsche Außenpolitik in der Verflechtungsfalle«, in: Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, 8 (2015) 1, S. 35–43, doi: 10.1007/s12399-014-0445-5.
- 28
-
Vgl. Japanisches Wirtschaftsministerium (METI), White Paper on International Economy and Trade 2023, Tokio 2023, S. 205ff, <https://www.meti.go.jp/english/report/data/wp2023/ wp2023.html> (eingesehen am 31.7.2025).
- 29
-
Vgl. als eine Ausnahme den damaligen Ansatz der Obama-Administration. U.S. Department of State, »Delivering on the Promise of Economic Statecraft – Remarks by Secretary Clinton: November 2012«, Singapur, 17.11.2012, <https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/ 2012/11/200664.htm> (eingesehen am 1.8.2025).
- 30
-
Harlan Grant Cohen, »Toward Best Practices for Trade-security Measures«, in: Journal of International Economic Law, 27 (2024) 1, S. 93–113, doi: 10.1093/jiel/jgad046; Better Order Project, Towards a Better Security Order, Washington, D. C.: Quincy Institute for Responsible Statecraft, November 2024, S. 41–43, <https://betterorderproject.org/> (eingesehen am 1.8.2025); Nora Kürzdorfer/Eduardo Valencia/Ariel Macaspac Hernandez (Hg.), Global Perspectives on Responsible Economic Statecraft, Hamburg: German Institute for Global and Area Studies (GIGA), Januar 2025, doi: 10.13140/RG.2.2.32649. 04963.
- 31
-
Vgl. Kürzdorfer/Valencia/Macaspac Hernandez (Hg.), Global Perspectives on Responsible Economic Statecraft [wie Fn. 30].
- 32
-
Daleep Singh, »Forging a Positive Vision of Economic Statecraft«, in: New Atlanticist (Atlantic Council of the United States), 22.2.2024, <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ new-atlanticist/forging-a-positive-vision-of-economic-statecraft> (eingesehen am 1.8.2025).
- 33
-
Klaus Ritter, »Vorwort des Herausgebers«, in: Stiftung Wissenschaft und Politik (Hg.), Polarität und Interdependenz. Beiträge zu Fragen der Internationalen Politik, Baden-Baden 1978 (Internationale Politik und Sicherheit, Bd. 1), S. 9.
- 1
-
Orientierungsrahmen für die Forschung 2024/2026, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Dezember 2023, <https:// www.swp-berlin.org/die-swp/forschung/qualitaetssicherung/ orientierungsrahmen>.
Dieses Werk ist lizenziert unter CC BY 4.0
SWP-Studien unterliegen einem Verfahren der Begutachtung durch Fachkolleginnen und -kollegen und durch die Institutsleitung (peer review), sie werden zudem einem Lektorat unterzogen. Weitere Informationen zur Qualitätssicherung der SWP finden Sie auf der SWP-Website unter https:// www.swp-berlin.org/ueber-uns/qualitaetssicherung/.
SWP‑Studien geben die Auffassung der Autoren und Autorinnen wieder.
SWP
Stiftung Wissenschaft und Politik
Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit
Ludwigkirchplatz 3–4
10719 Berlin
Telefon +49 30 880 07-0
Fax +49 30 880 07-200
www.swp-berlin.org
swp@swp-berlin.org
ISSN (Print) 1611-6372
ISSN (Online) 2747-5115
DOI: 10.18449/2025S16