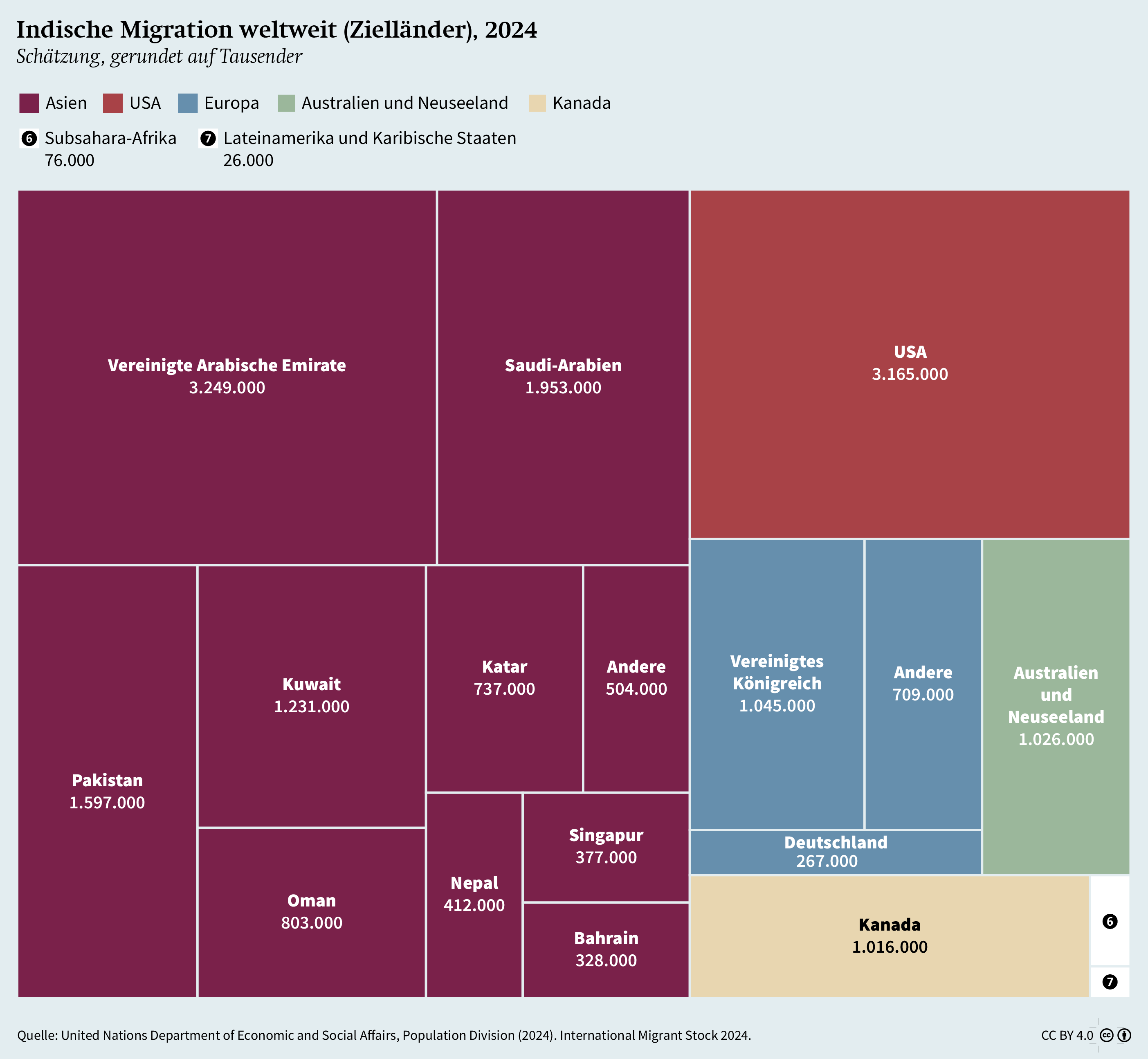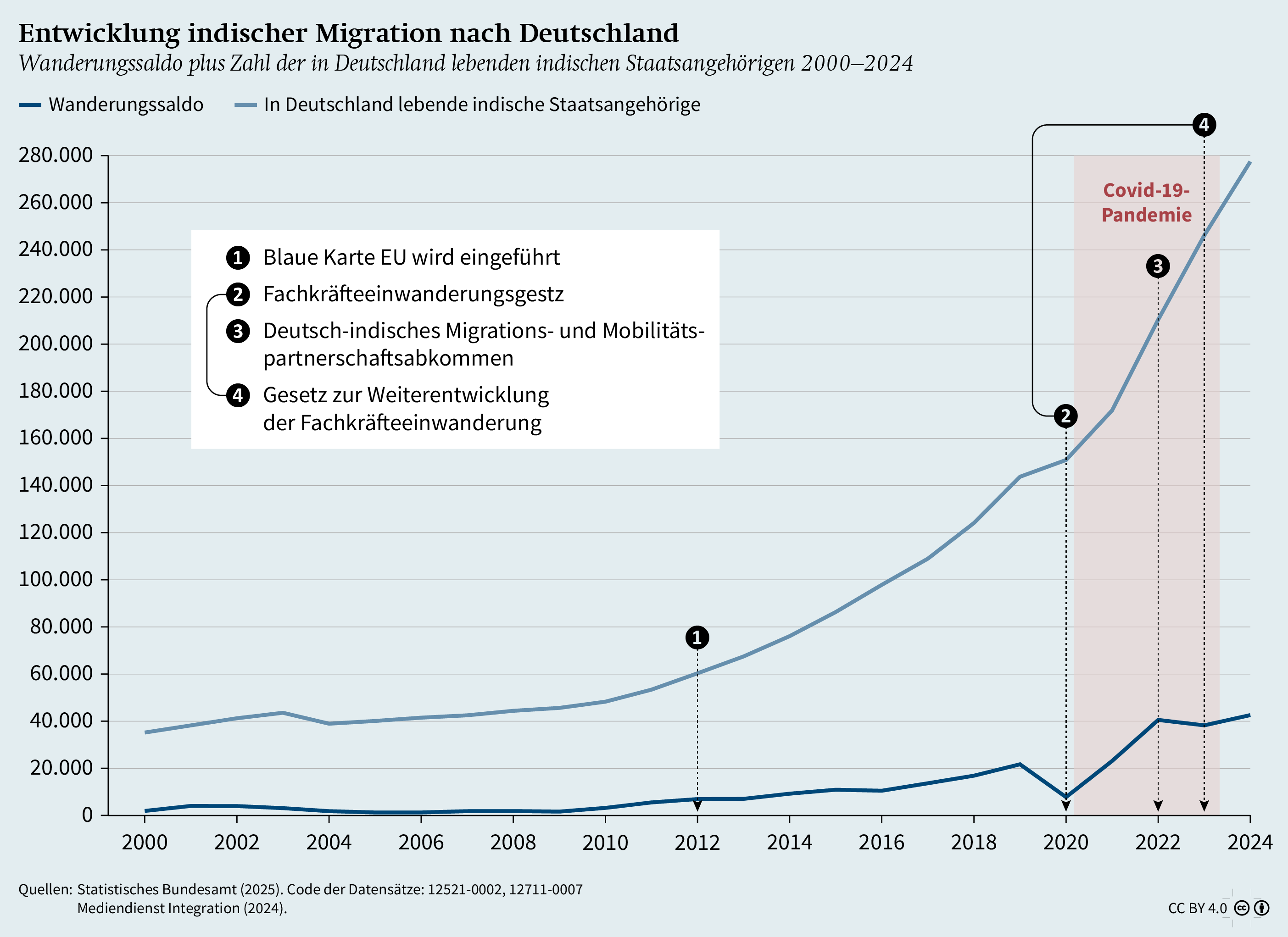Migrationswunder Indien?
Chancen und Herausforderungen der indischen Migration nach Deutschland
SWP-Studie 2025/S 12, 01.08.2025, 37 Pagesdoi:10.18449/2025S12
Research AreasDavid Kipp ist Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Globale Fragen. Diese Studie wurde verfasst im Rahmen des vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geförderten Projekts »Strategische Flucht- und Migrationspolitik«.
Der Autor dankt Emma Landmesser, Janna Langosch und Arthur Buliz für ihre Unterstützung.
-
Die Zahl indischer Migrant:innen in Deutschland ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Sie helfen hierzulande besonders den Fachkräftemangel in MINT-Berufen zu lindern.
-
Indien ist das wichtigste Herkunftsland für Arbeits- und Bildungsmigration. Das Profil der Migrant:innen wandelt sich derzeit. Es kommen weniger Expert:innen mit der Blauen Karte EU, dem wichtigsten Aufenthaltstitel für hochqualifizierte Arbeitskräfte, und mehr Studierende, Auszubildende und beruflich qualifizierte Personen zur Jobsuche oder Anerkennung von Qualifikationen.
-
Das 2022 zwischen Berlin und Neu-Delhi geschlossene Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen (MMPA) ergänzt den deutschen Rechtsrahmen zur Fachkräftegewinnung nicht durch zusätzliche Zugangswege. Doch es verbessert die praktische Umsetzung selbstorganisierter Migration aus Indien, etwa durch beschleunigte Visaverfahren.
-
Die Gemeinsame MMPA-Arbeitsgruppe bietet die Möglichkeit, im Dialog mit der indischen Regierung die Potentiale der zunehmenden Migration zu nutzen, aber auch die daraus erwachsenden Herausforderungen zu meistern, etwa die unzureichende Regulierung privater Vermittlungsagenturen.
-
Das Beispiel Indien zeigt, dass Deutschland über seine Außenstrukturen noch viel stärker im Herkunftsland ansetzen muss, um – mit Hilfe der migrationsbezogenen Entwicklungszusammenarbeit – neue Konzepte zur fairen und erfolgreichen Fachkräftegewinnung für Deutschland zu erarbeiten.
-
Die Migrationskooperation mit Indien ist ein verbindendes Element in den wichtiger werdenden deutsch-indischen Beziehungen. Themen bilateraler Kooperation wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Klimaschutz sollten systematisch mit Wissensaustausch und der Mobilität von Fachkräften in der jeweiligen Branche verbunden werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Problemstellung und Empfehlungen
2.1 Historische und gesellschaftliche Faktoren
2.2 Neuere Trends internationaler Migration
2.3 Entwicklung indischer Migration nach Deutschland
3 Grundlagen, gesetzlicher Rahmen und Akteure der deutsch-indischen Migrationskooperation
3.1 Grundlagen der bilateralen Migrationskooperation
3.1.1 Das Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen (MMPA)
3.1.2 Fachkräftestrategie Indien
3.2 Gesetzlicher Rahmen und staatliche Akteure
3.3 Nichtstaatliche Vermittlungsakteure
4 Chancen und Herausforderungen der Migrationskooperation
4.1 Unterschiedliche Erwartungen an die Migrationskooperation
4.2 Steuerung der Erwerbsmigration
4.3 Bildungsmigration – großes Interesse erfordert bessere Auswahlverfahren
4.4 Rückkehrpolitik – (k)ein großes Problem
5 Weiterentwicklung der deutschen Außenstrukturen in Indien
5.1 Worauf es in den deutschen Außenstrukturen ankommt
5.2 Migrationsbezogene Entwicklungszusammenarbeit mit Indien neu definieren
Problemstellung und Empfehlungen
Die neue Bundesregierung betont, mit ihrer Migrationspolitik irreguläre Ankünfte begrenzen und staatliche Kontrolle stärken zu wollen. Weniger Aufmerksamkeit erhält hingegen die Herausforderung, qualifizierte Zuwanderung aus Drittstaaten weiterzuentwickeln, um dem demographischen Rückgang des Erwerbspersonenpotentials in Deutschland entgegenzuwirken. Doch auch hier hat die Bundesregierung erklärt, mit einer zentralen, digitalen Bundesagentur für Einwanderung (»Work-and-Stay-Agentur«) die Hürden abbauen zu wollen, welche die Wirkung des in den letzten Jahren weiter liberalisierten Rechtsrahmens für die Fachkräftegewinnung noch bremsen.
Allein durch diese Maßnahmen lässt sich die erwünschte Fachkräftegewinnung jedoch nicht gestalten. Selbst moderne Gesetze und digitale Verfahren entfalten erst dann die erwünschte Wirkung, wenn sie in eine nachhaltige migrationspolitische Kooperation mit Herkunftsländern eingebettet sind. Das wird an dem Land exemplarisch deutlich, das sich zum größten Herkunftsland von Erwerbs- und Bildungsmigration in Deutschland entwickelt hat: Indien.
Die Zahl indischer Staatsangehöriger in Deutschland hat sich von 86.000 im Jahr 2015 auf 280.000 im Jahr 2025 mehr als verdreifacht. Dennoch sinkt die ohnehin niedrige Zahl der Asylanträge aus Indien weiter. Der Anteil an Hochqualifizierten, vor allem in Berufen der Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik (MINT), ist überdurchschnittlich. Mittlerweile gibt es 50.000 indische Studierende an deutschen Hochschulen. Aufgrund dieser Entwicklungen gilt die indische Migration nach Deutschland als Erfolgsmodell. Einige Beobachter sprechen deshalb gar von einem »Migrationswunder«.
Deutschland hat mit Indien im Jahr 2022 ein Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen (MMPA) geschlossen, das die Voraussetzungen für »sichere, geordnete und reguläre Migration« aus Indien nach Deutschland weiter verbessern soll. In der vorliegenden Studie wird untersucht, welche Lernprozesse sich in der deutschen Migrationspolitik im Zuge der vertieften Migrationskooperation mit Indien beobachten lassen und welche Chancen und Herausforderungen sich aus der indischen Migration nach Deutschland ergeben.
Indien verfügt über eine Vielzahl an Institutionen, Programmen und bilateralen Übereinkünften zur Migrationskooperation. Zum einen ist die indische Regierung vorrangig daran interessiert, auf diese Weise den heimischen Arbeitsmarkt zu entlasten, auf dem jährlich sieben bis neun Millionen neue Arbeitsplätze für die wachsende Erwerbsbevölkerung geschaffen werden müssten. Zum anderen möchte sie Migration nutzen, um die außenpolitischen Beziehungen sowie die strategische Rolle der Diaspora zu stärken und den Zufluss von Rücküberweisungen zu sichern. Gemessen an diesen Ambitionen ist die Migrationsgovernance nur schwach ausgeprägt, auch weil eine überfällige Reform des indischen Migrationsgesetzes immer wieder verschoben wurde. Auf zentralstaatlicher Ebene fehlen vertrauenswürdige Partnerinstitutionen für die Fachkräfterekrutierung. Deutsche Anwerbebemühungen setzen bisweilen auf der subnationalen Ebene, also bei den indischen Bundesstaaten an, die teilweise eher über vertrauenswürdige Strukturen verfügen als die Zentralregierung.
In den meisten Fällen wenden sich Inder:innen jedoch nicht an staatliche Institutionen, sondern an private Vermittlungsagenturen, wenn sie für Arbeit, Studium oder Ausbildung ins Ausland gehen wollen. Zusammengenommen bilden diese Agenturen eine über Jahrzehnte gewachsene Migrationsinfrastruktur, die es Migrant:innen ermöglicht, die schnellsten und einfachsten Migrationswege in unterschiedliche Zielländer zu identifizieren. Allerdings sind immer wieder betrügerische Geschäftspraktiken zu beobachten, weil es an Transparenz, Qualitätsstandards und staatlicher Regulierung fehlt.
Viele private Vermittlungsagenturen haben ihre Aktivitäten in jüngster Zeit verstärkt auf Deutschland ausgerichtet. Das hängt auch damit zusammen, dass sich Deutschland in den letzten Jahren mit dem reformierten Fachkräfteeinwanderungsgesetz für Fachkräfte und Studierende weiter geöffnet hat. Dagegen haben sich traditionelle Zielländer indischer Migration wie die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Kanada und Australien zuletzt restriktiver verhalten. Die Golfstaaten ziehen vor allem geringqualifizierte indische Migrant:innen an, deren Lebens- und Arbeitsbedingungen dort meist immer noch schlecht sind. Obwohl private Vermittlungsagenturen für die Migration von Inder:innen außerordentlich wichtig sind, wird im MMPA nicht auf sie hingewiesen. Die Bundesregierung hat dies mit ihrer im Oktober 2024 verabschiedeten »Fachkräftestrategie Indien« korrigiert. Das ist ein guter Ausgangspunkt, um zusammen mit der indischen Regierung in der Gemeinsamen MMPA-Arbeitsgruppe neue Instrumente zu entwickeln, die private Vermittlungsagenturen bei der Fachkräftegewinnung berücksichtigen und gleichzeitig besser regulieren.
Die Zahl indischer Studierender an deutschen Hochschulen nimmt stetig zu. Trotz der Internationalisierung seit Mitte der 2000er Jahre ist das deutsche Hochschulsystem noch nicht ausreichend auf die Vielzahl indischer Studierender eingestellt. Zum Beispiel fehlen belastbare Auswahlmethoden für die zahlreichen Bewerbungen aus Indien, was die Qualitätskontrolle erschwert. Und trotz des großen Fachkräftepotentials sind Instrumente zur Integration indischer Studienabsolventen in den deutschen Arbeitsmarkt noch nicht hinlänglich entwickelt. Zudem hat sich ein Geschäftsmodell einiger privater Vermittlungsagenturen in Indien zusammen mit Privatuniversitäten in Deutschland entwickelt, bei dem junge Inder:innen hohe Gebühren für einen Studienplatz zahlen und zugleich mangelhafte Studienbedingungen vorfinden. Wegen der entstandenen Schulden sind viele indische Studierende auf befristete Verdienstmöglichkeiten in der Gig Economy angewiesen. Es handelt sich dabei um Dienstleistungen wie Essenslieferungen, die ohne festes Arbeitsverhältnis über Plattformen vermittelt werden.
Trotz dieser Herausforderungen bietet die indische Migration auch viele Chancen. Die intensivierte deutsche Kooperation mit Indien in diesem Politikfeld ist auch im Kontext der steigenden internationalen Bedeutung Indiens zu sehen. Für die Verstärkung der bilateralen Beziehungen eignet sich Migration gut als verbindendes Kooperationsthema. Dabei müssen Synergien mit anderen Kooperationsthemen geschaffen werden. Auch die umfangreiche bilaterale Entwicklungszusammenarbeit (EZ) mit Indien sollte sich noch weiter für die migrationsbezogene Zusammenarbeit öffnen. Das Ziel sollte sein, gemeinsam mit indischen Partnern die strukturellen Voraussetzungen zu schaffen, dass die Migration aus Indien nach Deutschland (und in andere Zielländer) möglichst fair gestaltet werden kann. Zusätzlich sollte die EU-Ebene bei all diesen Bemühungen mitgedacht werden, damit sich die Kooperationsbemühungen der einzelnen Mitgliedstaaten nicht konterkarieren und die Kooperationsinstrumente der EU in der Migrationspolitik auf einen neuen Stand gebracht werden können.
Trends indischer Migration
Mit 1,46 Milliarden Einwohner:innen hat Indien als inzwischen bevölkerungsreichstes Land der Erde schon aufgrund seiner Größe besondere Bedeutung für internationale Migrationsbewegungen. Während die Auswanderungsbewegungen indischer Migrant:innen in die Golfstaaten und klassischen Einwanderungsländer wie die USA historisch gewachsen sind, hat die Wanderung über die neueren Routen nach Deutschland und in andere Länder der EU erst im vergangenen Jahrzehnt deutlich an Fahrt gewonnen.
Historische und gesellschaftliche Faktoren
Die heutigen Migrationsbewegungen aus Indien können nicht ohne ihre historischen Vorläufer verstanden werden. Im 19. Jahrhundert etablierte die britische Kolonialherrschaft ein System temporärer (Zwangs-)Arbeitsmigration, im Zuge dessen mehrere Millionen Inder:innen in britische Kolonien weltweit verschifft und dort ausgebeutet wurden.1 Der Abzug der Briten im Jahr 1947 und die damit verbundene Teilung Britisch-Indiens in Indien und Pakistan sind ein einmaliges Ereignis, sowohl mit Blick auf Ausmaß als auch Geschwindigkeit der (erzwungenen) Wanderungsbewegungen. Binnen vier Jahren nach der Teilung flohen insgesamt 14,5 Millionen Menschen in beide Richtungen.2 Lange spiegelte sich dies in den Migrationsstatistiken der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen (UN Department of Economic and Social Affairs, UN DESA) wider, die bis Mitte der 2000er Jahre Pakistan als wichtigstes Zielland von in Indien geborenen Menschen anführte. Die Zahl ist jedoch von 2,8 Millionen im Jahr 1990 auf 1,6 Millionen im Jahr 2024 zurückgegangen.3
In den 1990er Jahren nahmen die Auswanderungsbewegungen aus Indien in Richtung westlicher Einwanderungsländer Fahrt auf, allen voran in die Vereinigten Staaten.4 Dort und in anderen westlichen Zielländern haben die indischen Migrant:innen gegenüber der Gesamtbevölkerung einen überdurchschnittlich hohen sozioökonomischen Status erreicht. Davon unterscheiden sich die Lebensbedingungen jener indischen Migrant:innen erheblich, die seit den 1970er Jahren in die Golfstaaten gezogen sind. Es handelte sich dabei meist um geringqualifizierte Menschen, die über Jahrzehnte hinweg mit Ausbeutung, schlechten Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsverstößen konfrontiert waren.5 Noch heute sind die meisten indischen Arbeitsmigrant:innen dort im Niedriglohnsektor tätig, auf Baustellen, im Gastgewerbe oder in Transport und Logistik, und das häufig nur zeitweise. Zudem stagniert das Lohnniveau für indische Arbeitsmigrant:innen, während die Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind.6 Doch diese Widrigkeiten tun den Wanderungsbewegungen in die Golfstaaten keinen Abbruch. Für viele Migrant:innen ist es auch eine Frage sozialer Erwartungen: In Bundesstaaten mit einer langen Auswanderungstradition wie Kerala wird im familiären und gesellschaftlichen Umfeld nicht selten erwartet, dass Menschen zum Arbeiten in Länder am Golf gehen. Das hängt mit der Aussicht auf vergleichsweise hohe Verdienstmöglichkeiten aufgrund der Einkommensdisparitäten zusammen. In den Golfstaaten insgesamt sind die Einkommen durchschnittlich etwa 120 Prozent und in den VAE sogar 300 Prozent höher als in Indien.7
Gleichzeitig beschränkt sich die indische Migration in die Golfstaaten nicht auf geringqualifizierte Arbeitskräfte, denn auch gut ausgebildete Inder:innen haben sich dort etabliert.8 Oft gehen sie hochqualifizierten Tätigkeiten nach, etwa im Gesundheitssektor, in der Tech-Industrie, im Finanzwesen, aber auch in Führungspositionen großer Unternehmen. Der beträchtliche Einfluss indischer Staatsangehöriger lässt sich zudem daran ablesen, dass sie in großem Stil in den Golfstaaten investieren. Auffallend sind besonders die prestigeträchtigen Immobilien und wirtschaftlichen Investitionen in den emiratischen Metropolen wie Abu Dhabi und Dubai. Dort sind indische Staatsangehörige für 30 Prozent aller Start-up-Gründungen verantwortlich.9
Die Motive für die Auswanderung aus Indien sind vielfältig. Wanderungsentscheidungen werden unter anderem durch die zunehmende Autokratisierung im Land oder die anhaltende Diskriminierung beeinflusst.10 Das hängt mit dem wichtigen Faktor der Religions- und Kastenzugehörigkeit zusammen. So gehören etwa 80 Prozent der indischen Bevölkerung dem Hinduismus an, aus dem sich das System der Kasten ableitet, die in ländlichen Regionen die Lebensumstände prägen. Die Auswanderung von Hindus in Länder wie Deutschland bedeutet oft eine Abkehr vom Kastensystem, die als Belastung oder Befreiung empfunden werden kann.11
In klassischen Einwanderungsländern wie den USA entstammen indische Migrant:innen häufig gesellschaftlich privilegierten Schichten.12 Religiöse Minderheiten wie Christen und Sikhs sind in den Vereinigten Staaten ebenfalls überrepräsentiert. Der Anteil von Christ:innen an der Gesamtzahl indischer Migrant:innen dort lag 2012 bei 18 Prozent (gegenüber 2,3 Prozent in Indien), von Sikhs bei 5 Prozent (1,7 Prozent in Indien). Hindus und Muslime waren hingegen unterrepräsentiert.13 Muslimische Inder:innen und untere Kasten sind besonders in den Golfstaaten präsent. Gleichzeitig besteht Kastendiskriminierung in wichtigen Zielländern fort, wie im Vereinigten Königreich oder den USA.14 Kalifornien hat als erster US-Bundesstaat die Praxis der Benachteiligung in seine Antidiskriminierungsgesetze aufgenommen. Das Gesetz definiert »Kaste« als System sozialer Hierarchie, das oft durch Geburt bestimmt wird und soziale Privilegien mit sich bringt oder Benachteiligungen verursacht.15
Neuere Trends internationaler Migration
Es existieren unterschiedliche Zahlen zur internationalen Migration aus Indien. Während es laut UN DESA Mitte 2024 etwa 18,5 Millionen indische Migrant:innen weltweit gab,16 spricht das indische Außenministerium von etwa 35,4 Millionen Inder:innen im Ausland.17 Die Unterschiede entstehen, weil UN DESA nur im Ausland geborene Inder:innen zählt, während das indische Außenministerium neben etwa 15,9 Millionen sogenannten nichtansässigen Staatsangehörigen (Non-resident Indians, NRIs) knapp 20 Millionen indische Staatsangehörige im Ausland sowie Nachkommen indischer Herkunft als Persons of Indian Origin (PIOs) erfasst.
Die wichtigsten Auswanderungsziele waren laut UN DESA zum einen die Golfstaaten, allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit 3,2 Millionen, Saudi-Arabien mit 2 Millionen und Kuweit mit 1,2 Millionen indischen Migrant:innen, zum anderen westliche Industriestaaten, besonders die USA mit 3,2 Millionen indischen Migrant:innen, von denen knapp die Hälfte die US-Staatsbürgerschaft besaß.18 Danach folgte das Vereinigte Königreich mit einer Million indischer Migrant:innen, wobei laut britischem Zensus aus dem Jahr 2021 eine ähnlich große Zahl britischer Staatsangehöriger eine indische Herkunft hat.19 Es ist unklar, ob die Zahlen von UN DESA bereits die neuste Dynamik der Neuzuwanderung abbilden, da allein in den beiden Jahren 2023 und 2024 eine halbe Million indische Migrant:innen ins Vereinigte Königreich einwanderten.20 In Kanada leben ungefähr eine Million indische Migrant:innen und laut Zensus von 2021 eine ähnlich große Zahl kanadische Staatsangehörige indischer Herkunft.21
Bildung ist ein wichtiger Treiber indischer Migration. Doch viele westliche Zielländer wollen die Zahl indischer Studierender begrenzen.
In Australien hat sich die Zahl indischer Migrant:innen innerhalb der letzten Dekade auf 900.000 verdoppelt. Eine maßgebliche Rolle hierbei spielt die Studierendenmigration. So wurden zwischen Juli 2022 und Juni 2023 mehr als 100.000 Studierendenvisa ausgestellt. Diese Zahl wurde auf Wunsch der australischen Regierung für den Zeitraum Juli 2023 bis Juni 2024 wieder auf gut 50.000 Studierendenvisa gesenkt.22 Die kanadische23 und die britische Regierung24 haben ebenfalls Maßnahmen zur Reduzierung der Zuwanderungszahlen beschlossen, die auch die weitere Migration aus Indien erschweren wird.
Auch die Vereinigten Staaten haben seit der Amtsübernahme von Präsident Trump unterschiedliche Restriktionen für indische Migrant:innen eingeführt und die Abschiebung von Inder:innen ohne gültigen Aufenthaltsstatus forciert. Die indische Regierung hat sich bereiterklärt, rund 18.000 Staatsangehörige zurückzunehmen, die sich irregulär in den USA aufhielten, unter anderem um das Verhältnis zur US-Regierung zu verbessern und legale Visaprogramme zu sichern.25 Doch die Zahl indischer Migrant:innen ohne gültigen Aufenthaltsstatus in den Vereinigten
Staaten ist deutlich höher. Sie lag im Jahr 2022 bei schätzungsweise 375.000.26 In den Jahren 2023 und 2024 kamen knapp 190.000 Personen irregulär hinzu – vor allem über die sogenannte Donkey-Flight-Route, eine Schleusungsstrecke, die durch mehrere Länder Zentralamerikas bis an die mexikanisch-amerikanische Grenze führt.27 Neben den USA fungiert Kanada zunehmend nicht nur als Ziel-, sondern verstärkt auch als Transitland für die Weiterreise in die Vereinigten Staaten.
In der EU und im Schengen-Raum sind die Zahlen irregulärer Ankünfte aus Indien deutlich niedriger. Der Großteil findet auf regulären Wegen statt. Laut der EU-Statistikbehörde (Eurostat) gab es Ende 2023 842.000 indische Staatsangehörige mit gültigem Aufenthaltstitel in der EU,28 wovon 208.000 auf neu erteilte Aufenthaltstitel entfielen.29 Im selben Jahr wurden 967.000 kurzzeitige Visa aus Indien für den Schengen-Raum beantragt, wovon knapp 85 Prozent bewilligt wurden.30 Die Zahl der Asylanträge indischer Staatsangehöriger belief sich EU-weit im selben Jahr auf 8.400 und ist im Folgejahr 2024 leicht auf 8.120 zurückgegangen.31 Lediglich im Jahr 2022 gab es mit über 25.000 Asylanträgen einen kurzen Ausschlag nach oben, wovon beinahe 20.000 Asylanträge in Österreich gestellt wurden. Dem lag eine irreguläre Wanderungsroute über Serbien zugrunde, wo indische Staatsangehörige zum damaligen Zeitpunkt noch visafrei einreisen konnten. Nach Änderung der serbischen Visapraxis und des österreichisch-indischen Migrations- und Mobilitätsabkommens hat diese Route jedoch wieder an Bedeutung verloren.32
Außerdem wurden danach vereinzelte Fälle indischer Staatsangehöriger bekannt, die versucht haben, über Russland und Belarus in die EU und nach Deutschland zu kommen.33 Die Aussichten für indische Staatsangehörige auf Asyl in der EU sind gering, auch wenn der Anteil der positiven Bescheide aller erstinstanzlichen Entscheidungen EU-weit von 1,8 Prozent im Jahr 2022 auf 2,3 Prozent 2023 und 4 Prozent 2024 gestiegen ist.34
Entwicklung indischer Migration nach Deutschland
Die Zuwanderung aus Indien nach Deutschland ist historisch gewachsen, wenngleich bis Anfang der 2010er Jahre nur in kleinen Zahlen. Sie kann in vier Phasen unterteilt werden:35 Den ersten Schritt in die Bundesrepublik machten seit den 1950er Jahren indische Studierende der Ingenieurswissenschaften und Medizin, gefolgt von der durch die Katholische Kirche organisierten Anwerbung von 6.000 Krankenschwestern aus dem Bundestaat Kerala ab den späten 1960er Jahren.36 1970 lebten gut 8.000 indische Staatsangehörige in Deutschland.37 Die dritte Phase wurde durch die erzwungene Migration von Punjabis und Sikhs infolge der Unruhen im indischen Bundesstaat Punjab Anfang der 1980er Jahre geprägt. Daraufhin stieg die Zahl indischer Staatsangehöriger auf über 28.000, ging bis zur Wiedervereinigung aber etwas zurück.38 In der DDR gab es hingegen keine systematische Anwerbung indischer Arbeitskräfte, wohl aber eine ungewisse Zahl indischer Studierender.39
Eine vierte Einwanderungsphase wurde im wiedervereinigten Deutschland in den Jahren 2000 bis 2004 mit der Einführung einer deutschen Greencard eingeläutet.40 Allerdings hatte dieser Versuch keinen durchschlagenden Erfolg, denn statt dem ausgegebenen Ziel von 20.000 wurden weniger als 15.000 IT-Fachkräfte angeworben, davon knapp 4.000 aus Indien.41
Einen Quantensprung für die Zuwanderungszahlen aus Indien brachte erst die Einführung der Blauen Karte EU im Jahr 2012, die es Drittstaatsangehörigen erleichterte, zum Zwecke der Erwerbstätigkeit in die EU einzureisen. So stieg die Zahl indischer Staatsangehöriger von 40.000 im Jahr 2005 auf 86.000 im Jahr 2015. Anfang 2025 lebten etwa 280.000 indische Staatsangehörige42 in Deutschland, von denen über 152.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind.43 Der Wanderungssaldo ist mit Ausnahme des Coronajahres 2020 stetig größer geworden,44 obgleich auch die Zahl der Fortzüge indischer Staatsangehöriger aus Deutschland in den vergangenen Jahren leicht angestiegen ist.45
Die Migrationsbewegungen aus Indien nach Deutschland diversifizieren sich.
Betrachtet man die Daten der erteilten Visa für indische Staatsangehörige, so dominiert die Migration aus Erwerbs-, Bildungs- oder familiären Gründen nach Deutschland. Bei der Erwerbsmigration deutet sich seit 2023 eine Veränderung an: Rückläufig sind die Visaerteilungen für eine Blaue Karte EU (gesunken von 8.405 Visa für indische Staatsangehörige im Jahr 2022 auf 5.151 im Jahr 2023 und 3.276 im Jahr 2024) und die konzerninterne Entsendung.46 In anderen Beschäftigungsbereichen hingegen, etwa der Pflege, aber auch in der Ausbildungsmigration, nehmen die Zahlen auf niedrigem Niveau zu. Besonders nachgefragt wird die Chancenkarte, die im Juni 2024 mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung eingeführt wurde. Es handelt sich um ein punktebasiertes Einwanderungsinstrument, das qualifizierten Fachkräften – auch ohne Arbeitsvertrag – einen zunächst auf ein Jahr befristeten Aufenthaltstitel zur Jobsuche oder Anerkennung von Qualifikationen in Deutschland mit dem Ziel ermöglicht, später in einen dauerhaften Erwerbstitel zu wechseln. Von allen in den ersten elf Monaten seit Juni 2024 bearbeiteten Visaanträgen auf diesen Aufenthaltstitel entfielen über 4.000, also ein Drittel, auf indische Staatsangehörige.47 Dagegen ging die Zahl der Asylanträge indischer Staatsangehöriger in Deutschland zuletzt von einem ohnehin niedrigen Niveau weiter zurück (auf 1.543 im Jahr 202448 nach 2.485 im Jahr 202349). Anfang 2024 lebten indes 4.037 ausreisepflichtige Inder:innen in Deutschland, wovon 3.353 geduldet waren.50
Seit Anfang der 2010er Jahre hat sich auch die Geschlechterverteilung der Zuwanderung aus Indien verändert: Das Ungleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Migrant:innen, das im Jahr 2012 bei 70 zu 30 Prozent lag,51 hat sich im Jahr 2023 auf 60 zu 40 Prozent abgeschwächt.52 Der Großteil der aus Indien Zugezogenen hegte laut einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Jahr 2021 einen dauerhaften Bleibewunsch, 37 Prozent aller indischen Migrant:innen haben demnach bereits die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten.53
Im Jahr 2024 hat die Zahl der Visa zu Studienzwecken die Marke von 25.000 überschritten und die Visa zu Erwerbsmigration überholt.54 Mehr als 50.000 indische Studierende waren 2024 an deutschen Hochschulen immatrikuliert. Damit bilden sie die nun größte Gruppe internationaler Studierender in Deutschland. Zwischen dem Wintersemester 2018/19 und dem Wintersemester 2023/24 hat sich ihre Zahl um 138 Prozent erhöht.55 Hauptziele der Migration aus Indien in Deutschland, nicht zuletzt aufgrund der dortigen Hochschulen, sind Berlin mit mittlerweile über 40.000 Personen (2014 lebten nur 3.500 Personen indischer Herkunft in Berlin),56 gefolgt von München und Frankfurt am Main. Die wachsende Zahl an indischen Migrant:innen schlägt sich unter anderem in den steigenden Rücküberweisungen aus Deutschland nach Indien nieder. Laut Schätzungen der Bundesbank sind sie von 131 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 164 Millionen Euro im Jahr 2024 gestiegen, was einem Plus von etwa 25 Prozent entspricht.57
Grundlagen, gesetzlicher Rahmen und Akteure der deutsch-indischen Migrationskooperation
Im Mai 2022 wurde bei den deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Berlin Migration als neues Politikfeld aufgenommen, das in den zwei Jahrzehnten zuvor bereits langsam an Relevanz gewonnen hatte. In diesem Kontext wurde das bilaterale Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen (MMPA)58 geschlossen, das die Kooperationsbemühungen der beiden Seiten verstärkt hat. Flankiert wurde das auf deutscher Seite durch eine weitere Liberalisierung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sowie einer eigenen »Fachkräftestrategie Indien«.
Grundlagen der bilateralen Migrationskooperation
Das Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen (MMPA)
Anfang der 2000er Jahre hat Deutschland mit dem Sofortprogramm zur Deckung des IT-Fachkräftebedarfs (Greencard) und in den 2010er Jahren mit der Blauen Karte EU den Weg für die Fachkräftezuwanderung aus Indien in größerem Maßstab geöffnet. Parallel wurde 2011 zwischen den beiden Ländern ein bilaterales Sozialversicherungsabkommen zur Rentenversicherung eingeführt. Darin ist geregelt, dass die in einem der beiden Länder geleisteten Sozialversicherungsbeiträge auch im jeweils anderen Land berücksichtigt werden, um Ansprüche auf Rentenleistungen zu sichern.59
Der Unterzeichnung des MMPA gingen mehrere Jahre an Verhandlungen voraus, wobei das federführende Bundesministerium des Innern (BMI) im Jahr 2019 zunächst vorrangig über ein bilaterales Abkommen zur Rückübernahme indischer Staatsangehöriger verhandeln wollte.60 Inspiriert durch ein im März 2018 vereinbartes Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen zwischen Frankreich und Indien,61 entwickelte sich im bilateralen Dialog die Initiative für ein breiter angelegtes Abkommen. Es dauerte einige Zeit, ehe es nicht mehr von der damaligen Großen Koalition, sondern von der Bundesregierung Scholz fertig verhandelt und im Rahmen der Regierungskonsultationen im Mai 2022 unterzeichnet wurde. Dies war das erste neuere bilaterale Migrationsabkommen, dem unter der damals noch neuen Bundesregierung weitere folgen sollten.62 Mit der Unterzeichnung wurde auch der zunehmenden außenpolitischen Bedeutung Indiens Rechnung getragen. Sie wurde in Kabinettsbeschlüssen festgehalten, so im Jahr 2020 in den Indo-Pazifik-Leitlinien63 und zuletzt im Oktober 2024 mit dem »Fokus auf Indien«.64
Das MMPA folgt in weiten Teilen der Logik des Abkommens zwischen Frankreich und Indien und hat den Anspruch, Migration umfassend zu regeln: Auf der einen Seite soll die Mobilität indischer Studierender, Auszubildender und Fachkräfte gefördert, auf der anderen Seite die Rückübernahmekooperation gestärkt werden. Während die Bundesregierung besonders das Ziel der verbesserten Rückübernahmekooperation hervorhob,65 betonte die indische Regierung die Notwendigkeit beschleunigter Visaverfahren.66 Auch begrifflich wird eine Brücke zwischen den beiden Vertragsparteien geschlagen, da es sich um ein Migrations- und Mobilitätsabkommen handelt. Die indische Regierung bevorzugt den Begriff »Mobilität« gegenüber dem aus ihrer Sicht eher negativ konnotierten Begriff »Migration«.
Das Abkommen enthält eine Reihe von unverbindlichen Absichtserklärungen, die jedoch nicht über den bestehenden Rechtsrahmen hinausgehen. Am konkretesten ist das in Artikel 6 des Abkommens formulierte Ziel, jährlich mindestens 3.000 junge indische Arbeitskräfte nach Deutschland zu bringen.67 Zudem werden ausführliche Regeln zur Rückführung ausreisepflichtiger indischer Staatsangehöriger, zur freiwilligen Rückkehr und Reintegration sowie zur Bekämpfung von irregulärer Migration und Menschenhandel festgehalten (Artikel 12–14). Gemäß Artikel 16 wurde eine Gemeinsame Arbeitsgruppe zu Migrations- und Rückkehrfragen eingerichtet. Damit ist gewährleistet, dass die Umsetzung des Abkommens überwacht wird. Die Arbeitsgruppe trifft sich regelmäßig, mindestens einmal im Jahr. Federführend ist das BMI, für Rückkehrfragen ist eine eigene Unterarbeitsgruppe vorgesehen. Im April 2025 wurde außerdem eine Unterarbeitsgruppe Erwerbsmigration geschaffen, die vom Auswärtigen Amt (AA), vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und von ihren indischen Gegenparts geleitet wird.
Bei dem MMPA mit Indien – wie bei den während der Folgejahre vereinbarten Migrationsabkommen mit Georgien und Kenia – handelt es sich um einen völkerrechtlichen Vertrag. Mit Marokko und Kolumbien hat die Bundesregierung dagegen informelle Vereinbarungen getroffen, was mehr Flexibilität erlaubt und es ermöglicht, auf innenpolitische Sensibilitäten im Partnerland Rücksicht zu nehmen.68 Der Vorteil völkerrechtlicher Verträge liegt darin, dass die Kooperation nicht so stark von wechselnden Prioritäten und Regierungen abhängt. Im Kontext der Golf-Migration hat Indien zudem mit völkerrechtlichen Migrationsabkommen mit Saudi-Arabien tendenziell bessere Erfahungen gemacht als mit den unverbindlichen Absichtserklärungen, welche die indische Regierung mit anderen Golfstaaten wie Oman oder Bahrain formuliert hat.69
Fachkräftestrategie Indien
Nachdem das BMI in Zusammenarbeit mit dem AA das MMPA vereinbart hat, ist für die Umsetzung die gesamte Bundesregierung gefragt. Das BMAS hat in der letzten Legislaturperiode besonderen politischen Gestaltungswillen beim Thema Fachkräfteanwerbung aus Indien entwickelt und zusammen mit dem AA im Herbst 2024 eine entsprechende Strategie veröffentlicht.70
Darin wird auf ein verbessertes Matching indischer Fachkräfte mit Unternehmen in Deutschland gesetzt, ebenso wie auf mehr Bemühungen zur Vermittlung der deutschen Sprache in Indien, unter anderem durch mehr Online-Sprachkurse. Überdies sollen die wirtschaftliche und wissenschaftliche Kooperation ausgebaut sowie Partnerschaften mit indischen Einrichtungen im Bereich der höheren Bildung, aber auch der Berufsbildung intensiviert werden. Anhand einer Reihe von Maßnahmen sollen die zielgerichtete Ansprache sowie Informationen zu regulären Zugangswegen nach Deutschland vorangebracht werden. Zu diesem Zweck ist unter anderem geplant, das Web-Informationsportal »Make it in Germany« landesspezifisch weiterzuentwickeln, mit indischen Influencern in Sozialen Medien zusammenzuarbeiten sowie Fachmessen in Indien zu nutzen.
Die Fachkräftestrategie enthält Maßnahmen, mit denen die bereits im MMPA angekündigte Anerkennung indischer Berufsqualifikationen ebenso verbessert werden soll wie die für die Einwanderung von Fachkräften erforderlichen Verwaltungsprozesse im In- und Ausland. Dafür wurde eine neue Unterarbeitsgruppe gegründet, die sich Fragen der Erwerbsmigration fachlich getrennt von der Rückkehrpolitik widmen soll. Zwar mag die Fachkräftestrategie im Vergleich zum MMPA eher eine Momentaufnahme als eine langfristige Strategie darstellen. Sie hat aber die Potentiale der Migrationskooperation für beide Seiten öffentlichkeitswirksam unterstrichen sowie erstmals die enorme Bedeutung privater Vermittlungsakteure anerkannt und deren Qualitätssicherung zum Thema der weiteren Kooperation gemacht.71
Gesetzlicher Rahmen und staatliche Akteure
Nach einer Reform im Jahr 2020 wurde das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2023 erneut novelliert und der ohnehin liberale Rechtsrahmen für die Arbeitsmigration aus Drittstaaten weiter geöffnet. Schon 2013 sprach die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) davon, dass Deutschland die liberalsten Zuwanderungsregelungen für Fachkräfte und Hochqualifizierte aller OECD-Länder habe.72 Anders als in Ländern wie Italien und Spanien ist das deutsche Migrationsrecht jedoch grundsätzlich nicht darauf ausgerichtet, größere Kontingente von Arbeitskräften aus dem Ausland aufzunehmen.73 Deshalb werden im MMPA keine verbindlichen Zielgrößen für die Arbeitsmigration oder privilegierte Regeln für die Migration aus Indien festgelegt. Angestrebt wird lediglich, die Regeln wohlwollend auszulegen sowie die Voraussetzungen für die Kooperation der staatlichen Akteure auf beiden Seiten zu stärken und zu verbessern. Auf deutscher Seite ist damit beispielsweise die fortwährende Präsenz der Goethe-Institute und -Zentren in Indien gemeint, während diese in anderen Ländern zuletzt geschlossen wurden.74
Unterschiedliche Fachministerien auf beiden Seiten haben eine Kooperation vereinbart. Auf deutscher Seite sind das AA sowie das BMAS maßgeblich beteiligt. Das AA ist über das Länderreferat und die Auslandsvertretungen für die Abstimmung der konkreten Maßnahmen vor Ort zuständig. Das BMAS übernimmt die Koordinierung der in der Fachkräftestrategie Indien skizzierten Maßnahmen im Inland und in Bezug auf spezifische Fragen der Erwerbsmigration. Andere Bundesministerien mit Indienbezug sind durch ein neues, ressortübergreifend abgestimmtes Länderkonzept für die Fachkräftegewinnung aus Indien einbezogen. Das betrifft das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE), das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR), das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ), das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Das Auswärtige Amt ist gemeinsam mit dem BMAS federführend für die Umsetzung des Länderkonzepts. Letzteres ist das erste dieser Art und soll gewährleisten, dass die Aktivitäten der einzelnen Ressorts vor Ort aufeinander abgestimmt werden.
Auf indischer Seite verantwortlich sind das Ministry of External Affairs (MEA), das Ministry of Labour and Employment (MOLE) und das Ministry for Skill Development and Entrepreneurship (MSDE). Für Rückkehrfragen zuständig sind die jeweiligen Innenministerien. Von 2004 bis 2016 existierte ein eigenes Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA), welches die indische Arbeitsmigration und die indische Diaspora fördern sollte. Aus Effizienzgründen wurde es später in das Ministry of External Affairs integriert.75
Herausragende Bedeutung in der Migrationskooperation haben die jeweiligen Botschaften und Umsetzungsorganisationen. Auf deutscher Seite zählen dazu die Bundesagentur für Arbeit (BA), die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), die Goethe-Institute und -Zentren, aber auch die Außenhandelskammer (AHK) Indien. Auf indischer Seite spielt das halbstaatliche Unternehmen National Skill Development Corporation (NSDC) eine besondere Rolle, das als Public Private Partnership (PPP) zu 51 Prozent von privatem Kapital getragen wird. Die NSDC wurde 2008 vom MSDE gegründet. Neben ihrer Hauptaufgabe berufliche Bildung ist die NSDC über ihre Tochtergesellschaft NSDC International (NSDCI) in der Qualifizierung und Vermittlung indischer Arbeitsmigrant:innen tätig. Da die NSDCI jedoch über keine eigene Lizenz als Rekrutierungsagentur verfügt, ist sie auf die Kooperation mit lizenzierten Partneragenturen angewiesen.
Das Migrationsgeschehen in Indien ist nur schwach reguliert. Eine Reform der Migrationsgesetzgebung ist schwierig.
Im Gegensatz zu Deutschland, aber auch anderen bedeutenden Herkunftsländern von Arbeitsmigrant:innen ist die staatliche Regulierung des Migrationsgeschehens in Indien weniger entwickelt. Außerdem wurde der Schutz indischer Arbeitskräfte vor Ausbeutung und Missbrauch lange Zeit vernachlässigt. Die Auslandsbeschäftigung indischer Staatsangehöriger wird durch den Emigration Act aus dem Jahr 1983 geregelt.76 Für die Umsetzung der indischen Migrationsgesetzgebung ist der Protector General of Emigrants (PGE) im Außenministerium zuständig. Seine wichtigste Aufgabe lautet, indische Arbeitsmigrant:innen vor ausbeuterischen oder betrügerischen Rekrutierungspraktiken zu schützen. Unterstützt wird der PGE dabei von 14 regionalen Untereinheiten, den sogenannten Protectors of Emigrants (PoEs), die als Genehmigungs- und Kontrollinstanzen auf operativer Ebene agieren. Im Jahr 2025 wurde die Zahl dieser PoEs weiter erhöht, um eine bessere territoriale Abdeckung sicherzustellen.77
Eine der zentralen Befugnisse des PGE liegt in der Lizenzierung privater und staatlicher Vermittlungsagenturen. Zugleich hat er eine überwachende Funktion und soll sicherstellen, dass Arbeitsverhältnisse auf Grundlage fairer Rekrutierung und vertraglicher Standards zustande kommen. Zu diesem Zweck wurde 2014 das eMigrate-System eingeführt, eine digitale Plattform, die alle relevanten staatlichen Stellen mit potentiellen Arbeitgebern, Arbeitskräften und Versicherungsunternehmen verbindet. Darüber hinaus ermöglicht eMigrate es betroffenen Migrant:innen oder Dritten, nichtregistrierte oder betrügerische Vermittlungsakteure zu melden.78 Die Überwachungsbefugnis des PGE ist per Exekutivverordnung auf 18 Zielländer in Asien und den Golfstaaten beschränkt – Regionen mit besonders prekären Arbeitsbedingungen. Geprüft werden zudem nur Arbeitsverträge für gering- und ausgewählte mittelqualifizierte Tätigkeiten. Hochqualifizierte Fachkräfte und Studierende sowie Migration in westliche Länder wie Deutschland sind hingegen von staatlichen Kontroll- und Genehmigungsverfahren ausgenommen.
Ein Reformversuch der als veraltet geltenden indischen Migrationsgesetzgebung wurde im Jahr 2021 angestoßen, zeitigte aber keinen Erfolg.79 Allerdings hat die zunehmende Zahl missbräuchlicher Rekrutierungspraktiken neue Dynamiken ausgelöst, etwa der Fall indischer Migranten, die anscheinend unwissentlich als Söldner für den Angriffskrieg gegen die Ukraine angeworben wurden.80 Die indische Regierung plant offensichtlich im Jahr 2025 einen neuen Gesetzentwurf ins Parlament einzubringen, den Overseas Mobility Facilitation and Welfare Bill.81 Zugleich wurde im Frühjahr 2025 der Immigration and Foreigners Bill82 verabschiedet. Er löst das veraltete Gesetz zu Einreise, Aufenthalt und Ausreise von Ausländer:innen in Indien ab und ersetzt es durch ein modernes, digital gestütztes System. Dieses schließt eine Visa- und Registrierungspflicht sowie die Gründung einer Einwanderungsbehörde ein.
Auch wenn die Ebene der Bundesstaaten im MMPA nicht erwähnt wird, haben die indischen Bundesstaaten für die Migrationskooperation einen hohen Stellenwert.83 Sie verfolgen in größerem Maße unabhängig von der indischen Zentralregierung ihre migrationspolitischen Interessen, und fast die Hälfte von ihnen verfügt über semibundesstaatliche Vermittlungsagenturen. Um missbräuchliche Rekrutierungspraktiken zu verhindern, wurden auf Ebene der Bundesstaaten ebenfalls neue Regulierungsversuche unternommen. So wurde im Bundesstaat Kerala eine entsprechende Task Force unter Leitung des lokalen PoE gebildet,84 die im März 2025 Untersuchungen gegen zahlreiche betrügerische Vermittlungsagenturen eingeleitet hat.85
Nichtstaatliche Vermittlungsakteure
Nichtstaatliche Akteure sind für die selbstorganisierte Migration von Indien nach Deutschland entscheidend. Dazu gehören indische Arbeitsmigrant:innen, die durch ihre Netzwerke sowie Sprach- und Ortskenntnisse migrationsinteressierte Personen aus Indien informieren und unterstützen. Die Bedeutung dieser Diasporaakteure wird im MMPA (Artikel 11) anerkannt und im Rahmen des GIZ-Programms »Migration & Diaspora« gefördert.86 Ansonsten fehlt jedoch im MMPA eine Referenz auf andere nichtstaatliche Akteure.
Dabei ist die Migration ins Ausland ein lukratives Geschäftsfeld in Indien, das durch private Vermittlungsagenturen geprägt wird. Diese agieren in komplexen Netzwerken mit Arbeitgebern, Privatuniversitäten und anderen Agenturen im In- und Ausland. Der Umsatz des indischen Marktes für Personalvermittlung innerhalb Indiens und ins Ausland betrug 2022 schätzungsweise 18 Milliarden US-Dollar; bis 2030 wird ein Wachstum auf rund 48,5 Milliarden US-Dollar prognostiziert.87
Viele private Vermittlungsagenturen sind nicht registriert. Das erschwert ihre Regulierung.
Beim indischen Außenministerium sind knapp 2.000 Vermittlungsagenturen registriert, die dafür eine Bankgarantie hinterlegen müssen. Agenturen, die unter 100 Arbeitskräfte jährlich vermitteln, müssen umgerechnet etwa 8.000 Euro aufwenden, alle andern müssen umgerechnet etwa 50.000 Euro hinterlegen.88 Für kleinere Vermittlungsagenturen kann selbst der geringere Betrag eine zu hohe Hürde sein, und so überrascht es nicht, dass es eine hohe Dunkelziffer nichtregistrierter Anbieter gibt – laut einem Parlamentsbericht von 2024 mehr als 3.000 –, deren Aktivitäten strafrechtlich kaum geahndet werden.89 Besonders Agenturen im Bereich der Bildungsmigration90 und Reisebüros agieren oft außerhalb bestehender Regulierungen, weil sie sich nicht beim indischen Außenministerium registrieren lassen müssen und deswegen nicht überwacht werden.91
Überhöhte Vermittlungsgebühren sind ein häufiger Missstand.92 Zwar ist eine Obergrenze von 30.000 Indischen Rupien (etwa 300 Euro) plus 18 Prozent Mehrwertsteuer festgelegt,93 doch tatsächlich zahlen viele Migrant:innen für eine Stelle in den Golfstaaten bis zu 1.500 US-Dollar.94 Für die Migration nach Europa werden höhere vierstellige Eurobeträge verlangt, wobei die Vermittlung in osteuropäische Länder wie Rumänien oder Ungarn tendenziell günstiger ist als nach Deutschland.95
Wenngleich es nicht explizit im Gesetzestext steht, wird die Registrierung in der Verwaltungspraxis faktisch auf indische Staatsangehörige oder indisch registrierte juristische Personen beschränkt. Das ist der Grund, warum der AHK Indien eine Rekrutierungslizenz verwehrt wurde, die sie im Rahmen des vom BMWE geförderten Pilotprojekts »Hand in Hand for International Talents« für die Anwerbung von Gastronomiefachkräften beantragt hatte.96 Für die Projektumsetzung war die Partnerschaft mit einer registrierten indischen Vermittlungsagentur erforderlich. Eine andere Möglichkeit für internationale Vermittlungsagenturen besteht darin, eine indische Tochtergesellschaft mit lokalem Management zu gründen.
Auf dem deutsch-indischen Migrationskorridor sind neben traditionellen deutschen Vermittlungsakteuren neue Marktentwicklungen zu verzeichnen. Ein Beispiel dafür ist das Unternehmen IndiaWorks97 in Freiburg, das gemeinsam von einem ehemaligen Mitarbeiter der örtlichen Handwerkskammer und der Vertreterin der indischen Vermittlungsagentur Magic Billion betrieben wird und Arbeitskräfte für Gastgewerbe, Handwerk und Gesundheitswesen rekrutiert. Während Fachkräfte kostenfrei (nach dem Employer-Pays-Prinzip98) vermittelt werden, fallen für Vorbereitung, Sprachkurse und Vermittlung von Auszubildenden Gebühren von mehreren tausend Euro an, unter anderem weil Arbeitgeber angesichts einer ohnehin kostspieligen Ausbildung weniger dazu bereit sind, sich an den Kosten zu beteiligen.99 Dabei scheinen die Verdienstmöglichkeiten in deutschen Ausbildungsberufen aus indischer Perspektive so lohnend, dass selbst Personen mit einem indischen Bachelor-Studienabschluss für eine Ausbildung in Deutschland angeworben werden.100
Für die Ansprache von Arbeitgebern sind ein Firmensitz und hiesige Ansprechpartner von Vorteil, was auch indische Vermittlungsagenturen erkannt haben. Vor diesem Hintergrund sind die Übernahmen deutscher Pflegevermittlungsagenturen durch indische Firmen zu erklären. So hat Border Plus die Vermittlungsagentur Onea Care übernommen,101 und TERN akquirierte das Unternehmen Rekruut.102 Beide sind mit dem vom BMG eingeführten Gütesiegel »Faire Anwerbung Pflege Deutschland« zertifiziert, das unter anderem das Employer-Pays-Prinzip und umfassende Integrationsunterstützung gewährleisten soll.103
Trotz dieses Wachstums fehlt es bislang an systematischer Regulierung und Kontrolle der privaten Vermittlungspraxis im deutsch-indischen Kontext. Um faire Migration sicherzustellen, sollte die bilaterale Migrationskooperation Transparenz und Regulierung der privaten Vermittlungsagenturen stärken.
Chancen und Herausforderungen der Migrationskooperation
Die zunehmende Migration aus Indien wird in Deutschland insgesamt positiv gesehen, da sie hilft, den Fachkräftemangel zu lindern, und da sich hierzulande nur wenige indische Staatsangehörige irregulär aufhalten, selbst wenn die Gesamtzahlen steigen. Auch in Indien nimmt das Interesse an Deutschland als Zielort weiter zu.104 Neben vielen Chancen hinsichtlich der Ausweitung von Erwerbs- und Bildungsmigration aus Indien nach Deutschland ergeben sich allerdings auch Herausforderungen. Dazu zählen unterschiedliche Erwartungen an die Migrationskooperation, das Matching im Bereich Erwerbsmigration und die Qualitätskontrolle bei der Auswahl indischer Studierender. Zudem wird die Kooperation Indiens bei der Rückübernahme ausreisepflichtiger Staatsangehöriger weiterhin ein sensibles Thema sein, obwohl ihre Zahl vergleichsweise niedrig ist.
Unterschiedliche Erwartungen an die Migrationskooperation
Indien hat umfangreiche Erfahrungen in der migrationspolitischen Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Zielländern. So bestehen Abkommen oder Absichtserklärungen mit sieben europäischen Staaten (darunter Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich). Mit anderen Zielländern wie Australien, Jordanien, Israel, Japan, Taiwan und den Golfstaaten wurden ebenfalls Migrationsabkommen oder Absichtserklärungen vereinbart.105 Offenkundig trägt die Migrationskooperation zur Diversifizierung der außenpolitischen Beziehungen Indiens bei, da es sich potentiell um ein verbindendes Element handelt, das die Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen stärken kann. Dabei versteht die indische Regierung zumindest Teile der Diaspora als Vertreter ihrer Interessen im Ausland.106
Ein weiteres wichtiges Motiv für die indische Regierung sind die Rücküberweisungen, die sich seit 2010 mehr als verdoppelt haben. Für 2024 werden sie auf rund 129 Milliarden US-Dollar geschätzt, ungefähr 3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.107 Einige Regionen Indiens hängen stark von Rücküberweisungen ab, da sie für die jeweilige wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich sind. In den vergangenen Jahren ist der Anteil der Rücküberweisungen aus Industriestaaten deutlich gestiegen und hat jene aus den Golfstaaten überholt.108 Neben den finanziellen Vorteilen setzt Indien auf immaterielle Effekte: Man hofft, dass zumindest ein Teil der Studierenden und Arbeitskräfte aus dem Ausland mit Sprachkenntnissen, beruflichem Wissen und unternehmerischen Fähigkeiten nach Indien zurückkehrt und zur wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt.
Ein weiteres Motiv hängt mit den immensen Herausforderungen in Indiens Arbeits- und Bildungssystem zusammen. Rund 90 Prozent der Erwerbstätigen sind im informellen Sektor beschäftigt, und viele Menschen sind auf sehr niedrig bezahlte Gelegenheitsarbeit angewiesen.109 Um der wachsenden Erwerbsbevölkerung Perspektiven zu bieten, müssten bis zum Jahr 2030 zwischen 60 und 150 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden.110 Gleichzeitig wird kritisiert, dass das indische Bildungssystem über Jahrzehnte hinweg breite, hochwertige Bildung zugunsten eines elitären Hochschulsystems vernachlässigt habe – mit negativen Folgen für soziale Gerechtigkeit und das langfristige Entwicklungspotential.111 Selbst wenn diese strukturellen Defizite nun entschieden angegangen würden, wären spürbare Effekte erst mittelfristig zu erwarten.
Die indische Regierung sieht Migrationsabkommen auch als eine Möglichkeit, die berufliche Bildung zu reformieren. Als Referenzmodell nennt die Regierung das Technical Intern Training Program (TITP) mit Japan, das 2017 vom MSDE ins Leben gerufen wurde und von der NSDC umgesetzt wird. Ziel des Programms ist es, jungen Inder:innen durch praktische Ausbildung in japanischen Unternehmen berufliche Qualifikationen zu vermitteln. Trotz dieser ambitionierten Zielsetzung blieb die Wirkung bislang begrenzt – bis März 2024 hatten nur etwas über 1.000 Praktikant:innen daran teilgenommen.112 Wenngleich das indische Interesse an praxisorientierter Qualifizierung und Wissenstransfer nachvollziehbar ist, lässt sich das Programm schwer mit dem deutschen Einwanderungsrecht vereinbaren. Zudem steht es dem Interesse deutscher Arbeitgeber entgegen, die darauf setzen, Fachkräfte langfristig zu gewinnen, wenn sie in deren Ausbildung investieren.
Die unterschiedlichen Herangehensweisen in der Migrationskooperation werden auch im Umgang mit Zuwanderungszahlen deutlich. 2024 bemängelte die indische Regierung, die deutschen Maßnahmen seien zu zögerlich, da das im MMPA festgesetzte Ziel der Rekrutierung von jährlich 3.000 jungen Arbeitskräften (Artikel 6) nicht durch staatlich unterstützte Anwerbeprogramme erfüllt worden sei. Im Gegenzug verwies die deutsche Seite darauf, dass diese Zahl durch die selbstorganisierte Migration deutlich übertroffen und nicht ausschließlich auf staatlich unterstützte Anwerbeprogramme zu beziehen sei.113
Auch wenn dieser Konflikt mittlerweile beigelegt ist, verweist er doch auf grundsätzliche Herausforderungen. Während die indische Regierung auf schnelle Skalierung der Erwerbsmigration durch staatliche Anwerbeprogramme drängt, besteht gleichzeitig Unklarheit, wer als vertrauenswürdiger indischer Kooperationspartner in Frage kommt. Die NSDC hat zuletzt massive Kritik im Kontext eines Anwerbeabkommens auf sich gezogen, das mit Israel im November 2023 infolge des Wegfalls palästinensischer Arbeitskräfte nach dem Hamas-Angriff geschlossen worden war. So erhielten die entsandten Arbeitskräfte weder ausreichend Informationen und Schutz, noch waren sie aus Sicht der israelischen Arbeitgeber hinlänglich qualifiziert.114 Selbst besser vorbereitete, privat vermittelte indische Arbeitskräfte litten unter dem dadurch entstandenen schlechten Ruf.115 Zusätzlich zu dieser problematischen Bilanz wurden im Frühjahr 2025 Korruptionsvorwürfe gegenüber der NSDC laut. Sie führten zur Absetzung des Chief Executive Officer (CEO), der zugleich Geschäftsführer der NSDCI war, der für Rekrutierung geschaffenen Tochtergesellschaft.116
Vor diesem Hintergrund ist von Vorteil, dass Deutschland auf unterschiedlichen Ebenen bereits mit einzelnen Bundesstaaten bei der Fachkräftegewinnung kooperiert. So wurden im Rahmen des von BA und GIZ umgesetzten Programms »Triple Win« zur Gewinnung von Pflegekräften Vermittlungsabsprachen mit den staatlich lizenzierten Agenturen Norka Roots in Kerala (Ende 2021) und TOMCOM in Telangana (Ende 2023) getroffen.117 Die deutschen Bundesländer haben ihrerseits eigene Anwerbemaßnahmen mit indischen Bundesstaaten gestartet, die sie teilweise an bestehende Hochschulkooperationen oder Kooperationsbüros für wirtschaftliche Zusammenarbeit andocken.
Die Voraussetzungen für eine Kooperation mit den indischen Bundesstaaten unterscheiden sich teils erheblich, was vor allem auf die vielfältigen Auswanderungstraditionen zurückzuführen ist.118 Gemessen am Volumen internationaler Rücküberweisungen zählen besonders Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka und Andhra Pradesh zu den bedeutendsten Herkunftsregionen von Migrant:innen.119 Allerdings variieren die Ausgangsbedingungen auch innerhalb dieser Bundesstaaten deutlich – etwa zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Überdies kommt es auf gute Bildungsstandards und eine verlässliche Migrationsinfrastruktur an. Der südindische Bundestaat Kerala ist seit den 1970er Jahren durch Auswanderung geprägt und hat zwei funktionsfähige semibundesstaatliche Agenturen etabliert: Norka Roots bietet umfassende Unterstützungs- und darüber hinaus Reintegrationsdienste für Migrant:innen aus Kerala an, während ODEPC Kerala sich allein auf die Vermittlung konzentriert.
Viele andere Bundesstaaten haben keine vergleichbar funktionsfähigen Strukturen. Das gilt trotz der beträchtlichen Rücküberweisungen auch für den Bundesstaat Maharashtra, mit dem Baden-Württemberg Anfang 2024 eine Absichtserklärung für die Rekrutierung einer größeren Zahl von Arbeitsmigranten unterzeichnet hat.120 In der Folge hat sich die Regierung von Maharashtra – im Vorfeld der dortigen Parlamentswahlen – bemüht, rasch eine neue staatliche Rekrutierungsagentur und weitere Unterstützungsstrukturen aufzubauen. Das sollte das Angebot der Sprachvermittlung in Kooperation mit dem Goethe-Institut einschließen. Die Regierung von Maharashtra ist dann mit der Auswahl von mehreren tausend Kandidat:innen vorgeprescht, ohne die Auswahlkriterien mit der deutschen Seite abgestimmt zu haben.121 Dadurch ist das Projekt erst einmal versandet. Für die ausgewählten Kandidat:innen in Indien bedeutet das eine große Enttäuschung122 und unterstreicht, wie notwendig belastbare Umsetzungsstrukturen sind.
Ohnehin können private Vermittlungsagenturen Arbeitsmigrant:innen häufig effektiver und flexibler bei ihren Migrationsambitionen unterstützen, da viele von ihnen jahrelange Expertise in der Auswahl und berufsspezifischen Vorbereitung haben. Ihre Rolle ist jedoch ambivalent: Während einige etablierte Vermittlungsagenturen seit vielen Jahren seriös arbeiten, locken andere mit unrealistischen oder gar betrügerischen Versprechen. Die allermeisten Agenturen erheben von Migrant:innen Gebühren und widersprechen damit dem Employer-Pays-Prinzip. Für eine verantwortungsvolle Ausweitung der Arbeitsmigration aus Indien ist eine bessere Regulierung privater Agenturen essentiell. Da Deutschland Anbieter mit Sitz in Indien nicht direkt regulieren kann, bedarf es im Rahmen des MMPA einer engeren bilateralen Abstimmung mit der indischen Regierung sowie den Bundesstaaten, aus denen das Gros der Arbeitsmigrant:innen nach Deutschland angeworben wird.
Steuerung der Erwerbsmigration
Seit Anfang der 2010er Jahre ist die Migration aus Indien nach Deutschland deutlich gestiegen, vor allem durch hochqualifizierte Fachkräfte, die über die Blaue Karte EU Zugang zum Arbeitsmarkt fanden. Besonders in Schlüsselbranchen wie der IT leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Linderung des Fachkräftemangels. Die Integration in den Arbeitsmarkt verläuft dabei insgesamt sehr erfolgreich: Im Februar 2024 lag die Arbeitslosenquote indischer Staatsangehöriger bei nur 3,7 Prozent und damit bei etwa der Hälfte des gesamtdeutschen Durchschnitts. Zudem sind indische Arbeitskräfte im Schnitt jünger, besser ausgebildet und häufiger in hochqualifizierten Berufen tätig, vor allem in MINT-Feldern. Beim Einkommen zeigt sich dieser Trend ebenfalls: Ende 2023 lag der Medianlohn indischer Staatsangehöriger bei 5.359 Euro brutto und damit deutlich über dem deutschen Median von 3.945 Euro brutto.123
Es gibt Anzeichen dafür, dass der Anteil von IT-Expert:innen an den Wanderungsbewegungen nach Deutschland nachlässt, wobei die Gründe nicht eindeutig klar sind. Es könnte sowohl an der schwachen konjunkturellen Entwicklung Deutschlands und einer sinkenden Nachfrage der hiesigen IT-Branche liegen als auch an einem sinkenden Auswanderungspotential entsprechender IT-Fachkräfte aus Indien, weil sie dort ebenfalls umworben sind und sich die Verdienstmöglichkeiten verbessert haben. Fest steht, dass die Nachfrage nach indischen Expert:innen im Bereich künstliche Intelligenz (KI) wächst.124
Offen ist, welche Tätigkeitsfelder sich jenseits von MINT-Berufen für die Anwerbung aus Indien eignen.
Offen ist, ob es gelingt, indische Fachkräfte künftig jenseits von MINT-Berufen erfolgreich für jene Branchen anzuwerben, in denen der Fachkräftemangel am größten ist. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen sind immer noch zurückhaltend, wenn es um die Rekrutierung von Arbeitskräften aus Drittstaaten wie Indien geht. Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung suchen nur 18 Prozent der Unternehmen aktiv im Ausland nach Arbeitskräften, obwohl gut 70 Prozent der befragten Unternehmen über Personalmangel klagten, vor allem über das Fehlen von Fachkräften im mittleren Bereich, das heißt Personen mit Berufsausbildung.125 Als Grund dafür werden häufig die hohen administrativen Hürden wie die langwierige Anerkennung beruflicher Qualifikationen genannt. Mitverantwortlich für die Zurückhaltung ist aber gewiss eine grundsätzliche Skepsis hinsichtlich der Integrations- und Leistungsfähigkeit von Drittstaatsangehörigen. Bei migrationsinteressierten Inder:innen herrscht im Gegenzug recht große Sorge vor Diskriminierung und Rassismus in Deutschland. Laut einer OECD-Umfrage unter tatsächlich zugewanderten Fachkräften verschiedener Nationalitäten ist dies ein deutlich größeres Problem als zuvor angenommen.126
Zusätzlich zu dieser gesellschaftlichen Herausforderung ist für die erfolgreiche Erwerbsmigration ein gutes Matching erforderlich, das die Anschlussfähigkeit indischer Qualifikationen sicherstellt. Als eine Schwäche im indischen Bildungssystem im Vergleich zum deutschen dualen System mit seinen Berufsschulen gilt der geringe Praxisanteil. Gesundheitsberufe scheinen dennoch sehr anschlussfähig zu sein. Das gilt besonders für dringend benötigte Pflegekräfte. Deren Ausbildung wird vom Indian Nursing Council reguliert und entspricht in vielen Aspekten den Anforderungen an Pflegefachkräfte in Deutschland.127 Hier setzt das vom BMG geförderte GIZ-Projekt Global Skills Partnerships an, in dem deutsche und indische Bildungseinrichtungen für die Pflege gemeinsame Curricula entwickeln. Ziel ist, dass entsprechende Abschlüsse in beiden Ländern anerkannt werden können.128
Diskutiert wird ferner über die gezielte Anwerbung von Arbeitskräften in anderen Branchen, etwa für sogenannte Grüne Berufe, wozu Techniker:innen oder Ingenieur:innen für erneuerbare Energien zählen. Zudem plant die Deutsche Bahn (DB), indische Triebfahrzeugführer:innen anzuwerben und langfristig Fachkräfte in Indien auch für andere Berufsfelder im Unternehmen auszubilden.129 Für weitere Berufsfelder wird Pionierarbeit sowohl in Deutschland als auch in Indien nötig sein, und zwar im Zusammenspiel von staatlichen Akteuren, Unternehmen und privaten Vermittlungsagenturen.
Neben staatlichen Pilotprojekten zur gezielten Ansprache von Fachkräften für bestimmte Branchen sollten die Auswirkungen selbstorganisierter Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt genau beobachtet werden. Die Chancenkarte soll qualifizierten Personen ermöglichen, in Deutschland eine Stelle zu finden und beruflich Fuß zu fassen. Auch Personen mit einem bestehenden Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit oder Ausbildung können sich bewerben. Während der Jobsuche ist eine Nebentätigkeit von durchschnittlich 20 Wochenstunden erlaubt. Zwar ist es noch zu früh für eine aussagekräftige Bilanz, doch gibt es erste Hinweise darauf, dass private Vermittlungsagenturen die Chancenkarte als vergleichsweise einfachen Zuwanderungsweg aus Indien erkannt haben.130 Unklar bleibt bislang, wie viele indische Arbeitsmigrant:innen mit einem entsprechenden Visum tatsächlich einreisen und ob sie über den zunächst befristeten Charakter der Chancenkarte ausreichend informiert sind.
Bildungsmigration – großes Interesse erfordert bessere Auswahlverfahren
Ein wichtiger Treiber der indischen Auswanderungsbewegungen ist der Wunsch, im Ausland zu studieren. 1,33 Millionen indische Studierende waren 2024 im Ausland eingeschrieben.131 Die meisten von ihnen stammen aus den Bundesstaaten Maharashtra, Telangana und Punjab.132 Deutschland rangiert auf Platz fünf der beliebtesten Zielländer und ist mit einem Anteil von rund 6 Prozent das führende nichtenglischsprachige Studienland.133 Der Großteil indischer Studierender hierzulande hat in Indien bereits einen Bachelorabschluss erworben und strebt nun in Deutschland einen – meist englischsprachigen – Masterabschluss an. Dass das Studium hier kostenfrei oder nur mit geringen Studiengebühren verbunden ist,134 macht Deutschland attraktiv für Studierende aus der indischen Mittelschicht, welche die hohen Gebühren in den klassischen Zielländern meiden wollen.135
Deutschland hat im Umgang mit internationalen Studierenden weniger Erfahrung als klassische Einwanderungsländer wie Kanada oder Australien.136 Standardisierte Auswahlverfahren im Ausland sind kaum etabliert – auch weil deutsche Hochschulen weniger marktorientiert agieren und international weniger aktiv um Studierende werben.
Ein Großteil der indischen Studierenden in Deutschland ist in englischsprachigen Masterstudiengängen eingeschrieben. Lediglich 10 Prozent absolvieren ein Bachelorstudium.137 Das hängt unter anderem damit zusammen, dass es in Indien nur in begrenztem Maße gute Studienmöglichkeiten gibt, die über den Bachelor hinausgehen. In den Masterprogrammen wählen 73 Prozent der indischen Studierenden in Deutschland ein MINT-Fach, was den gängigen Bildungspräferenzen in Indien entspricht.138 Indische Studierende bleiben laut OECD zu einem höheren Anteil als Studierende anderer Nationalitäten in Deutschland. Im Jahr 2020 befanden sich demgemäß noch 76 Prozent der im Jahr 2015 aus Indien gekommenen Studierenden nach ihrem Studium in Deutschland, gegenüber durchschnittlich 63 Prozent aller internationalen Studierenden.139 Eine Befragung aus dem Jahr 2024 bestätigt die höhere Zahl an Bleibeabsichten. Demnach gaben rund 40 Prozent der befragten indischen Studierenden an, dass sie »ganz sicher« in Deutschland bleiben möchten, während weitere 26 Prozent mit »eher ja« antworteten.140
Die steigende Zahl indischer Studierender in Deutschland stellt das deutsche Hochschulsystem vor die Frage, wie die richtige Auswahl aus den zahlreichen Bewerbungen getroffen werden kann. Mit dem MMPA wurde in der Deutschen Botschaft in Indien, wie zuvor in China und Vietnam, eine Akademische Prüfstelle (APS) gegründet, »um die Qualität der von qualifizierten indischen Studierenden gestellten Anträge und die Nutzung des Antragsverfahrens zu verbessern«.141 Allerdings beschränkt sich die APS bisher hauptsächlich darauf, die Visaverfahren zu unterstützen und Zulassungsvoraussetzungen indischer Studierender zu überprüfen. Die Unterstützungsbedarfe gehen jedoch darüber hinaus. Eine interne Auswertung von APS-Daten zeigt, dass sich nicht immer die leistungsstärksten Studierenden aus Indien für ein Studium in Deutschland bewerben. Es gibt kaum Studierende, die aus Indiens führenden Universitäten stammen.142
Aufgrund des Zulassungsstopps für internationale Studierende in den Vereinigten Staaten und der erschwerten Visa- und Zulassungsbedingungen für sie in anderen traditionell wichtigen Zielländern wie dem Vereinigten Königreich oder Kanada wird das Interesse an einem Studium in Deutschland weiter zunehmen.143 Wie in der Erwerbsmigration haben private Agenturen hier wesentliche Bedeutung. Sie unterstützen bei der Hochschulwahl sowie der Bewerbung und dem Visaprozess und bieten ihre Dienstleistungen auch ausländischen Hochschulen an.144 Allerdings werden sie nicht von Behörden zum Schutz von Emigranten (PoE) kontrolliert, weshalb betrügerische Angebote für den indischen Staat schwer zu kontrollieren sind. Influencer:innen spielen bei der Bildungsmigration ebenfalls eine wichtige Rolle.145
Indische Studierende in Deutschland leiden unter fragwürdigen Praktiken mancher Vermittlungsagenturen.
Die wachsende Zahl indischer Studierender wirkt sich direkt auf den deutschen Arbeitsmarkt aus, da viele von ihnen Nebenjobs in der Gig Economy und der Logistik aufnehmen.146 Gemeinsam mit einigen Privatuniversitäten, deren Bildungsqualität nicht durchgängig gesichert ist, haben private Vermittlungsagenturen ein Geschäftsmodell entwickelt, bei dem sie jungen Inder:innen einen Studienplatz vermitteln und dafür von ihnen jährlich einen höheren vierstelligen Betrag in Euro verlangen. Viele indische Studierende sind darauf angewiesen, vor allem in befristeten Jobs, etwa als Essenslieferant:innen, zu arbeiten – auch um die im Zuge der Migration nach Deutschland entstandenen Schulden abzubauen.147 Gleichzeitig sind sie hohen Mietkosten, prekären Lebensbedingungen und der Sorge um ihren Aufenthaltsstatus ausgesetzt. Selbst bei einem erfolgreichen Studienabschluss sind die Perspektiven nicht viel besser, da entsprechende Privatuniversitäten mitunter Studienabschlüsse verleihen, die in Deutschland nicht anerkannt sind.148 Diese missbräuchlichen Praktiken einzelner internationaler Bildungseinrichtungen sind bislang ein Randphänomen und könnten durch rechtliche Nachbesserungen wirksam eingedämmt werden. Unterbleibt dies, droht die Glaubwürdigkeit des gesamten Migrationskorridors zu leiden. Dies zeigt das Beispiel Kanada, wo ähnliche Betrugsfälle zu einer Verschärfung der Migrationspolitik führten.
Trotz dieser Herausforderungen bieten indische Studierende, die ganz überwiegend reguläre Hochschulen in Deutschland besuchen, ein enormes Potential für den hiesigen Arbeitsmarkt. Es könnte noch besser genutzt werden, wenn lokale Netzwerke aus Hochschulen, Zivilgesellschaft und Arbeitgebern sich von vorneherein in Maßnahmen zur Sprachförderung und Integration engagieren. Die Bundesagentur für Arbeit will in diesem Sinne mit einem Pilotprojekt vorangehen und an ausgewählten Standorten den Übergang indischer Studierender in den Arbeitsmarkt unterstützen.149
Rückkehrpolitik – (k)ein großes Problem
Gemessen an der Gesamtzahl indischer Staatsangehöriger, die sich in Deutschland aufhalten, ist die Zahl der Ausreisepflichtigen sehr gering. Dennoch war eine verbesserte Rückübernahmekooperation das handlungsleitende Motiv der Bundesregierung und des in der Sache federführenden BMI für die bilateralen Verhandlungen 2018. Das hing damals möglicherweise mit einer vergleichsweise hohen Zahl von 3.500 Asylanträgen (2016) zusammen.
Seitens der Bundesregierung wurde bemängelt, dass die Rückübernahmekooperation sich nach Unterzeichnung des MMPA zunächst nicht verbesserte, sondern sogar zurückging. Im Jahr 2023 wurden 51 indische Staatsangehörige zurückgeführt,150 gegenüber 176 im Vor-Corona-Jahr 2019.151 Die Gründe dafür sind nicht eindeutig feststellbar. Die geringere Zahl an Rückführungen könnte als taktisches Vorgehen der indischen Regierung gedeutet werden, die auf diese Weise anscheinend konkrete Fortschritte bei der Ausweitung von Erwerbsmigration nach Deutschland erreichen wollte. Plausibler erscheint jedoch, dass die zuvor auf freiwilliger Grundlage erfolgte Rückübernahmepraxis durch ein formelles Abkommen ersetzt wurde, dessen praktische Umsetzung auf beiden Seiten zunächst zeitliche Anpassungen erforderte. Dies liegt unter anderem daran, dass Rückführungsprozesse in hohem Maße vom Vertrauen und von der Kooperationsbereitschaft der beteiligten Verwaltungen und einzelner Akteure abhängen.152
Die Details der Rückführung ausreisepflichtiger Personen sind in Artikel 12 des deutsch-indischen MMPA geregelt.153 So verpflichtet sich Indien, innerhalb von 30 Kalendertagen auf ein Rückübernahmeersuchen zu reagieren, wenn die Identität der rückzuführenden Person eindeutig geklärt ist. Ist das nicht der Fall, greift diese Frist nicht. Indien hat dann »innerhalb einer angemessenen Frist« die Möglichkeit, die Staatsangehörigkeit der betroffenen Person zu überprüfen. Dadurch entstehen langwierige Überprüfungen, weil die indische Seite die Staatsangehörigkeit von der Polizei des jeweils zuständigen Bundesstaates bestätigen lässt.154 Wenn Menschen dann rückgeführt werden oder freiwillig zurückgehen, gibt es – außer den von Deutschland unterstützten Maßnahmen zur freiwilligen Rückkehr wie das REAG/GARP‑Programm155 – in Indien keine Unterstützung oder Reintegrationsmaßnahmen, wie in einem Bericht im indischen Parlament bemängelt wurde.156
In jüngerer Zeit ist die Zahl der Ausreisen von Inder:innen, die sich vollziehbar ausreisepflichtig in Deutschland aufhielten, wieder gestiegen. So hat sich die Zahl der Rückführungen im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht. Es wurden 167 ausreisepflichtige indische Staatsangehörige abgeschoben.157 656 Personen kehrten freiwillig zurück.158
Zu erwarten ist, dass die Rückübernahmekooperation stetig verbessert wird. Außerdem will die neue Bundesregierung Indien zum sicheren Herkunftsstaat erklären, um beschleunigt über Asylanträge aus dem Land zu entscheiden. Belgien, Zypern, Irland, Frankreich und die Schweiz haben Indien bereits als sicheren Herkunftsstaat eingestuft.159 Die Niederlande hingegen haben Indien Ende 2024 von ihrer Liste sicherer Herkunftsstaaten gestrichen. Sie folgten damit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), wonach Länder nicht unter Ausschluss bestimmter Gebiete als sicher eingestuft werden können.160 Die EU-Kommission hat im April 2025 eine einheitliche Anwendung des Konzepts in Form einer neuen, gemeinsamen EU-Liste sicherer Herkunftsstaaten vorgeschlagen und Indien als mögliches Herkunftsland genannt.161 Auch wenn Asylanträge und die Rückkehr ausreisepflichtiger indischer Staatsangehöriger ein Thema der bilateralen Migrationskooperation bleiben, erscheinen andere Herausforderungen dringlicher.
Weiterentwicklung der deutschen Außenstrukturen in Indien
Worauf es in den deutschen Außenstrukturen ankommt
Um geeignete Arbeitskräfte aus Indien zu gewinnen, muss Deutschland seine Außenstrukturen weiterentwickeln. Dies wurde im Auswärtigen Amt in den letzten Jahren erkannt, so dass die personellen Kapazitäten der Botschaften und Konsulate für das Thema ausgeweitet und die Präsenz des Goethe-Instituts erhalten wurde.162 Wichtige Verbesserungen konnten auch bei den Visaverfahren erreicht werden. Dabei kommt den Auslandsvertretungen in Indien eine Vorreiterrolle zu. So wurden die Wartezeiten mit Unterstützung externer Dienstleister bei der Antragsannahme und des Bundesamts für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA) in der Antragsbearbeitung deutlich reduziert. Im Generalkonsulat in Kalkutta wurde seit 2022 mit einem Pilotprojekt die Digitalisierung der Visaverfahren erprobt, die nun in allen anderen Auslandsvertretungen und weltweit zur Regel werden soll. Angestrebt wird, dass Bewerber:innen nur noch für die Identitätskontrolle und Erfassung der Biometrie persönlich vorsprechen müssen und alles andere – zumindest im Falle Indiens – vorab elektronisch mit Hilfe externer Dienstleister erledigt werden kann. Selbst wenn in der deutschen Politik Bedenken wegen der Betrugsanfälligkeit solcher Dienstleister geäußert werden, wäre die steigende Zahl von Visaanträgen in Indien ohne die Firma VFS Global kaum zu bewältigen.
Die im Koalitionsvertrag im April 2025 von der schwarz-roten Regierungskoalition angestrebte Work-and-Stay-Agentur für die Fachkräftegewinnung wird vermutlich auf den Erfahrungen der Digitalisierung und Zentralisierung aufbauen. Zudem wird die Bundesregierung die Wirkungen der letzten Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes mit etwas zeitlichem Abstand besser beurteilen können.
Überdies kommt es darauf an, dass die deutschen Außenstrukturen in Indien mit einem zeitgemäßen Auftritt migrationsinteressierte Inder:innen ansprechen und informieren. Dafür sollte das zentrale Webportal »Make it in Germany« weiterentwickelt und durch einen landesspezifischen Bereich ergänzt werden.163 Bei der Überarbeitung der Informationsplattform sollte erwogen werden, sie sprachlich weiter zu vereinfachen, da die Informationen auf Englisch für Nichtmuttersprachler:innen zu kompliziert sein könnten bzw. in die relevantesten anderen Landessprachen übersetzt werden sollten.
Online-Plattformen indischer Migrant:innen in Deutschland, etwa Foreign Ki Duniya,164 spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Informationsvermittlung. So bedeutsam solche Formate auch sein können, ist eine kritische Einordnung doch unerlässlich, denn es gibt zahlreiche Hinweise auf Influencer:innen, die ein unrealistisches Bild vermitteln oder betrügerische Geschäftsmodelle verfolgen.
Für die deutschen Auslandsstrukturen ist es eine große Herausforderung, genug gute Deutsch-Sprachkurse anzubieten.
Angemessene Kapazitäten zur Vermittlung der deutschen Sprache sicherzustellen ist eine erhebliche Herausforderung für die deutschen Auslandsstrukturen in Indien. Auf dem stark wachsenden Markt konkurrieren zahlreiche private Sprachschulen miteinander, deren Qualitätsstandards teils stark variieren. Ein Indikator hierfür sind die deutlich geringeren Bestehensquoten bei Sprachprüfungen des Goethe-Instituts bei Teilnehmenden, die zuvor Kurse bei alternativen, meist günstigeren Anbietern besucht haben. Goethe-Institute und -Zentren stehen im Wettbewerb mit preiswerteren Einrichtungen, die jedoch oft nicht das gleiche Sprachniveau erreichen.165 Neben dem Goethe-Institut zertifizieren auch andere Einrichtungen Sprachkenntnisse – etwa telc, eine Tochtergesellschaft des Deutschen Volkshochschul-Verbands,166 sowie das Österreichische Sprachdiplom Deutsch (ÖSD).167 Die Ansätze zur Sprachvermittlung unterscheiden sich stark. So bieten manche private Vermittlungsagenturen Schnellkurse an, in denen migrationsinteressierte Inder:innen in internatsähnlichen Strukturen innerhalb von zwei bis drei Monaten ganztägig auf das B1-Niveau vorbereitet werden sollen.168 Angesichts dieses wachsenden Angebots und der steigenden Zahl an Zertifizierungsstellen ist es zentral, Qualitätsstandards zu definieren und deren Einhaltung systematisch zu beobachten.169
Um den Stellenwert von Deutsch als Fremdsprache zu erhöhen und es im indischen Bildungssystem zu etablieren, sollten im Rahmen der Migrationskooperation erneut Maßnahmen angestoßen werden. In Indien gibt es 47 Schulen, die deutsche Sprachkenntnisse vermitteln und dabei von den Goethe-Instituten im Rahmen der Initiative »Schulen: Partner der Zukunft« (PASCH) unterstützt werden.170 Schon 2011 wurde ein erster systematischerer Ansatz verfolgt, als die Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) – eine zentrale Schulorganisation der indischen Regierung, die landesweit über 1.200 Schulen betreibt und vor allem Kindern von Angehörigen des öffentlichen Dienstes durch ein einheitliches Curriculum Bildungskontinuität ermöglicht – Deutsch in ihr Curriculum integrierte. Das wurde jedoch bereits nach fünf Jahren aufgrund der nationalistischen Sprachpolitik der indischen Regierung revidiert.171
Um die Steuerung der Bildungsmigration aus Indien zu verbessern, sollten die Kompetenzen der APS ausgeweitet werden. In Zusammenarbeit mit dem DAAD und deutschen Hochschulen ließe sich dann eine stärker leistungsorientierte Auswahl an Studienbewerbungen treffen. Dafür sollte die Bundesregierung den Dialog mit den deutschen Bundesländern und den Hochschulen suchen, um die Zulassungsverfahren für internationale Studierende zu reformieren. Wichtig wäre auch, Maßnahmen zu ergreifen, die den Anteil indischer Bachelor-Studierender steigern, da ein komplettes Studium in Deutschland die Wahrscheinlichkeit des Spracherwerbs und Verbleibs erhöht.
Migrationsbezogene Entwicklungszusammenarbeit mit Indien neu definieren
Obwohl das BMZ seit einigen Jahren einen Schwerpunkt auf die migrationsbezogene Entwicklungszusammenarbeit legt, ist das Thema in der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit (EZ) mit Indien bisher kaum präsent. So wurde beispielsweise kein Zentrum für Migration und Entwicklung in Indien aufgebaut, obwohl es sich um eine Leuchtturminitiative der letzten Jahre handelt.172 Das BMZ unterstützte lediglich das deutlich kleinere GIZ-Vorhaben »Migration entwicklungspolitisch gestalten« (MEG), in dem Indien nur eins von 15 Partnerländern ist.173
Im bilateralen Portfolio des BMZ wurde lange keine Verbindung zu anderen Schwerpunkten der EZ mit Indien gesucht. Erst nach einem entsprechenden Wunsch der indischen Regierung wurde ein bereits geplantes GIZ-Projekt zur Verbesserung von Berufsbildung im Bereich grüner Berufe – vor allem für Frauen – mit einer Migrationskomponente ergänzt.174 Die Curricula sollen so ausgestaltet werden, dass die Ausbildung auch zu einer Tätigkeit in Deutschland oder anderen Zielländern befähigt. Das sollte aber nur ein Anfang sein. Gemeinsam mit dem ehemaligen BMBF (jetzt Verantwortungsbereich BMBFSFJ) arbeitet das BMZ mit dem indischen MSDE zusammen, um eine Reform des indischen Berufsbildungssystems hin zu mehr Praxisrelevanz zu unterstützen.175 Die indische Regierung hat außerdem im Rahmen der Unterarbeitsgruppe Erwerbsmigration im Frühjahr 2025 Interesse signalisiert, einige ihrer staatlichen Berufsbildungszentren für die praktische Vorbereitung einer Tätigkeit in Deutschland auszurichten und Sprachkurse anzubieten.176
Die bisherige Zurückhaltung des BMZ hängt damit zusammen, dass die sogenannten ODA-Kriterien (Official Development Assistance) der OECD enge Grenzen für die Verwendung von Entwicklungsgeldern setzen.177 Demnach dürfen keine Aktivitäten unterstützt werden, von denen deutsche Arbeitgeber potentiell eher als das Herkunftsland Indien profitieren würden. Außerdem könnte die Sorge eine Rolle spielen, mit der Anwerbung von Fachkräften eine Abwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte (»brain drain«) zu verursachen. Tatsächlich gibt es Engpässe in einigen Sektoren wie IT, erneuerbare Energien, Elektromobilität, Gesundheitswesen und Fertigung, wo moderne Technologien schnelle Qualifikationsanpassungen erfordern. Besonders in technischen Berufen und bei digitaler Kompetenz fehlt es oft an praxisnah ausgebildeten Arbeitskräften.178 In Gesundheits- und Pflegeberufen besteht der Mangel vorwiegend in den ärmeren, ländlich geprägten Bundesstaaten.179 Hauptverantwortlich dafür ist jedoch nicht die Auswanderung, sondern Ungleichheiten innerhalb des Landes sowie grundsätzliche Probleme, das demographische Potential zu nutzen und den vielen Millionen Arbeitskräften, die jedes Jahr hinzukommen, ausreichend Beschäftigungsperspektiven bieten zu können.
Zudem weist die neuere Migrationsforschung auf die vielen vorteilhaften Auswirkungen von Migration für die Entwicklung der Herkunftsländer hin. Neben den positiven Effekten von Rücküberweisungen zählt dazu die Erkenntnis, dass die Aussicht auf Migration Bildungsanreize im Herkunftsland verstärken kann. Außerdem kehren einige Migrant:innen später zurück oder investieren in ihre Heimat – ein Phänomen, das als »brain circulation« bekannt ist. In Indien offenbarte sich dieser Effekt besonders im Aufstieg des IT-Sektors: Die indische Diaspora in den USA brachte, geprägt durch ihre Erfahrungen im Silicon Valley, technisches Know-how, Marktkenntnisse und internationale Geschäftspraktiken nach Indien und trug damit maßgeblich zur globalen Wettbewerbsfähigkeit der indischen Tech-Branche bei.180
Bisher gibt es mit Triple Win nur ein Anwerbeprojekt mit entwicklungspolitischem Anspruch, das nicht vom BMZ, sondern von deutschen Arbeitgebern finanziert und von der nicht gemeinnützigen GIZ-Tochtergesellschaft International Services umgesetzt wird.181 Dabei begleitet die GIZ die Vermittlungsabsprache der Bundesagentur für Arbeit mit den semibundesstaatlichen Rekrutierungsagenturen der Bundesstaaten Kerala (seit 2022) und Telangana (seit 2024). Der Vorteil dieser Programme ist, dass sie an den internationalen Standards für faire Rekrutierung orientiert sind, einschließlich des Employer-Pays-Prinzips. Allerdings konnten binnen drei Jahren auf diesem Weg nur 670 Pflegekräfte angeworben werden, bisher ausschließlich aus Kerala.182 Zuletzt hat die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) gefordert, das Programm zu beenden, da mit ihm zu wenig Fachkräfte gewonnen würden und private Vermittler längst wichtiger seien.183 Schwer empirisch zu bewerten ist die von der ebenfalls an Triple Win beteiligten BA betonte Funktion, dass man mit dem Programm Wegbereiter (»trailblazer«) für andere Vermittlungsakteure sei, die sich bestenfalls an den gleichen Prinzipen fairer und geordneter Arbeitsmigration orientieren würden.184
Angesichts der strategischen Bedeutung Indiens – sowohl als Partnerland der deutschen Entwicklungszusammenarbeit als auch als wichtiges Herkunftsland von Erwerbs- und Bildungsmigration – sollte das BMZ neue Maßnahmen entwickeln und gemeinsam mit dem BMAS die Rahmenbedingungen für faire Migration nach Deutschland deutlich intensiver fördern. Ein wichtiger Schritt dafür ist, das Thema private Vermittlungsagenturen auf die Tagesordnung der Gemeinsamen MMPA-Unterarbeitsgruppe Erwerbsmigration zu setzen, wie in der Fachkräftestrategie Indien angekündigt. Darüber hinaus sollte die Bundesregierung anregen, dass im Rahmen einer möglichen Reform des indischen Migrationsrechts auch erwogen werden sollte, private Vermittlungsagenturen, die in Richtung Europa rekrutieren, besser zu regulieren – etwa durch den Protector General of Emigrants und die Plattform eMigrate. Alternativ ließe sich mit der indischen Regierung ein Katalog vertrauenswürdiger Agenturen erstellen oder der Dialog mit den unterschiedlichen Verbänden der privaten Vermittlungsagenturen suchen, um freiwillige Selbstverpflichtungen auf dem deutsch-indischen Migrationskorridor zu etablieren.
Es ist ungewiss, ob das deutsche Konzept fairer Migration mit der Realität der indischen Migrationslandschaft vereinbar ist.
Aber auch die Grenzen migrationsbezogener EZ müssen klar benannt werden: Es ist ungewiss, ob das deutsche Konzept fairer Migration mit der Realität der indischen Migrationslandschaft vereinbar ist und sich beispielsweise das Employer-Pays-Prinzip komplett durchsetzen lässt. Jedenfalls ist die indische Regierung bisher zurückhaltend, wenn es um eine stärkere Regulierung privater Vermittlungsagenturen geht, und deswegen bleibt abzuwarten, ob sich das ändert. Deshalb sollte die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen semibundesstaatlichen Vermittlern wie Norka Roots ausgebaut werden, die dem Employer-Pays-Prinzip folgen und auf diese Weise – zumindest regional – dazu beitragen, dass migrationsinteressierte Inder:innen ein stärkeres Bewusstsein für faire Rekrutierungsprinzipien bekommen.185 Die Kapazitäten der etablierten semibundesstaatlichen Vermittler zur direkten Vermittlung nach Deutschland sollten gezielt und ohne Umweg über deutsche Umsetzungsorganisationen gestärkt werden. Ergänzend könnten unter Einbindung deutscher Arbeitgeber Pilotprojekte zu fairen Kredit- und Rückzahlungsmodellen konzipiert werden, um auch jene Migrant:innen zu unterstützen, welche die Dienstleistung ausgewählter vertrauenswürdiger privater Agenturen in Anspruch nehmen.
Ansätze zur EU-Zusammenarbeit mit Indien
Indien hat mit sechs EU-Mitgliedstaaten Migrationsabkommen geschlossen. Dabei gibt es einen Nachahmungseffekt. Deutschland hat sich mit dem MMPA weitgehend am Abkommen Frankreichs orientiert, Österreich wiederum am deutschen Vorbild. Zugleich hat die EU mit Indien im Jahr 2016 mit der Common Agenda on Migration and Mobility (CAMM) einen Rahmen für den Dialog zu Migration, Mobilität und Rückübernahme geschaffen. Dieses rechtlich unverbindliche Instrument wurde ebenfalls mit Nigeria, Äthiopien, Jordanien und Marokko vereinbart. Es wird in Bezug auf Indien von der internationalen Organisation International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) gemeinsam mit der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO) und dem Indian Council of World Affairs (ICWA) umgesetzt.186 Indien wünscht sich allerdings, unter anderem wegen der empfundenen Schlagseite des Dialogs zu Rückkehrfragen, dass das Dialogformat neu ausgerichtet wird.187
Schon bevor die CAMM zustande kam, hatte die indische Seite ein umfassendes Migrationsabkommen mit der gesamten EU erwogen. So war um 2010 das damals noch unabhängige Ministry of Overseas Indian Affairs (MOIA) entschlossen, ein solches Abkommen mit der EU zu verhandeln. Das Vorhaben scheiterte aber an der mangelnden rechtlichen Zuständigkeit der EU-Kommission für die Fragen der Zuwanderung, denn dafür sind die Mitgliedstaaten verantwortlich. Theoretisch böte der von der EU-Kommission angestrebte Abschluss eines Handelsabkommens mit Indien188 einen guten Rahmen, um die migrationspolitische Kooperation zu stärken.189 Aufgrund der innenpolitischen Sprengkraft des Themas in vielen Mitgliedstaaten ist dies aber wenig wahrscheinlich.
Mindestens sollte aber gewährleistet werden, dass die Mitgliedstaaten sich über ihre Kooperationsvereinbarungen mit Indien austauschen, um aus den Erfahrungen mit den jeweiligen Migrationsabkommen zu lernen. Die indische Migration trifft in Europa auf sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Möglicherweise kann Deutschland von anderen Mitgliedstaaten Methoden zur Regulierung privater Vermittlung aus Indien übernehmen. Zudem sollte der Migrationskorridor von Indien in die EU besser verstanden werden. Notwendig dafür sind aussagekräftigere Daten sowohl über die Wanderungen indischer Staatsangehöriger zwischen Indien und den Mitgliedstaaten als auch innerhalb der EU. Ferner sollte im Dialog mit Indien darüber diskutiert werden, welche Maßnahmen gegen irreguläre Migration und Menschenschmuggel sinnvoll wären.190
Die EU-Kommission erwägt, in Indien ein neues Instrument seiner Migrationsdiplomatie, einen sogenannten Legal Gateway Office, als Pilotprojekt zu erproben.191 In der weiteren Ausgestaltung sollte vermieden werden, dass dieses Instrument sich mit Ansätzen der Mitgliedstaaten überschneidet und Doppelstrukturen entstehen. Ein wirklicher Mehrwert könnte darin bestehen, hier die Aufgabe der Qualitätsüberprüfung privater Vermittlungsagenturen für den europäisch-indischen Migrationskorridor anzusiedeln.
Fazit und Empfehlungen
In den letzten Jahren hat Deutschlands Migrationskooperation mit Indien einen spürbaren Aufschwung erlebt. Das Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen (MMPA) und die Fachkräftestrategie Indien haben die Voraussetzungen geschaffen, diese Entwicklung weiter voranzubringen, und es ist von Vorteil, dass sich nun eine eigene Unterarbeitsgruppe mit Fragen der Erwerbsmigration beschäftigt. Auf deutscher Seite gibt es indes weiterhin blinde Flecken, etwa hinsichtlich der vielen Aufgaben, die mit der steigenden Zahl indischer Studierender in Deutschland entstehen. Außerdem sollte die Kohärenz der deutschen Aktivitäten in Indien weiter verbessert werden, besonders im Hinblick auf die zahlreichen parallelen Fachkräfteinitiativen der Bundesländer.
Die Migrationsbewegungen aus Indien nach Deutschland diversifizieren sich: Während die Anzahl hochqualifizierter Personen zurückgeht, die über die Blaue Karte EU einreisen, kommen immer mehr Inder:innen als Studierende, Auszubildende, ausgebildete Fachkräfte (besonders im Bereich der Pflege) oder mit einer Chancenkarte für die Berufssuche. Da diese Zuwanderung weitgehend selbstorganisiert ist, sollten staatliche Maßnahmen sich noch mehr darauf konzentrieren, die Rahmenbedingungen für faire Migration zu verbessern und Fehlentwicklungen zu vermeiden. Ein wichtiger Lerneffekt ist die große Relevanz der privaten Vermittlungsagenturen, die an den Migrationsbewegungen aus Indien beteiligt sind. Die Tätigkeit der Agenturen wirksam zu regulieren sollte Vorrang in der Gemeinsamen MMPA-Arbeitsgruppe genießen. Ein gutes Vorbild liefert das Gütesiegel »Faire Anwerbung in der Pflege«, doch es kann nicht auf indische Vermittlungsagenturen und nicht ohne weiteres auf alle Branchen übertragen werden. Daher könnten neue Methoden erprobt werden, die das Bewusstsein migrationsinteressierter Inder:innen dafür erweitern, wie wichtig faire und transparente Rekrutierungspraktiken bei der Auswahl privater Vermittlungsagenturen sind.
Obwohl Rückübernahmekooperation ein integraler Teil der Migrationskooperation ist, sollte sie von den Themen der Erwerbsmigration getrennt betrachtet werden. Wird Indien von der neuen Bundesregierung oder im Zuge einer neuen einheitlichen EU-Liste als sicherer Herkunftsstaat eingestuft, ist das wegen der sehr geringen Asylanerkennungsquote konsequent. Ohnehin sollte die kleine Zahl von Asylanträgen und ausreisepflichtigen Inder:innen nicht im Mittelpunkt der bilateralen Migrationskooperation stehen. Schließlich sinkt die Zahl der Asylanträge weiter, während die Zahl indischer Staatsangehöriger in Deutschland beträchtlich steigt. Umso wichtiger ist es, auch jenseits der Asylstatistik aufmerksam auf Fehlentwicklungen zu reagieren und diesen frühzeitig entgegenzuwirken. Das betrifft etwa die prekäre Situation jener indischer Studierender, die hohe Summen an Vermittlungsagenturen und Privatuniversitäten gezahlt haben, um dann festzustellen, dass es sich dabei oft um Einrichtungen handelt, deren Abschlüsse von zweifelhafter Qualität und in Deutschland teils nicht anerkannt sind.
Die Migrationskooperation mit Indien darf nicht isoliert von der wachsenden internationalen Bedeutung und wirtschaftlichen Stärke des Landes betrachtet werden. Es wird erwartet, dass Indien Deutschland in den kommenden Jahren als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt überholen wird. So scheint es ratsam, Themen der bilateralen Zusammenarbeit – etwa Digitalisierung, KI oder Klimaschutz – mit Wissensaustausch und Mobilitätskomponenten zu verbinden. Die EU-Kommission hat Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen der EU mit Indien angekündigt und dabei hohe Erwartungen geweckt. Das daraus entstandene Momentum sollte genutzt werden, um die Migrationspolitik mit Indien innerhalb der EU besser abzustimmen und einen neuen Kooperationsrahmen zu entwickeln. Das von der EU-Kommission in Aussicht gestellte Legal Gateway Office in Indien sollte so konzipiert werden, dass Doppelstrukturen zwischen Mitgliedstaaten abgebaut werden können und ein klarer politischer Mehrwert entstehen kann.
Was die deutsche Migrationsdiplomatie anbelangt, hat die Migrationspartnerschaft mit Indien vor Augen geführt, dass Verantwortungsbereiche in der Bundesregierung zugeschnitten werden müssen. Auch wenn das BMI die Verhandlungen zu Abkommen mit Indien führte, kann es wenig dazu beitragen, die Versprechen im Bereich Erwerbsmigration einzulösen. Dafür haben sich das BMAS und das Auswärtige Amt hervorgetan, um ressortübergreifend einen länderspezifischen Ansatz der Fachkräfteanwerbung einzuläuten. Unabhängig davon, welche Erleichterungen die geplante digitale Einwanderungsagentur bringen wird, muss geklärt werden, welches Ministerium künftig für die Migrationskooperation mit Drittstaaten zuständig sein soll. Am naheliegendsten wäre angesichts der wichtigen Vorarbeit das Auswärtige Amt. Dabei muss freilich der hohe Stellenwert migrationsbezogener Zusammenarbeit noch stärker im Selbstverständnis der deutschen Diplomatie verankert werden. Wichtig ist ferner, die künftige Rolle der BA oder von Umsetzungsorganisationen wie der GIZ präziser zu bestimmen.
Die migrationsbezogene Entwicklungszusammenarbeit mit Indien sollte deutlich ausgeweitet werden, um die zunehmenden Wanderungsbewegungen aus Indien möglichst fair und partnerschaftlich zu gestalten. Dafür müsste das BMZ das bilaterale Portfolio überarbeiten und Synergien mit bestehenden Vorhaben, etwa im Bereich Berufsbildung, nutzen. Zudem sollte die bilaterale Zusammenarbeit direkt jene Partner in Indien stärken, die – wie beispielsweise Norka Roots in Kerala – einen Beitrag zu fairen Rekrutierungspraktiken leisten.
Nicht zuletzt ist die Frage der Willkommenskultur in Deutschland entscheidend für die weitere erfolgreiche Gestaltung der Migration aus Indien. Sollte sich die Haltung gegenüber Migration trotz aller Vorteile, die sie bringen kann, weiter verhärten, schadet das dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Wie andere Menschen mit Migrationsgeschichte erleben Inder:innen alltägliche Diskriminierung und Rassismus. Hier gegenzusteuern ist nicht nur eine politische, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Eine bedeutende Rolle dabei können Gewerkschaften und Arbeitgeber spielen, die häufig zurückhaltend gegenüber der Beschäftigung von Arbeitskräften aus dem Ausland sind. Bei all diesen Schritten gilt es schließlich die Teilhabemöglichkeiten für indische Migrant:innen in Deutschland zu erweitern und den Dialog mit den entstehenden Diasporanetzwerken in Deutschland zu suchen, deren Größe und Bedeutung in den kommenden Jahren weiter wachsen werden.
Abkürzungsverzeichnis
|
AA |
Auswärtiges Amt |
|
AHK |
Auslandshandelskammer |
|
APS |
Akademische Prüfstelle |
|
BA |
Bundesagentur für Arbeit |
|
BAföG |
Bundesausbildungsförderungsgesetz |
|
BAMF |
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge |
|
BDA |
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V. |
|
BfAA |
Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten |
|
BGBl. |
Bundesgesetzblatt |
|
BMAS |
Bundesministerium für Arbeit und Soziales |
|
BMBF |
Bundesministerium für Bildung und Forschung |
|
BMBFSFJ |
Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend |
|
BMFTR |
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt |
|
BMG |
Bundesministerium für Gesundheit |
|
BMI |
Bundesministerium des Innern |
|
BMWE |
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie |
|
BMZ |
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
|
CAMM |
Common Agenda on Migration and Mobility |
|
CEO |
Chief Executive Officer |
|
DAAD |
Deutscher Akademischer Austauschdienst |
|
DB |
Deutsche Bahn |
|
EU |
Europäische Union |
|
EuGH |
Europäischer Gerichtshof |
|
GIZ |
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit |
|
IAB |
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung |
|
ICMPD |
International Centre for Migration Policy Development |
|
ICWA |
Indian Council of World Affairs |
|
ILO |
International Labour Organization (Internationale Arbeitsorganisation) |
|
IT |
Informationstechnik |
|
IW |
Institut der deutschen Wirtschaft |
|
KI |
künstliche Intelligenz |
|
KMK |
Kultusministerkonferenz |
|
KVK |
Kendriya Vidyalaya Sangathan |
|
MEA |
Ministry of External Affairs (Indien) |
|
MEG |
Migration entwicklungspolitisch gestalten (GIZ) |
|
MINT |
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik |
|
MMPA |
Migrations- und Mobilitätspartnerschaftsabkommen |
|
MOIA |
Ministry of Overseas Indian Affairs (Indien) |
|
MOLE |
Ministry of Labour and Employment (Indien) |
|
MSDE |
Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (Indien) |
|
NRI |
Non-resident Indian |
|
NSDC |
National Skill Development Corporation |
|
NSDCI |
National Skill Development Corporation International |
|
ODA |
Official Development Assistance (Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit) |
|
ODEPC |
Overseas Development and Employment Promotion Consultants Ltd. |
|
OECD |
Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) |
|
ÖSD |
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch |
|
PGE |
Protector General of Emigrants (Indien) |
|
PIO |
Person of Indian Origin |
|
PoE |
Protector of Emigrants (regionale Behörden in Indien) |
|
PPP |
Public Private Partnership |
|
REAG/GARP |
Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany/Government Assisted Repatriation Programme |
|
TITP |
Technical Intern Training Program (Indien-Japan) |
|
UN DESA |
United Nations Department of Economic and Social Affairs (Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen) |
|
VAE |
Vereinigte Arabische Emirate |
Literaturhinweise
Christian Wagner (Hg.)
Indien als Partner der deutschen Außenpolitik
Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Oktober 2024 (SWP-Studie 23/2024)
David Kipp/Tobias Scholz
Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 22. Oktober 2024 (SWP-Podcast 27/2024)
Steffen Angenendt/Nadine Knapp/David Kipp
Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Januar 2023 (SWP-Studie 1/2023)
Endnoten
- 1
-
Verena Schulze Palstring, Das Potenzial der Migration aus Indien. Entwicklungen im Herkunftsland, internationale Migrationsbewegungen und Migration nach Deutschland, Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), 2015 (Forschungsbericht Nr. 26), S. 80, <https://www.bamf.de/SharedDocs/ Anlagen/DE/Forschung/Forschungsberichte/fb26-potenziale-migration-indien.pdf?__blob=publicationFile&v=14> (eingesehen am 20.3.2025).
- 2
-
Ebd., S. 81.
- 3
-
Nileena Suresh, »International Migration from India«, Data for India, 7.2.2025, <https://www.dataforindia.com/ international-migration/> (eingesehen am 2.5.2025).
- 4
-
Schulze Palstring, Das Potenzial der Migration aus Indien [wie Fn. 1], S. 81.
- 5
-
»Away from Home: On the Plight of the Indian Worker«, in: The Hindu (online), 23.12.2024, <https://www.thehindu. com/opinion/editorial/%E2%80%8Baway-from-home/article 69015954.ece> (eingesehen am 21.1.2025).
- 6
-
KPMG/Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) (Hg.), Global Mobility of Indian Workforce. A Comprehensive Report on Trends and Status in European Union, Australia, the UK and the GCC, Neu-Delhi, November 2024, S. 33.
- 7
-
World Development Report 2023. Migrants, Refugees, and Societies, Washington D.C.: World Bank, 2023, S. 97, <https:// www.worldbank.org/en/publication/wdr2023> (eingesehen am 7.1.2025).
- 8
-
Ebd., S. 8.
- 9
-
Stefan Lukas/Leo Wigger, Indien als aufstrebender Akteur im Nahen Osten: Entwicklungslinien, Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten, Berlin: Bundesakademie für Sicherheitspolitik, 2024 (Arbeitspapier Nr. 1/2024), <https://www.baks. bund.de/de/arbeitspapiere/2024/indien-als-aufstrebender-akteur-im-nahen-osten-entwicklungslinien> (eingesehen am 16.1.2025).
- 10
-
Amrita Datta, Stories of the Indian Immigrant Communities in Germany. Why Move?, Cham: Springer International Publishing, 2023, S. 81, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/swp-berlin/detail.action?docID=30881079>.
- 11
-
Wido Geis-Thöne, Zuwanderung aus Indien: Ein großer Erfolg für Deutschland, Köln: Institut der deutschen Wirtschaft (IW), 4.1.2022 (IW-Report Nr. 1), S. 9, <https://www.iwkoeln. de/studien/wido-geis-thoene-ein-grosser-erfolg-fuer-deutschland.html>.
- 12
-
Kalyani Vartak/Chinmay Tumbe, »Migration and Caste«, in: Sebastian Irudaya Rajan/M. Sumeetha (Hg.), Handbook of Internal Migration in India, Los Angeles: Sage, 2020, S. 252–267 (259), doi: 10.4135/9789353287788.n18.
- 13
-
Geis-Thöne, Zuwanderung aus Indien [wie Fn. 11], S. 9.
- 14
-
Swati Singh Parmar, »The Internationalisation of Caste«, Völkerrechtsblog, 15.6.2023, doi: 10.17176/20230615-110944-0.
- 15
-
Chloe Kim, »California Is First US State to Pass Ban on Caste Discrimination«, BBC News (online), 7.9.2023, <https:// www.bbc.com/news/world-us-canada-66736708> (eingesehen am 3.6.2025).
- 16
-
Suresh, »International Migration from India« [wie Fn. 3].
- 17
-
Ministry of External Affairs, Government of India, »Population of Overseas Indians«, Neu-Delhi, 21.1.2025, <https://www.mea.gov.in/population-of-overseas-indians. htm> (eingesehen am 21.1.2025).
- 18
-
Jeanne Batalova/Madeleine Greene, »Indian Immigrants in the United States«, Washington, D.C.: Migration Policy Institute, 8.11.2024, <https://www.migrationpolicy.org/ article/indian-immigrants-united-states> (eingesehen am 15.11.2024).
- 19
-
Office for National Statistics, Ethnic Group, England and Wales: Census 2021, Newport u.a., 29.11.2022, <https://www. ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/ethnicity/bulletins/ethnicgroupenglandandwales/census 2021> (eingesehen am 29.4.2025).
- 20
-
Office for National Statistics, Long-term International Migration, Provisional: Year Ending June 2023, Newport u.a., 23.11.2023, <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulation andcommunity/populationandmigration/international migration/bulletins/longterminternationalmigrationprovisio nal/yearendingjune2023> (eingesehen am 29.4.2025); Office for National Statistics, Long-term International Migration, Provisional: Year Ending June 2024, Newport u.a., 28.11.2024, <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/ populationandmigration/internationalmigration/bulletins/ longterminternationalmigrationprovisional/yearendingjune 2024#long-term-immigration> (eingesehen am 29.4.2025).
- 21
-
Statistics Canada, »2021 Census of Population«, Ottawa, 16.12.2022, <https://www12.statcan.gc.ca/census-recense ment/2021/as-sa/fogs-spg/page.cfm?topic=9&lang=E&dguid =2021A000011124> (eingesehen am 29.4.2025).
- 22
-
Australian Government, Department of Home Affairs, Australia’s Migration Trends, 2023–24, Belconnen 2024, S. 21, <https://www.homeaffairs.gov.au/research-and-stats/files/ migration-trends-2023-24.pdf> (eingesehen am 29.4.2025).
- 23
-
Sahil Sinha, »Justin Trudeau Announces ›Temporary‹ Cut in Intake of Immigrants to Canada«, in: India Today (online), 24.10.2024, <https://www.indiatoday.in/world/story/ justin-trudeau-canada-immigration-cut-temporary-housing-prices-economy-2622815-2024-10-24> (eingesehen am 29.4.2025).
- 24
-
UK Home Office, Immigration White Paper to Reduce Migration and Strengthen Border, London, 12.5.2025, <https:// www.gov.uk/government/news/immigration-white-paper-to-reduce-migration-and-strengthen-border> (eingesehen am 16.5.2025).
- 25
-
Hannah Ellis-Petersen, »Modi’s Government Planning to Repatriate 18,000 Indians Living in US Illegally«, in: The Guardian (online), 21.1.2025, <https://www.theguardian. com/us-news/2025/jan/21/modi-government-planning-to-repatriate-18000-indians-living-in-us-illegally> (eingesehen am 29.4.2025).
- 26
-
Batalova/Greene, »Indian Immigrants in the United States« [wie Fn. 18].
- 27
-
Sambavi Parthasarathy, »Most Deportees from the U.S. Are from Punjab, Haryana and Gujarat«, in: The Hindu (online), 19.2.2025, <https://www.thehindu.com/data/most-deportees-from-the-us-are-from-punjab-haryana-and-gujarat/article69233846.ece> (eingesehen am 4.6.2025).
- 28
-
Eurostat, »All Valid Permits by Reason, Length of Validity and Citizenship on 31 December of Each Year«, Luxemburg 2025, doi: 10.2908/MIGR_RESVALID.
- 29
-
Eurostat, »More Than 3.7 Million First Residence Permits in 2023« (online), Luxemburg, 12.9.2024, <https://ec.europa. eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20240912-1> (eingesehen am 2.5.2025).
- 30
-
Eurostat, »Residence Permits – Statistics on Stock of Permits at the End of the Year 2023« (online), Luxemburg, 14.11.2024, <https://tinyurl.com/54u8bty8> (eingesehen am 2.5.2025).
- 31
-
Eurostat, »Asylbewerber nach Art, Staatsangehörigkeit, Alter und Geschlecht – jährliche aggregierte Daten«, Luxemburg 2024, <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ migr_asyappctza/default/table?lang=de>.
- 32
-
Bundesministerium Inneres Österreich, »Illegale Migration aus Indien: Konsequente Rückführungen«, Wien, 12.6.2023, <https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=63745 A4D735247554B6B413D> (eingesehen am 29.4.2025).
- 33
-
»Illegale Einreisen: Polizei stoppt Inder mit Fahrrad auf A11«, NDR (online), 4.6.2024, <https://www.ndr.de/nach richten/mecklenburg-vorpommern/Illegale-Einreisen-Polizei-stoppt-Inder-mit-Fahrrad-auf-A11%2Cinder118.html> (eingesehen am 30.4.2025).
- 34
-
Eurostat, »Erstinstanzliche Entscheidungen über Asylanträge nach Art der Entscheidung, Staatsangehörigkeit, Alter und Geschlecht – jährliche aggregierte Daten«, Luxemburg 2025, <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/ product/page/MIGR_ASYDCFSTA> (eingesehen am 29.7.2025).
- 35
-
Datta, Stories of the Indian Immigrant Communities in Germany [wie Fn. 10], S. viii.
- 36
-
Schulze Palstring, Das Potenzial der Migration aus Indien [wie Fn. 1], S. 125.
- 37
-
Wido Geis-Thöne, (Hoch-)Qualifizierte Inderinnen und Inder in Deutschland, 10.2908/MIGR_ASYDCFSTA: Bundeszentrale für politische Bildung, 11.5.2022, <https://www.bpb.de/ themen/migration-integration/regionalprofile/deutschland/ 508205/hoch-qualifizierte-inderinnen-und-inder-in-deutschland/> (eingesehen am 20.3.2025).
- 38
-
Ebd.
- 39
-
Deutsches Historisches Museum Berlin, »Ausländische Studenten in der DDR«, <https://www.dhm.de/archiv/ausstel lungen/zuwanderungsland-deutschland/migrationen/rooms/ 0603.htm#:~:text=Im%20Studienjahr%201970/71%20waren,Entsendeland%20und%20der%20DDR%20festgelegt> (eingesehen am 1.7.2025).
- 40
-
Schulze Palstring, Das Potenzial der Migration aus Indien [wie Fn. 1], S. 125.
- 41
-
Geis-Thöne, Zuwanderung aus Indien [wie Fn. 11], S. 25.
- 42
-
Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Indische Staatsangehörige in Deutschland (Stichtag 31.1.2025).
- 43
-
Angaben der Bundesagentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus Drittstaaten nach Aufenthaltsstatus und Geschlecht (Stichtag 30.9.2024).
- 44
-
Fabio Ghelli/Miriam Sachs, »Migration – Nicht nur IT-Fachkräfte aus Indien«, Mediendienst Integration, 13.12.2024, <https://mediendienst-integration.de/artikel/nicht-nur-it-fachkraefte-aus-indien.html> (eingesehen am 20.3.2025).
- 45
-
Statistisches Bundesamt, »Wanderungen über die Grenzen Deutschlands nach ausgewählten Herkunfts- und Zielländern 2020 bis 2024«, 24.6.2025, <https://www.destatis. de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wande rungen/Tabellen/wanderungen-nach-herkunfts-ziel-gebieten-jahr-04.html> (eingesehen am 15.7.2025).
- 46
-
Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU. Fragen zur Qualität, Zielgenauigkeit und Nachhaltigkeit der Bildungs- und Erwerbsmigration, Bundestags-Drucksache 20/14956, Berlin, 12.2.2025, S. 14f, <https://dserver.bundestag.de/btd/20/149/2014956.pdf> (eingesehen am 20.3.2025).
- 47
-
Marcus Engler/Pau Palop-García, Ein Jahr Chancenkarte. Erste Bilanz des deutschen Punktesystems für Fachkräfteeinwanderung, Berlin: Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM), 28.5.2025 (DeZIM Briefing Notes), <https://www.dezim-institut.de/publikationen/ publikation-detail/ein-jahr-chancenkarte/> (eingesehen am 4.6.2025).
- 48
-
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Antrags-, Entscheidungs- und Bestandsstatistik 2024, Nürnberg 2024, <https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Statistik/Asyl geschaeftsstatistik/hkl-antrags-entscheidungs-bestands statistikl-kumuliert-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=21>.
- 49
-
Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI)/ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) (Hg.), Migrationsbericht der Bundesregierung 2023, Berlin/Nürnberg, Januar 2025, S. 259, <https://www.bamf.de/SharedDocs/ Anlagen/DE/Forschung/Migrationsberichte/migrationsbericht-2023.html>.
- 50
-
Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU [wie Fn. 46], S. 10.
- 51
-
Schulze Palstring, Das Potenzial der Migration aus Indien [wie Fn. 1], S. 126.
- 52
-
BMI/BAMF (Hg.), Migrationsbericht der Bundesregierung 2023 [wie Fn. 49], S. 225.
- 53
-
Davit Adunts u.a., Indische Arbeitskräfte in Deutschland, Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), 21.2.2024 (Informationen für VLI), S. 10, <https:// iab.de/daten/indische-arbeitskrafte-in-deutschland/> (eingesehen am 10.4.2025).
- 54
-
Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU [wie Fn. 46], S. 14.
- 55
-
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD), Wissenschaft weltoffen 2024. Daten und Fakten zur Internationalität von Studium und Forschung in Deutschland und weltweit, Bielefeld: wbv Media, 2024, S. 36, <https://www.wissenschaft-weltoffen. de/content/uploads/2024/11/WWO_2024_DT_aktualisiert_BF.pdf> (eingesehen am 15.7.2025).
- 56
-
Sebastian Schöbel, »Warum der Boom der indischen Community in Berlin kein Zufall ist«, RBB, 22.3.2025, <https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/03/berlin-migration-fachkraefte-indien-migrationsabkommen-.html> (eingesehen am 24.3.2025).
- 57
-
Carsten Wolf/Fabio Ghelli, »Neue Bundesbank-Zahlen – Mehr Rücküberweisungen ins Ausland«, Mediendienst Integration, 3.4.2025, <https://mediendienst-integration.de/artikel/ mehr-rueckueberweisungen-ins-ausland.html> (eingesehen am 3.6.2025).
- 58
-
»Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Indien über eine umfassende Migrations- und Mobilitätspartnerschaft«, BGBl. 2023 II/128, 5.5.2023, S. 2–20, <https://www.recht. bund.de/bgbl/2/2023/128/regelungstext.pdf?__blob=publica tionFile&v=2> (eingesehen am 10.10.2024).
- 59
-
»Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Indien über Soziale Sicherheit«, BGBl. 2012 II/19, S. 588–600, <https://www.dvka.de/media/dokumente/ rechtsquellen/svabkommen/indien_sva.pdf> (eingesehen am 23.3.2025).
- 60
-
Hintergrundgespräch des Autors mit Vertreter des Bundesministeriums des Innern im März 2025 in Berlin.
- 61
-
Government of India, Migration and Mobility Agreement between The Government of the Republic of India and the The Government of the French Republic, Neu-Delhi, 10.3.2018, <https:// www.mea.gov.in/Portal/LegalTreatiesDoc/FR18B3321.pdf> (eingesehen am 1.4.2025).
- 62
-
Nadine Biehler/David Kipp/Anne Koch, Potentiale bilateraler Migrationsabkommen. Von Symbolpolitik zu praktischer Umsetzung, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, September 2024 (SWP-Aktuell 48/2024), doi: 10.18449/2024A48.
- 63
-
Auswärtiges Amt, »›Deutschland – Europa – Asien: Das 21. Jahrhundert gemeinsam gestalten‹. Bundesregierung beschließt Indo-Pazifik-Leitlinien«, Pressemitteilung, Berlin, 1.9.2020, <https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/ asien/indo-pazifik-leitlinien-2380340> (eingesehen am 4.6.2025).
- 64
-
Auswärtiges Amt (Hg.), Fokus auf Indien, Berlin, Oktober 2024, <https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2680204/9 fc49c0ef2df93f1ffb8ccad1b5f66b6/241016-fokus-indien-data.pdf> (eingesehen am 21.10.2024).
- 65
-
BMI, »Deutsch-indisches Migrationsabkommen unterzeichnet«, Pressemitteilung, Berlin, 5.12.2022, <https://www. bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2022/12/abkommen-indien.html> (eingesehen am 16.9.2024).
- 66
-
Ministry of External Affairs, Government of India, District and State Wise List of Active Recruiting Agents, Neu-Delhi, 4.1.2024, <https://www.mea.gov.in/Images/attach/03-List-4-2024.pdf> (eingesehen am 17.9.2024).
- 67
-
»Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Indien über eine umfassende Migrations- und Mobilitätspartnerschaft« [wie Fn. 58], S. 8f.
- 68
-
Biehler/Kipp/Koch, Potentiale bilateraler Migrationsabkommen [wie Fn. 62].
- 69
-
Sameena Hameed, »India’s Labour Agreements with the Gulf Cooperation Council Countries: An Assessment«, in: International Studies, 58 (2021) 4, S. 442–465 (458).
- 70
-
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)/ Auswärtiges Amt (AA) (Hg.), Fachkräftestrategie Indien. Indien als starker Partner für Deutschland, Berlin, Oktober 2024, <https:// www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Pressemitteilungen/2024/fachkraeftestrategie-indien.pdf?__blob=publication File&v=1> (eingesehen am 18.10.2024).
- 71
-
BMAS/AA (Hg.), Fachkräftestrategie Indien [wie Fn. 70], S. 18.
- 72
-
Steffen Angenendt/Nadine Knapp/David Kipp, Deutschland sucht Arbeitskräfte. Wie die Arbeitskräfteanwerbung entwicklungsorientiert, nachhaltig und fair gestaltet werden kann, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Januar 2023 (SWP-Studie 1/2023), doi: 10.18449/ 2023S01.
- 73
-
Biehler/Kipp/Koch, Potentiale bilateraler Migrationsabkommen [wie Fn. 62].
- 74
-
Hintergrundgespräch des Autors mit Ministeriumsvertreter im Februar 2024 in Berlin.
- 75
-
»Government to Merge Overseas Indian Affairs Ministry with MEA«, in: Times of India (online), 8.1.2016, <https://times ofindia.indiatimes.com/india/government-to-merge-overseas-indian-affairs-ministry-with-mea/articleshow/50491031.cms> (eingesehen am 3.4.2025).
- 76
-
Meera Sethi/Debolina Kundu, »Migration Policy: Where Do We Stand?«, in: Irudaya Rajan/Sumeetha (Hg.), Handbook of Internal Migration in India [wie Fn. 12], S. 684–702 (692), doi: 10.4135/9789353287788.n50.
- 77
-
»A New Law in the Works for Safe, Orderly Migration«, in: Economic Times (online), 6.2.2025, <https://economic times.indiatimes.com/nri/migrate/a-new-law-in-the-works-for-safe-orderly-migration/articleshow/117978626.cms? from=mdr> (eingesehen am 10.6.2025).
- 78
-
Ministry of External Affairs, Government of India, »eMigrate – List of Unregistered Agencies against which Grievances Received«, Neu-Delhi, <https://www.emigrate. gov.in/#/emigrate/recruiting-agent/list-of-unregistered-ra-agencies-or-agents> (eingesehen am 21.5.2025).
- 79
-
PRS Legislative Research, Welfare of Indian Diaspora and Status of Emigration Bill (Standing Committee Report Summary), Neu-Delhi, 9.4.2025, <https://prsindia.org/policy/report-summaries/welfare-of-indian-diaspora-and-status-of-emigration-bill> (eingesehen am 3.5.2025).
- 80
-
Shibimol KG, »Emotional Video from Kerala Man Forced to Fight in Russia-Ukraine Conflict Surfaces«, in: India Today, 15.1.2025, <https://www.indiatoday.in/india/kerala/story/ kerala-man-injured-in-russia-ukraine-conflict-says-contract-canceled-forced-to-fight-2665185-2025-01-15> (eingesehen am 10.6.2025).
- 81
-
»A New Law in the Works for Safe, Orderly Migration« [wie Fn. 77].
- 82
-
Lok Sabha (erste Kammer des indischen Parlaments), The Immigration and Foreigners Bill, 2025, 27.3.2025, <https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2025/Immigration_and_Foreigners_Bill_2025.pdf> (eingesehen am 16.6.2025).
- 83
-
Geis-Thöne, Zuwanderung aus Indien [wie Fn. 11].
- 84
-
»Kerala Government Forms Task Force to Combat Illegal Recruitment and Visa Fraud«, in: Deccan Herald (online), 18.10.2024, <https://www.deccanherald.com/india/kerala/ kerala-government-forms-task-force-to-combat-illegal-recruitment-and-visa-fraud-3238440> (eingesehen am 10.6.2025).
- 85
-
»Crackdown on Illegal Recruitment Agencies Uncovers Widespread Fraud«, in: Times of India (online), 21.3.2025, <https://timesofindia.indiatimes.com/city/thiruvananthapuram/crackdown-on-illegal-recruitment-agencies-uncovers-widespread-fraud/articleshow/119270217.cms> (eingesehen am 10.6.2025).
- 86
-
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), »Fachkräftefonds Migration & Diaspora«, Bonn/Eschborn 2025, <https://www.giz.de/de/weltweit/ 80044.html> (eingesehen am 19.5.2025).
- 87
-
The Insight Partners, »India Staffing and Recruitment Market to Reach US$ 48,530.94 Million by 2030«, Pressemitteilung, 5.10.2023, <https://www.theinsightpartners.com/ pr/india-staffing-and-recruitment-market> (eingesehen am 3.5.2025).
- 88
-
Ministry of External Affairs, Government of India, »Recruiting Agents (RAs): Guidelines for Registration as RAs«, Neu-Delhi, 10.2.2023, <https://www.mea.gov.in/ras.htm> (eingesehen am 1.7.2025).
- 89
-
PRS Legislative Research, Welfare of Indian Diaspora and Status of Emigration Bill [wie Fn. 79].
- 90
-
DAAD, Indien als strategischer Partner. Handlungsempfehlungen des DAAD für deutsche Hochschulen, Bonn: März 2025 (DAAD Perspektiven), S. 13, <https://static.daad.de/media/daad_de/ der-daad/kommunikation-publikationen/presse/250312 _daad_perspektiven_indien_dt_bf.pdf> (eingesehen am 21.3.2025).
- 91
-
Hintergrundgespräche des Autors mit internationalen Indien-Expert:innen im Juni 2025 (digital).
- 92
-
KPMG/FICCI (Hg.), Global Mobility of Indian Workforce [wie Fn. 6], S. 11.
- 93
-
Neelanjit Das, »Overseas Job Recruitment Agents Cannot Charge More than Rs 30,000: Govt«, in: Economic Times (online), 23.12.2023, <https://economictimes.india times.com/wealth/save/overseas-job-recruitment-agents-cant-charge-more-than-this-limit-govt/articleshow/10621336 4.cms?utm_source=chatgpt.com> (eingesehen am 18.7.2025).
- 94
-
Hameed, »India’s Labour Agreements with the Gulf Cooperation Council Countries« [wie Fn. 69], S. 445.
- 95
-
Hintergrundgespräch des Autors mit privater Vermittlungsagentur im Juli 2024 in Neu-Delhi.
- 96
-
Hintergrundgespräch des Autors mit Vertreterin der AHK Indien im Juni 2025 (digital).
- 97
-
Website von IndiaWorks: <https://india-works.de/> (eingesehen am 18.5.2025).
- 98
-
Institute for Human Rights and Business (IHRB), »The Employer Pays Principle«, <https://www.ihrb.org/projects/ employer-pays-principle> (eingesehen am 2.7.2025).
- 99
-
Hintergrundgespräch des Autors mit Geschäftsführer von IndiaWorks im Juli 2025 (digital).
- 100
-
Till Fähnders/Tim Niendorf, »›Die Inder sind mein Kapital‹«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (online), 14.2.2024, <https://www.djp.de/images/preistraeger-2024/die-inder-sind-mein-kapital.pdf> (eingesehen am 5.6.2025).
- 101
-
Brinda Sarkar, »BorderPlus Acquires Onea Care, Paving the Way for Indian Nurses in Germany«, in: Economic Times (online), 1.4.2025, <https://economictimes.indiatimes.com/ nri/work/borderplus-acquires-onea-care-paving-the-way-for-indian-nurses-in-germany/articleshow/119848160.cms ?from=mdr> (eingesehen am 18.5.2025).
- 102
-
Express Healthcare, »TERN Group and NSDC (I) to Help 7,000+ Nurses with Global Jobs in 2025«, 24.12.2024, <https://www.expresshealthcare.in/news/tern-group-and-nsdc-i-to-help-7000-nurses-with-global-jobs-in-2025/447419/> (eingesehen am 21.5.2025).
- 103
-
Gütegemeinschaft Anwerbung und Vermittlung von Pflegekräften aus dem Ausland (Website), <https://www.faire-anwerbung-pflege-deutschland.de/> (eingesehen am 21.5.2025).
- 104
-
Sanjay Kumar, Indian Perceptions of Europe and Germany. A Report, Neu-Delhi 2025, S. 62.
- 105
-
Ministry of External Affairs, Government of India, »List of MoUs/Agreements Signed with Other Countries«, Neu-Delhi 2024, <https://www.mea.gov.in/Images/CPV/RSe-1999-1-12-12-2024.pdf> (eingesehen am 3.5.2025).
- 106
-
»Narendra Modi’s Secret Weapon: India’s Diaspora«, in: The Economist (online), 27.3.2024, <https://www.economist. com/international/2024/03/27/narendra-modis-secret-weapon-indias-diaspora> (eingesehen am 16.9.2024).
- 107
-
Gayatri Nayak, »India Receives over $100 Billion Remittances for Three Consecutive Years«, in: Economic Times (online), 31.3.2025, <https://tinyurl.com/msve75cc> (eingesehen am 5.6.2025).
- 108
-
Dhirendra Gajbhiye u.a., Changing Dynamics of India’s Remittances. Insights from the Sixth Round of India’s Remittances Survey, Mumbai: Reserve Bank of India, März 2025 (RBI Bulletin), <https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=23260>.
- 109
-
International Labour Organization, India Employment Report 2024. Youth Employment, Education and Skills, Genf, 29.3.2024, S. 20, <https://www.ilo.org/publications/india-employment-report-2024-youth-employment-education-and-skills> (eingesehen am 17.9.2024).
- 110
-
»India Needs to Create 148 mn Additional Jobs by 2030 Given Population Growth: Gita Gopinath« in: Economic Times (online), 17.8.2024, <https://economictimes.indiatimes.com/ news/india/india-needs-to-create-148-mn-additional-jobs-by-2030-given-population-growth-imf-dmd-gopinath/articleshow /112591177.cms?from=mdr> (eingesehen am 19.7.2025).
- 111
-
Ashoka Mody, India Is Broken. A People Betrayed, Independence to Today, Stanford, CA: Stanford University Press, 2023, S. 11ff.
- 112
-
National Skill Development Corporation (NSDC), »Technical Intern Training Program (TITP)«, <https://nsdc india.org/home-titp> (eingesehen am 19.5.2025).
- 113
-
Hintergrundgespräche des Autors mit beteiligten Ministeriumsvertreter:innen im Juli 2024 in Neu-Delhi und im Mai 2025 in Berlin.
- 114
-
»The Many Flaws in the Israeli Job Scheme for Indians«, in: Deccan Herald (online), 10.9.2024, <https://www.deccan herald.com/india/the-many-flaws-in-the-israeli-job-scheme-for-indians-3184472> (eingesehen am 19.5.2025).
- 115
-
Hintergrundgespräche des Autors mit privaten Vermittlungsagenturen im Juli 2024 in Neu-Delhi.
- 116
-
Ritu Sarin, »After Pile of Complaints, National Skill Corporation CEO Removed«, in: Indian Express (online), 28.5.2025, <https://indianexpress.com/article/india/after-pile-of-complaints-national-skill-corporation-ceo-removed-10032908/> (eingesehen am 5.6.2025).
- 117
-
GIZ, »Nachhaltig ausgerichtete Gewinnung von Pflegekräften (Triple Win)«, 2024, <https://www.giz.de/de/weltweit/ 41533.html> (eingesehen am 17.9.2024).
- 118
-
Geis-Thöne, Zuwanderung aus Indien [wie Fn. 11], S. 28.
- 119
-
Gajbhiye u.a., Changing Dynamics of India’s Remittances [wie Fn. 108], S. 92.
- 120
-
Astrid Scheppelmann, »Fachkräfte. THE LÄND und der Partnerbundesstaat Maharashtra unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Fachkräftemigration«, Stuttgart: Baden-Württemberg International, 20.3.2024, <https://www.bw-i.de/newsroom/news/nachricht/fachkraefte-service-desk-kooperationsbuero-indien> (eingesehen am 3.5.2025).
- 121
-
Government of Maharashtra, »Employment Opportunity in Germany. Pathdarshi Project«, in: Indian Express, 24.8.2024.
- 122
-
Niraj Pandit, »Govt Inaction Stalls Germany Job Hopes of 7,500 Youngsters«, in: Hindustan Times (online), 1.7.2025, S. 4, <https://www.pressreader.com/similar/281672555938251>.
- 123
-
Axel Plünnecke, Qualifizierte Zuwanderung: Indische Beschäftigte verdienen am meisten, Köln: Institut der deutschen Wirtschaft (IW), 28.12.2024 (IW-Kurzbericht 98/2024), <https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2024/IW-Kurzbericht_2024-Lohnvorsprung-Inder.pdf> (eingesehen am 24.3.2025).
- 124
-
Laurenz Hemmen/Siddhi Pal, Where Is Europe’s AI Workforce Coming From? Immigration, Emigration & Transborder Movement of AI Talent, Berlin: Interface, 31.7.2024 (Data Brief), <https://www.interface-eu.org/publications/where-is-europes-ai-workforce-coming-from> (eingesehen am 9.4.2025).
- 125
-
Susanne U. Schultz, Fachkräfteengpässe und Zuwanderung aus Unternehmenssicht in Deutschland 2024: Die Bedarfe bleiben hoch, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, Oktober 2024 (Policy Brief), <https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/themen/ aktuelle-meldungen/2024/oktober/trotz-erheblichen-fach kraeftemangels-nur-wenige-unternehmen-werben-personal-im-ausland-an> (eingesehen am 4.5.2025).
- 126
-
Thomas Liebig/Maria Huerta del Carmen, Der Weg nach Deutschland. Ergebnisse der Schlussbefragung einer Längsschnittstudie von an Deutschland interessierten Fachkräften aus dem Ausland, Paris/Berlin, 31.1.2024, S. 16f, <https://blog.oecd-berlin.de/wp-content/uploads/2024/01/OECD-Fachkraefte migrationsbefragung-Jahresergebnisse-FINAL.pdf> (eingesehen am 2.7.2025).
- 127
-
GIZ, »Nachhaltig ausgerichtete Gewinnung von Pflegekräften (Triple Win)« [wie Fn. 117].
- 128
-
Website von Global Skills Partnerships: <https://global-skills-partnerships.de/> (eingesehen am 6.6.2025).
- 129
-
BMAS/AA (Hg.), Fachkräftestrategie Indien [wie Fn. 70], S. 35.
- 130
-
Engler/Palop-García [wie Fn. 47], S. 4.
- 131
-
»13,35,878 Indian Students Studying Abroad, Canada Tops the List«, in: The New Indian Express (online), 1.8.2024, <https://www.newindianexpress.com/nation/2024/Aug/01/1335878-indian-students-studying-abroad-canada-tops-the-list> (eingesehen am 6.6.2025).
- 132
-
Gajbhiye u.a., Changing Dynamics of India’s Remittances [wie Fn. 108], S. 93.
- 133
-
DAAD, Indien als strategischer Partner [wie Fn. 90], S. 12.
- 134
-
Lisa Ruth Brunner u.a., »Magnets, Gatekeepers, Surveillants, and Refiners: The Emergence of Higher Education Institutions as Migration Governance Actors in Australia, Canada, and Germany, 1990 to 2019«, in: International Journal of Educational Research, 129 (2025) 102490, doi: 10.1016/j.ijer.2024.102490.
- 135
-
Thomas Faist u.a., »Migration von indischen Hochqualifizierten und Studierenden nach Deutschland. Auswahlkriterien, Bleibeintentionen und Entwicklungseffekte«, in: Bertelsmann Stiftung (Hg.), Faire Fachkräftezuwanderung nach Deutschland. Grundlagen und Handlungsbedarf im Kontext eines Einwanderungsgesetzes, Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, 2017, S. 143–160 (149).
- 136
-
Brunner u.a., »Magnets, Gatekeepers, Surveillants, and Refiners« [wie Fn. 134], S. 7f.
- 137
-
DAAD, Indien als strategischer Partner [wie Fn. 90], S. 18.
- 138
-
Akila Kannadasan, »On Our Love for Engineering«, in: The Hindu, 16.9.2016, <https://www.thehindu.com/features/ metroplus/society/On-our-love-for-engineering/article1440 4932.ece> (eingesehen am 6.6.2025).
- 139
-
International Migration Outlook 2022, Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2022 (International Migration Outlook Series), S. 188, doi: 10.1787/30fe16d2-en.
- 140
-
Plünnecke, Qualifizierte Zuwanderung [wie Fn. 123], S. 1.
- 141
-
»Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Indien über eine umfassende Migrations- und Mobilitätspartnerschaft« [wie Fn. 58], S. 4.
- 142
-
DAAD, Indien als strategischer Partner [wie Fn. 90], S. 13.
- 143
-
Hannah Ellis-Petersen/Aakash Hassan, »›They Are in Shock‹: Indian Students Fear Trump Has Ended Their American Dream«, in: The Guardian (online), 4.6.2025, <https://www.theguardian.com/world/2025/jun/04/indian-students-shock-trump-international-study-visa> (eingesehen am 6.6.2025).
- 144
-
DAAD, Indien als strategischer Partner [wie Fn. 90], S. 12f.
- 145
-
Sazana Jayadeva, »›Study-Abroad Influencers‹ and Insider Knowledge: How New Forms of Study-Abroad Expertise on Social Media Mediate Student Mobility from India to Germany«, in: Mobilities (online), 11.6.2023, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17450101.2023.2220944#abstractin:> (eingesehen am 22.11.2024).
- 146
-
»Lieferando, Wolt, Uber Eats & Co. Wie Lieferdienste in Berlin Tausende Migrant*innen aus Südasien ausbeuten«, Interview von Nadja Dorschner mit Aju Ghevarghese John, Berlin: Rosa Luxemburg Stiftung, 16.9.2024, <https://tinyurl.com/365s3ks6> (eingesehen am 22.11.2024).
- 147
-
Aakriti Dhawan, »Revealing the Struggles of South Asian Students in Germany. Dheeraj Tyagi & Aju John«, YouTube, 25.7.2025, <https://www.youtube.com/watch? v=kB9uTvwGCuE> (eingesehen am 28.7.2025)
- 148
-
Nina Scholz, »Junge Inder in Deutschland:
Das Geschäft mit den Studis«, in: taz (online), 1.7.2025, <https://taz.de/Junge-Inder-in-Deutschland/!6094350/> (eingesehen am 1.7.2025). - 149
-
BMAS/AA (Hg.), Fachkräftestrategie Indien [wie Fn. 70], S. 29.
- 150
-
Deutscher Bundestag, Wirkung des deutsch-indischen Migrationsabkommens. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU, Bundestags-Drucksache 20/10499, Berlin, 27.2.2024, S. 4, <https://tinyurl.com/bdzy8n65> (eingesehen am 19.9.2024).
- 151
-
»Abschiebungen: Noch kein Effekt des Migrationsabkommens mit Indien« (dpa), in: Die Zeit (online), 29.4.2023, <https://www.zeit.de/news/2023-04/29/noch-kein-effekt-des-migrationsabkommens-mit-indien> (Zugriff 19.9.2024).
- 152
-
Hintergrundgespräche des Autors im Februar 2024 und März 2025 mit Ministeriumsvertreter:innen in Berlin.
- 153
-
»Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Indien über eine umfassende Migrations- und Mobilitätspartnerschaft« [wie Fn. 58], S. 11–13.
- 154
-
Hintergrundgespräche des Autors mit indischen Ministeriumsvertreter:innen im Juli 2024 in Neu-Delhi.
- 155
-
BAMF, »REAG/GARP«, Nürnberg, 16.1.2025, <https://www.bamf.de/DE/Themen/Rueckkehr/Foerder programmREAGGARP/reag garp-node.html> (eingesehen am 21.7.2025).
- 156
-
PRS Legislative Research, Welfare of Indian Diaspora and Status of Emigration Bill [wie Fn. 79].
- 157
-
Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage Abgeordneten Clara Bünger, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer Abgeordneter und der Gruppe Die Linke, Abschiebungen und Ausreisen im Jahr 2024, Bundestags-Drucksache 20/14946, 11.2.2025, S. 2, <https://dserver.bundes tag.de/btd/20/149/2014946.pdf> (eingesehen am 19.4.2025).
- 158
-
Ebd., S. 25.
- 159
-
European Council on Refugees and Exiles (ECRE), »Asylum Information Database«, <https://asylumineurope. org/reports/> (eingesehen am 16.6.2025).
- 160
-
Asylum Information Database, »Safe Country of Origin. Netherlands«, <https://asylumineurope.org/reports/country/ netherlands/asylum-procedure/the-safe-country-concepts/ safe-country-origin/> (eingesehen am 20.5.2025).
- 161
-
Europäische Kommission, »Vorschlag der EU-Kommission: Elemente des Migrations- und Asylpakets vorziehen und erste EU-Liste sicherer Herkunftsstaaten erstellen«, Pressemitteilung, Brüssel, 16.4.2025, <https:// ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_25_1070>.
- 162
-
BMAS/AA (Hg.), Fachkräftestrategie Indien [wie Fn. 70], S. 27.
- 163
-
Ebd., S. 20.
- 164
-
»Foreign Ki Duniya«, YouTube, 18.5.2025, <https:// www.youtube.com/channel/UC9PO7QJa9N74nQwgF7t3juw> (eingesehen am 18.5.2025).
- 165
-
Hintergrundgespräche des Autors mit unterschiedlichen Gesprächspartnern im Juli 2024 in Hyderabad, Mumbai, Pune und Neu-Delhi.
- 166
-
»telc wächst in Indien«, telc, 16.12.2024, <https://tinyurl.com/k3hedydj> (eingesehen am 20.5.2025).
- 167
-
Website von ÖSD: <https://www.osd.at/> (eingesehen am 1.7.2025).
- 168
-
Hintergrundgespräch des Autors mit privater Vermittlungsagentur im Juli 2024 in Neu-Delhi.
- 169
-
Hintergrundgespräch des Autors mit indischem Migrationsexperten im Juni 2025 (digital).
- 170
-
»PASCH-Schulen in Indien«, Goethe Institut, <https:// www.goethe.de/ins/in/de/spr/eng/pasch/psn.html> (eingesehen am 6.6.2025).
- 171
-
Christine Möllhoff, »Neu-Delhi: Indiens Regierung bremst Deutsch-Unterricht«, in: Rheinische Post (online), 4.11.2014, <https://rp-online.de/politik/indiens-regierung-bremst-deutsch-unterricht_aid-20167319> (eingesehen am 20.5.2025).
- 172
-
BMZ (Hg.), Zentren für Migration und Entwicklung, Berlin, November 2023 (BMZ Factsheet), <https://www.bmz.de/ resource/blob/187786/bmz-factsheet-zentren-fuer-migration-und-entwicklung.pdf> (eingesehen am 20.5.2025).
- 173
-
GIZ, Shaping Development Oriented Migration, Eschborn, September 2024, <https://www.giz.de/en/downloads/giz2023-en-Shaping-Development-Oriented-Migration.pdf> (eingesehen am 22.4.2025).
- 174
-
GIZ, Bridging the Gender Gap in Green Skills. Indo-German Green Skills Programme (IGGSP), Bonn/Eschborn, August 2024, <https://www.giz.de/de/downloads/giz2024-en-bridging-the-gender-gap-in%20green-skills.pdf> (eingesehen am 20.3.2025).
- 175
-
BMAS/AA (Hg.), Fachkräftestrategie Indien [wie Fn. 70], S. 18.
- 176
-
Hintergrundgespräch mit beteiligtem Ministeriumsvertreter im Mai 2025 in Berlin.
- 177
-
Als ODA anrechenbar sind öffentliche Mittel, wenn sie von öffentlichen Stellen an Entwicklungsländer oder deren Staatsangehörige oder an internationale Organisationen vergeben werden, um deren wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, »Leitfaden ›Was ist Official Development Assistance (ODA)?‹«, Berlin, 22.7.2025, <https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen-fakten/oda-zahlen/hintergrund/leitfaden-oda-19206> (eingesehen am 22.7.2025).
- 178
-
Alp Consulting, »Bridging the Gap: How is India Addressing Skills Shortages?«, <https://alp.consulting/how-india-addressing-skills-shortages/> (eingesehen am 8.6.2025).
- 179
-
Sakthivel Selvaraj u.a., India. Health System Review, Neu-Delhi: World Health Organisation, 2022, <https://iris.who.int/ bitstream/handle/10665/352685/9789290229049-eng.pdf? sequence=1> (eingesehen am 20.5.2025).
- 180
-
Frederic Docquier/Hillel Rapoport, Globalization, Brain Drain and Development, Cambridge, MA: Center for International Development at Harvard University (CID), März 2011 (CID Working Paper Nr. 219), S. 41ff, <https://www.hks. harvard.edu/sites/default/files/centers/cid/files/publications/ faculty-working-papers/219.pdf> (eingesehen am 16.1.2025).
- 181
-
GIZ, »Nachhaltig ausgerichtete Gewinnung von Pflegekräften (Triple Win)« [wie Fn. 117].
- 182
-
Angaben der Bundesagentur für Arbeit (Stand April 2025).
- 183
-
BDA, Wege öffnen: Eine moderne Strategie für Erwerbsmigration. Kernforderungen für mehr Zuwanderung in Beschäftigung und Ausbildung, Berlin, 11.3.2025, S. 4, <https://tinyurl.com/2eb4fp6d> (eingesehen am 22.4.2025).
- 184
-
Hintergrundgespräch des Autors mit Vertreter:innen der BA im Februar 2025 in Berlin.
- 185
-
Mahima Jain, »How Not to Be Deported: India’s Nurses Seeking Work Abroad Learn How to Migrate Safely«, in: The Guardian (online), 12.3.2025, <https://www.theguardian.com/ global-development/2025/mar/12/how-not-to-be-deported-indias-nurses-seeking-work-abroad-learn-how-to-migrate-safely> (eingesehen am 20.5.2025).
- 186
-
ICMPD, »India-EU Cooperation and Dialogue on Migration and Mobility Phase II«, <https://www.icmpd.org/our-work/projects/india-eu-cooperation-and-dialogue-on-migration-and-mobility-phase-ii-india-eu-cdmm-phase-ii> (eingesehen am 2.11.2023).
- 187
-
Hintergrundgespräche des Autors mit unterschiedlichen Gesprächspartnern im Dezember 2024 in Brüssel.
- 188
-
Europäische Kommission, Vertretung in Österreich, »EU und Indien streben Einigung auf Freihandelsabkommen in diesem Jahr an«, 28.2.2025, <https://austria.representation. ec.europa.eu/news/eu-und-indien-streben-einigung-auf-freihandelsabkommen-diesem-jahr-2025-02-28_de> (eingesehen am 4.5.2025).
- 189
-
Simon Stocker/Marion Panizzon, »Die Schweiz geht mit Indien eine Wette ein«, Avenir Suisse (Blog), 6.9.2024, <https://www.avenir-suisse.ch/die-schweiz-geht-mit-indien-eine-wette-ein-teil-1/> (eingesehen am 15.6.2025).
- 190
-
Sahajveer Baweja/Vansh Bhatnagar, »Addressing the Void: The Call for a Human Smuggling Law In India«, in: Law School Policy Review, 5.3.2024, <https://lawschoolpolicyreview. com/2024/03/05/addressing-the-void-the-call-for-a-human-smuggling-law-in-india/> (eingesehen am 17.5.2025).
- 191
-
Ursula von der Leyen, Letter from President on Migration, Brüssel, 16.12.2024, S. 4, <https://www.eunews.it/wp-content/uploads/2024/12/Letter-from-President-UvdL-on-Migration_EUCO-December-2024.pdf> (eingesehen am 4.5.2025).
Stichwortverzeichnis
Dieses Werk ist lizenziert unter CC BY 4.0
SWP-Studien unterliegen einem Verfahren der Begutachtung durch Fachkolleginnen und -kollegen und durch die Institutsleitung (peer review), sie werden zudem einem Lektorat unterzogen. Weitere Informationen zur Qualitätssicherung der SWP finden Sie auf der SWP-Website unter https:// www.swp-berlin.org/ueber-uns/qualitaetssicherung/.
SWP‑Studien geben die Auffassung der Autoren und Autorinnen wieder.
SWP
Stiftung Wissenschaft und Politik
Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit
Ludwigkirchplatz 3–4
10719 Berlin
Telefon +49 30 880 07-0
Fax +49 30 880 07-200
www.swp-berlin.org
swp@swp-berlin.org
ISSN (Print) 1611-6372
ISSN (Online) 2747-5115
DOI: 10.18449/2025S12